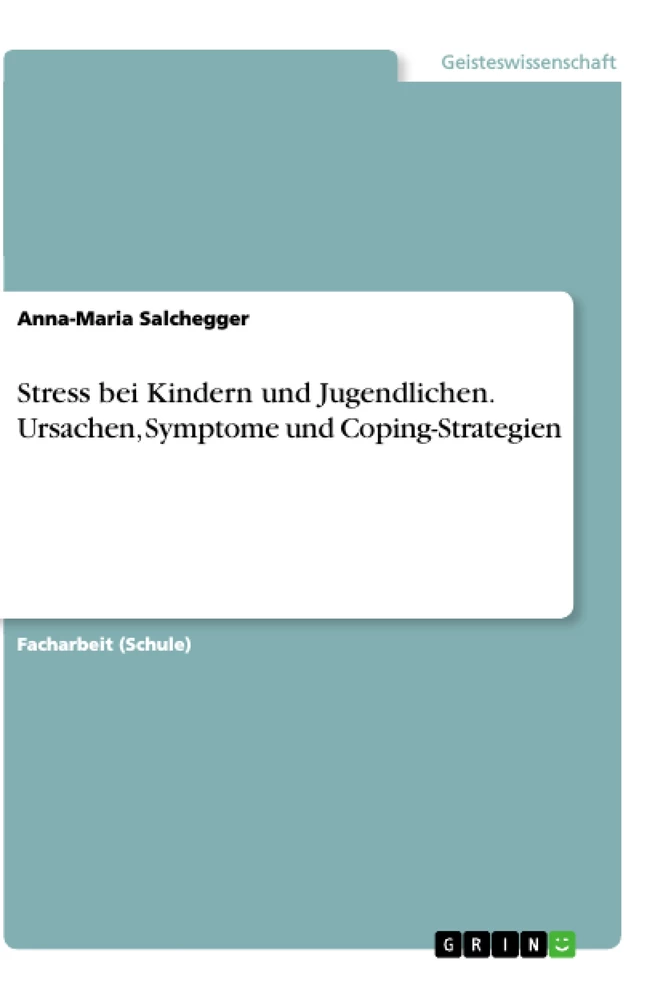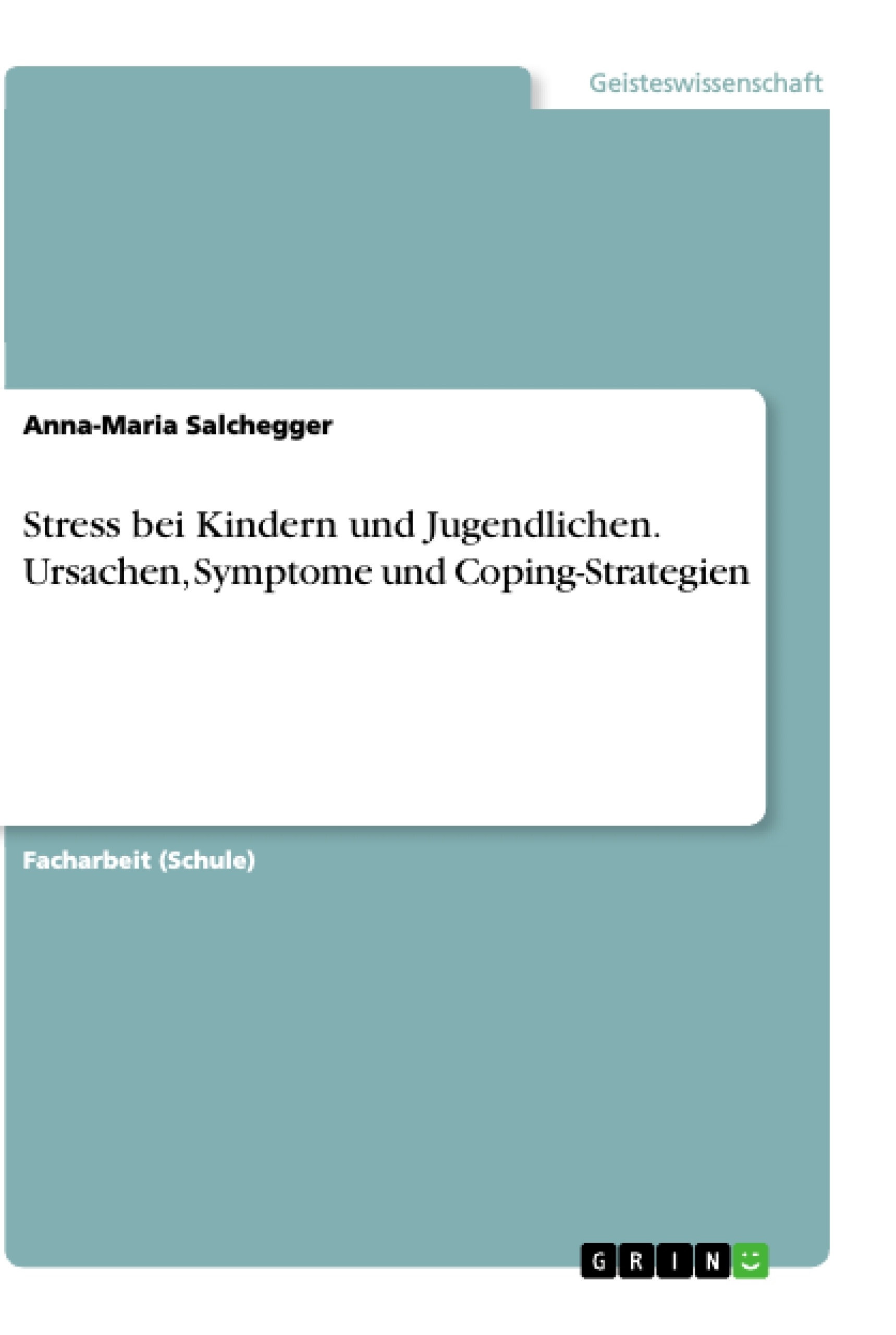Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Stress und Stressbewältigung bei Kindern und Jugendlichen“. Es werden verschiedene Möglichkeiten, Stress zu definieren, vorgestellt und kommentiert. Des Weiteren werden Möglichkeiten, wie Stress entsteht und welche Ursachen Stress auslösen können, erklärt. Darüber hinaus wird beschrieben, wie man Stress bewerten und wie man auf ihn reagieren kann.
Die drei bekanntesten Stressmodelle von Lazarus, Dohrenwend und Selye werden vorgestellt. Stress bei Kindern und Jugendlichen wird beschrieben und mögliche Stressoren, wie zum Beispiel Probleme in der Schule, werden erläutert. Außerdem werden die Folgen, welche Stress bei Kindern und Jugendlichen haben kann, näher beschrieben. Die möglichen Bewältigungsformen und Bewältigungsstrategien bei Kindern und Jugendlichen werden verdeutlicht.
Abschließend wird erklärt, wie Kinder und Jugendliche Stress vorbeugen und vermeiden können. Mithilfe einer Befragung an einem Gymnasium werden Unterschiede und Zusammenhänge von Symptomen und Bewältigungsmethoden bei Kindern und Jugendlichen ausgearbeitet und anschließend analysiert und kommentiert.
In der Physik bezeichnet Stress die mechanische Spannung, die auf einem Material lastet. Das Wort Stress wird heute aus dem Englischen mit Druck, Anspannung oder Beanspruchung übersetzt. Ursprünglich leitet sich der Begriff Stress vom lateinischen Wort „stringere“ ab. Es sind einige Übersetzungen möglich, zum Beispiel anspannen, in Spannung versetzen, drücken, zusammenpressen oder anziehen. Mittlerweile gibt es eine Reihe von verschiedenen Definitionen von Stress, doch keine allgemeingültige.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stress
- 2.1. Entstehung und Ursachen von Stress
- 2.2. Körperliche Symptome von Stress
- 2.3. Stressbewertung und Stressreaktionen
- 2.4. Stressmodelle
- 2.4.1. Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus
- 2.4.2. Das reizzentrierte Stressmodell nach Dohrenwend
- 2.4.3. Das reaktionszentrierte Stressmodell nach Selye
- 3. Stress bei Kindern und Jugendlichen
- 3.1. Stressoren im Kindes- und Jugendalter
- 3.1.1. Physische Stressfaktoren
- 3.1.2. Psychische Stressfaktoren
- 3.1.3. Soziale Stressfaktoren
- 3.1.4. Chemische Stressfaktoren
- 3.2. Stresssymptomatik bei Kindern und Jugendlichen
- 3.2.1. Die physiologische-vegetative Ebene
- 3.2.2. Die kognitiv-emotionale Ebene
- 3.2.3. Die verhaltensbezogene Ebene
- 3.3. Folgen von Stress bei Kindern und Jugendlichen
- 4. Coping
- 4.1. Bewältigungsformen
- 4.1.1. Reaktives Coping
- 4.1.2. Proaktives Coping
- 4.1.3. Antizipatorisches Coping
- 4.1.4. Präventives Coping
- 4.2. Stressbewältigungsstrategien
- 4.2.1. Problemzentriertes Coping
- 4.2.2. Emotionszentriertes Coping
- 4.3. Stressbewältigung bei Kindern und Jugendlichen
- 4.3.1. Veränderung der Stresssituation
- 4.3.2. Stressbewältigung durch das Kind/den Jugendlichen selbst
- 4.3.3. Soziale Unterstützung
- 5. Stressprävention
- 5.1. Ernährung
- 5.2. Schlaf
- 5.3. Hobby
- 6. Praktischer Teil: Fragebogenauswertung zum Thema „Stress- und Stressbewältigung bei Kindern und Jugendlichen“ am MPG St. Rupert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Stress und Bewältigungsstrategien bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, verschiedene Stressoren, Symptome und Bewältigungsmechanismen zu beleuchten und anhand einer Befragung am MPG St. Rupert Unterschiede und Zusammenhänge aufzuzeigen. Die Arbeit verzichtet auf die Darstellung von Schlussfolgerungen.
- Definition und Entstehung von Stress
- Stressoren im Kindes- und Jugendalter
- Stresssymptome und deren Auswirkungen
- Coping-Strategien und Bewältigungsformen
- Stressprävention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erklärt die Motivation der Autorin, sich mit Stress bei Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen, ausgehend von persönlichen Erfahrungen mit psychosomatischen Erkrankungen in der Familie. Die Schwierigkeit, eine eindeutige Definition von Stress zu finden, wird ebenfalls angesprochen.
2. Stress: Dieses Kapitel definiert Stress und beleuchtet dessen Entstehung und Ursachen. Es beschreibt körperliche Symptome, Bewertungs- und Reaktionsmechanismen und stellt drei bedeutende Stressmodelle (Lazarus, Dohrenwend, Selye) vor. Diese Modelle bieten unterschiedliche Perspektiven auf den Stressprozess und seine Auslöser, von der individuellen Wahrnehmung bis hin zu physiologischen Reaktionen des Körpers.
3. Stress bei Kindern und Jugendlichen: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die spezifischen Stressoren im Kindes- und Jugendalter, kategorisiert nach physischen, psychischen, sozialen und chemischen Faktoren. Die Kapitel beschreiben die vielfältigen Auswirkungen von Stress auf Kinder und Jugendliche und unterteilen die Symptomatik in physiologische, kognitive-emotionale und verhaltensbezogene Ebenen. Es wird aufgezeigt, wie stark die Stressoren das Wohlbefinden beeinflussen können.
4. Coping: Das Kapitel behandelt verschiedene Bewältigungsformen (reaktiv, proaktiv, antizipatorisch, präventiv) und -strategien (problemzentriert, emotionszentriert). Es erklärt detailliert, wie Kinder und Jugendliche mit Stresssituationen umgehen können, welche Mechanismen sie einsetzen, und wie soziale Unterstützung eine entscheidende Rolle spielt. Der Fokus liegt auf der aktiven Gestaltung des Umgangs mit Stress.
5. Stressprävention: Hier werden wichtige Aspekte der Stressprävention erläutert, mit einem Fokus auf Ernährung, Schlaf und Hobbys als unterstützende Faktoren für das Wohlbefinden und die Stressresistenz. Es wird betont, wie diese Faktoren zur Vermeidung von Stress beitragen.
Schlüsselwörter
Stress, Stressbewältigung, Kinder, Jugendliche, Stressoren, Stresssymptome, Coping, Bewältigungsstrategien, Stressprävention, psychosomatische Erkrankungen, Fragebogen, Befragung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Stress und Stressbewältigung bei Kindern und Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Stress und Bewältigungsstrategien bei Kindern und Jugendlichen. Sie beleuchtet verschiedene Stressoren, Symptome und Bewältigungsmechanismen und zeigt anhand einer Befragung am MPG St. Rupert Unterschiede und Zusammenhänge auf. Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zu Stress, Stress bei Kindern und Jugendlichen, Coping, Stressprävention und einen praktischen Teil mit der Auswertung eines Fragebogens. Es werden keine Schlussfolgerungen gezogen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Entstehung von Stress, Stressoren im Kindes- und Jugendalter (physisch, psychisch, sozial, chemisch), Stresssymptome und deren Auswirkungen (physiologisch, kognitiv-emotional, verhaltensbezogen), Coping-Strategien (reaktiv, proaktiv, antizipatorisch, präventiv, problemzentriert, emotionszentriert), Stressprävention (Ernährung, Schlaf, Hobbys) und die Auswertung eines Fragebogens zum Thema Stress und Stressbewältigung bei Kindern und Jugendlichen.
Welche Stressmodelle werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt drei bedeutende Stressmodelle vor: Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus, das reizzentrierte Stressmodell nach Dohrenwend und das reaktionszentrierte Stressmodell nach Selye. Diese Modelle bieten unterschiedliche Perspektiven auf den Stressprozess und seine Auslöser.
Wie werden Coping-Strategien definiert und kategorisiert?
Coping-Strategien werden in verschiedene Kategorien eingeteilt: Reaktives, proaktives, antizipatorisches und präventives Coping. Weiterhin wird zwischen problemzentriertem und emotionszentriertem Coping unterschieden. Die Arbeit erläutert detailliert, wie Kinder und Jugendliche mit Stresssituationen umgehen können und welche Rolle soziale Unterstützung spielt.
Was sind die wichtigsten Aspekte der Stressprävention laut dieser Arbeit?
Die Arbeit betont die Bedeutung von Ernährung, Schlaf und Hobbys als unterstützende Faktoren für das Wohlbefinden und die Stressresistenz bei Kindern und Jugendlichen. Diese Faktoren tragen zur Vermeidung von Stress bei.
Wo wurde die empirische Untersuchung durchgeführt?
Die empirische Untersuchung, die die Auswertung eines Fragebogens umfasst, wurde am MPG St. Rupert durchgeführt.
Welche Art von Daten wurden erhoben?
Es wurden Daten mittels eines Fragebogens zum Thema „Stress- und Stressbewältigung bei Kindern und Jugendlichen“ erhoben.
Gibt es Schlussfolgerungen in dieser Arbeit?
Nein, die Arbeit verzichtet auf die Darstellung von Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Stress, Stressbewältigung, Kinder, Jugendliche, Stressoren, Stresssymptome, Coping, Bewältigungsstrategien, Stressprävention, psychosomatische Erkrankungen, Fragebogen, Befragung.
- Quote paper
- Anna-Maria Salchegger (Author), 2016, Stress bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Symptome und Coping-Strategien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/460932