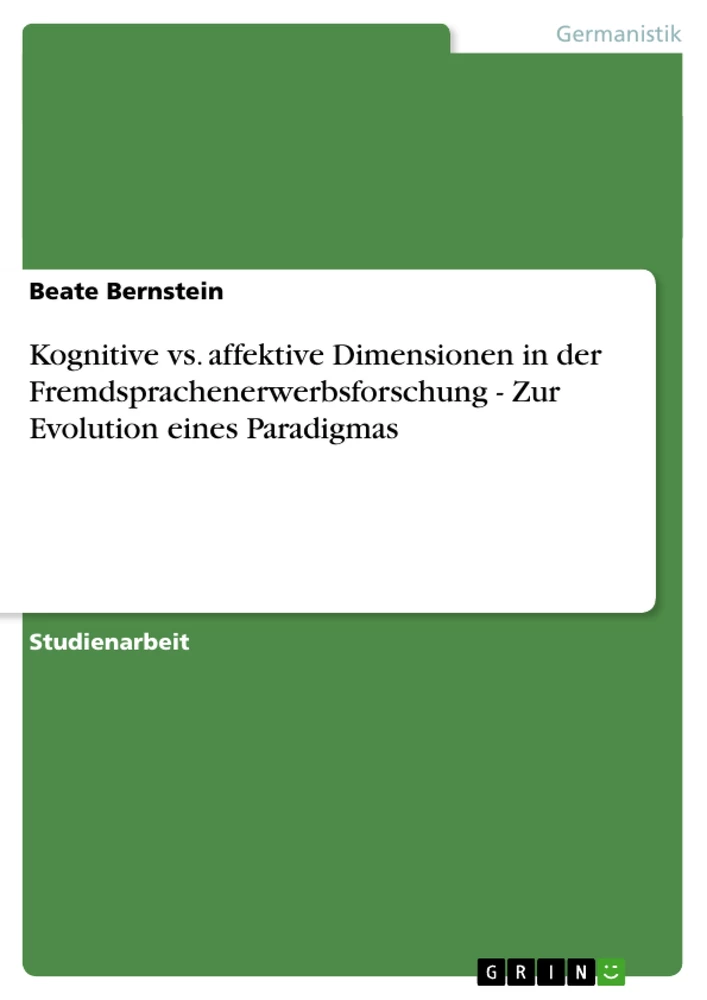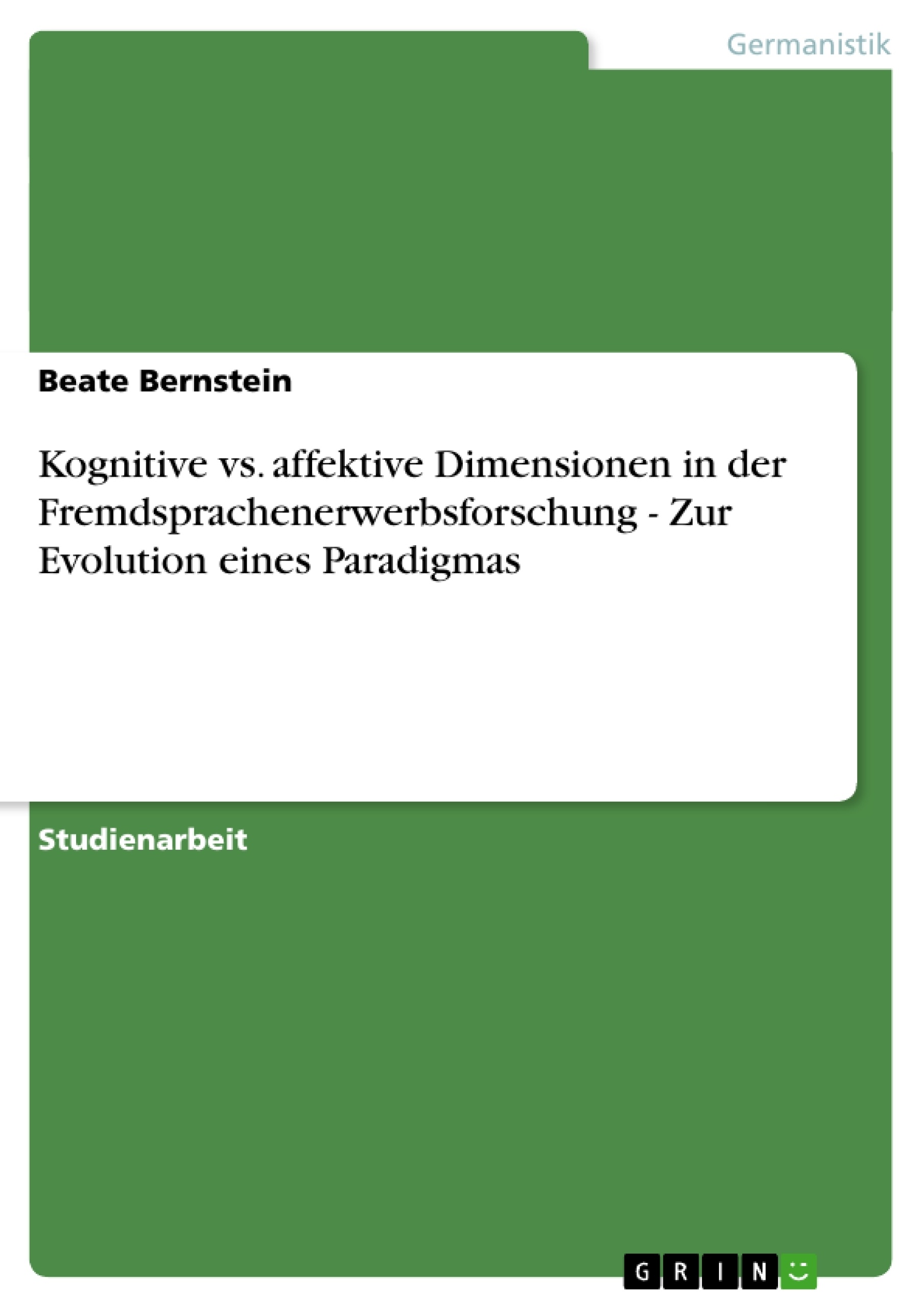„Ist die Erforschung des Fremdsprachenunterrichts hoffnungslos blind, dass sie festhält an einem reduzierten kognitiven Modell des Lernens?“
Schwerdtfeger 1997: 595
Hält die Fremdsprachenunterrichtsforschung tatsächlich daran fest? Und wenn ja - ist das kognitive Paradigma gerechtfertigt oder überholt? Gibt es diese scharfe Trennung zwischen kognitiven und affektiven Dimensionen in der Forschungsgemeinde überhaupt noch oder ist sie längst aufgehoben und wird nur für analytische Kategorien bemüht, um einen fokussierten Blick auf einzelne Aspekte zu ermöglichen? Den Antworten auf diese Fragen will sich die vorliegende Arbeit nähern.
Die Zweitspracherwerbsforschung, vor allem die Fremdsprachenunterrichtforschung, hat in den letzten Jahrzehnten einigen Auftrieb erhalten - und sich in sehr unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt. Zwar war es in auch den Anfängen der Sprachlehrforschung das angesteuerte Ziel, den Fremdsprachenunterricht zu verbessern, das Forschungsinteresse richtete sich aber vorwiegend auf den Lehrer und das Lehren (Königs 2004). Diese teaching perspective wurde seit den 40er Jahren letzten Jahrhunderts ergänzt durch Forschungsarbeiten aus der learning perspective, die die Erwerbsperspektive und den Lernenden in den Vordergrund stellen. Der Einbezug der Psycholinguistik in die Fremdsprachenforschung eröffnete ab den 60er Jahren völlig neue Fenster und Herangehensweisen, durch welche die Sprachlehrforschung einen erheblichen Schritt nach vorne gebracht wurde (Königs 2004).
Die vorliegende Arbeit wird sich nicht in erster Linie mit den unterschiedlichen theoretischen Zugängen, bzw. Hypothesen beschäftigen, sondern mit Einflussfaktoren des Fremdsprachenerwerbs, die mit unterschiedlicher Erklärungsintention in den Theorieansätzen auftauchen. Anhand dieser Einflussfaktoren und deren Positionierung in der Zweitsprachenerwerbsforschung soll die Frage geklärt werden, ob der Vorwurf Schwerdtfegers gerechtfertigt ist, also an einem kognitiven Paradigma festgehalten wird. Die „großen“ Hypothesen werden dennoch vorgestellt werden, um zu sehen, inwieweit sie beide Dimensionen berücksichtigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffliche Abgrenzung und Untersuchungsgegenstand
- 3. Die theoretischen Zugänge und ihre Unzulänglichkeiten
- 3.1. Die Kontrastivhypothese
- 3.2. Die Identitätshypothese
- 3.3. Die Interlanguage-Hypothese
- 4. Einflussfaktoren auf das Lernen fremder Sprachen
- 4.1. Kognitive Faktoren
- 4.2. Affektive Faktoren
- 5. Kognition oder Affekt? Kognition und Affekt!
- 6. Auswirkungen auf den Fremdsprachenunterricht - ein Ausblick
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gewichtung kognitiver und affektiver Faktoren in der Fremdsprachenlernforschung und hinterfragt die Annahme eines rein kognitiven Paradigmas. Sie analysiert, inwieweit der Vorwurf einer zu starken Fokussierung auf kognitive Aspekte gerechtfertigt ist und ob eine Trennung von Kognition und Affekt für die Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts sinnvoll ist.
- Analyse des kognitiven Paradigmas in der Fremdsprachenlernforschung
- Bewertung des Einflusses kognitiver und affektiver Faktoren auf den Fremdsprachenerwerb
- Untersuchung der „großen“ Hypothesen im Fremdsprachenerwerb (Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Interlanguage-Hypothese)
- Diskussion der Relevanz von Lernstrategien und individuellen Unterschieden
- Ausblick auf Implikationen für den Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gewichtung kognitiver und affektiver Faktoren im Fremdsprachenerwerb. Sie kontextualisiert die Arbeit innerhalb der Zweitspracherwerbsforschung, verweist auf die Entwicklung der Forschungsperspektiven (teaching vs. learning perspective) und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Arbeit zielt darauf ab, den Vorwurf einer einseitigen kognitiven Fokussierung in der Forschung zu überprüfen und die Bedeutung affektiver Faktoren zu beleuchten.
2. Begriffliche Abgrenzung und Untersuchungsgegenstand: Dieses Kapitel klärt die Begrifflichkeiten. Es setzt den Fremdsprachenerwerb in den Kontext der endogenen (Chomsky) und exogenen Erklärungsmodelle. Der Fokus liegt auf der Klärung der Bedeutung des "kognitiven Paradigmas" und der Auseinandersetzung mit den drei Ebenen des kognitiven Systems (biologische, psychologische, soziologische). Der Abschnitt betont die Notwendigkeit, kognitiven und affektiven Aspekten gleichermaßen gerecht zu werden, um den Fremdsprachenerwerb umfassend zu verstehen.
4. Einflussfaktoren auf das Lernen fremder Sprachen: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Einflussfaktoren auf den Fremdsprachenerwerb, indem es diese in kognitive und affektive Faktoren unterteilt. Im Bereich der kognitiven Faktoren werden unter anderem Sprachlerneignung, Feldabhängigkeit/-unabhängigkeit, Ambiguitätstoleranz und Risikobereitschaft beleuchtet. Die affektiven Faktoren umfassen Angst, Einstellung und Motivation. Der Abschnitt analysiert wie diese Faktoren in verschiedenen Theorien positioniert werden und wie sie den Lernerfolg beeinflussen können. Die Bedeutung von individuellen Unterschieden im Lernprozess wird hervorgehoben.
5. Kognition oder Affekt? Kognition und Affekt!: Dieses Kapitel diskutiert die relative Bedeutung von kognitiven und affektiven Faktoren. Es untersucht, ob ein rein kognitives Paradigma gerechtfertigt ist oder ob affektive Faktoren eine bedeutendere Rolle spielen. Es wird der Versuch unternommen, die beiden Perspektiven zu integrieren und zu zeigen, dass beide für den Fremdsprachenerwerb essentiell sind. Dabei werden auch konstruktivistische Ansätze berücksichtigt.
6. Auswirkungen auf den Fremdsprachenunterricht - ein Ausblick: Dieses Kapitel wagt einen vorsichtigen Ausblick auf die Implikationen der bisherigen Ergebnisse für den Fremdsprachenunterricht. Es wird untersucht, wie die Erkenntnisse der Forschung in die Praxis umgesetzt werden können, um den Unterricht effektiver und lernförderlicher zu gestalten. Der Fokus liegt auf der Integration der Erkenntnisse über kognitive und affektive Faktoren in Lehr- und Lernmethoden.
Schlüsselwörter
Fremdsprachenerwerb, Zweitsprachenerwerb, kognitives Paradigma, affektive Faktoren, kognitive Faktoren, Lernstrategien, Motivation, Angst, Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Interlanguage-Hypothese, Sprachlerneignung, Feldabhängigkeit, Ambiguitätstoleranz, Fremdsprachenunterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Gewichtung kognitiver und affektiver Faktoren im Fremdsprachenerwerb
Was ist der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Gewichtung kognitiver und affektiver Faktoren in der Fremdsprachenlernforschung und hinterfragt die Annahme eines rein kognitiven Paradigmas. Sie analysiert, inwieweit der Vorwurf einer zu starken Fokussierung auf kognitive Aspekte gerechtfertigt ist und ob eine Trennung von Kognition und Affekt für die Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts sinnvoll ist.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Analyse des kognitiven Paradigmas in der Fremdsprachenlernforschung, die Bewertung des Einflusses kognitiver und affektiver Faktoren auf den Fremdsprachenerwerb, die Untersuchung der „großen“ Hypothesen im Fremdsprachenerwerb (Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Interlanguage-Hypothese), die Diskussion der Relevanz von Lernstrategien und individuellen Unterschieden sowie ein Ausblick auf Implikationen für den Fremdsprachenunterricht.
Welche Hypothesen zum Fremdsprachenerwerb werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Kontrastivhypothese, die Identitätshypothese und die Interlanguage-Hypothese und bewertet deren Relevanz im Kontext der Berücksichtigung kognitiver und affektiver Faktoren.
Wie werden kognitive und affektive Faktoren definiert und unterschieden?
Kognitive Faktoren umfassen Aspekte wie Sprachlerneignung, Feldabhängigkeit/-unabhängigkeit, Ambiguitätstoleranz und Risikobereitschaft. Affektive Faktoren beinhalten Angst, Einstellung und Motivation. Die Arbeit analysiert, wie diese Faktoren in verschiedenen Theorien positioniert werden und wie sie den Lernerfolg beeinflussen.
Ist ein rein kognitives Paradigma im Fremdsprachenerwerb gerechtfertigt?
Die Arbeit hinterfragt die Gültigkeit eines rein kognitiven Paradigmas und argumentiert für eine Integration kognitiver und affektiver Perspektiven, um den Fremdsprachenerwerb umfassend zu verstehen. Sie zeigt, dass beide Faktoren essentiell sind.
Welche Auswirkungen haben die Forschungsergebnisse auf den Fremdsprachenunterricht?
Die Arbeit gibt einen Ausblick auf die Implikationen der Ergebnisse für den Fremdsprachenunterricht und untersucht, wie die Erkenntnisse der Forschung in die Praxis umgesetzt werden können, um den Unterricht effektiver und lernförderlicher zu gestalten. Der Fokus liegt auf der Integration der Erkenntnisse über kognitive und affektive Faktoren in Lehr- und Lernmethoden.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Fremdsprachenerwerb, Zweitsprachenerwerb, kognitives Paradigma, affektive Faktoren, kognitive Faktoren, Lernstrategien, Motivation, Angst, Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Interlanguage-Hypothese, Sprachlerneignung, Feldabhängigkeit, Ambiguitätstoleranz und Fremdsprachenunterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung (Forschungsfrage, Kontextualisierung), Begriffliche Abgrenzung und Untersuchungsgegenstand (Definitionen, Erklärungsmodelle), Einflussfaktoren auf das Lernen fremder Sprachen (kognitive und affektive Faktoren), Kognition oder Affekt? Kognition und Affekt! (Integration beider Perspektiven), Auswirkungen auf den Fremdsprachenunterricht - ein Ausblick (Implikationen für die Praxis) und Fazit.
- Quote paper
- Beate Bernstein (Author), 2004, Kognitive vs. affektive Dimensionen in der Fremdsprachenerwerbsforschung - Zur Evolution eines Paradigmas, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/46040