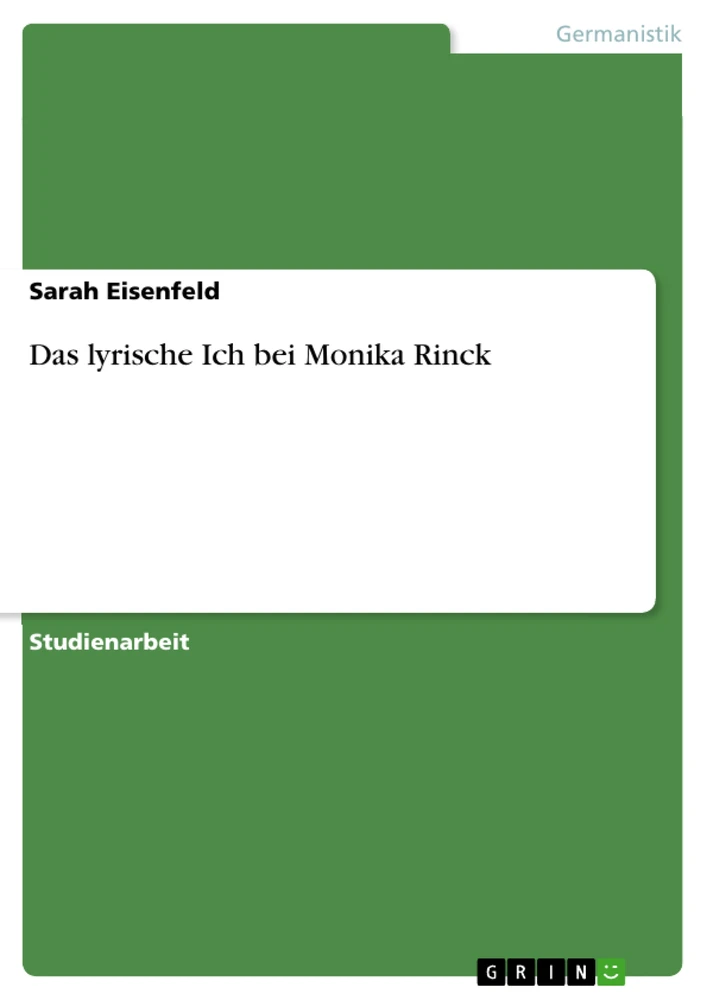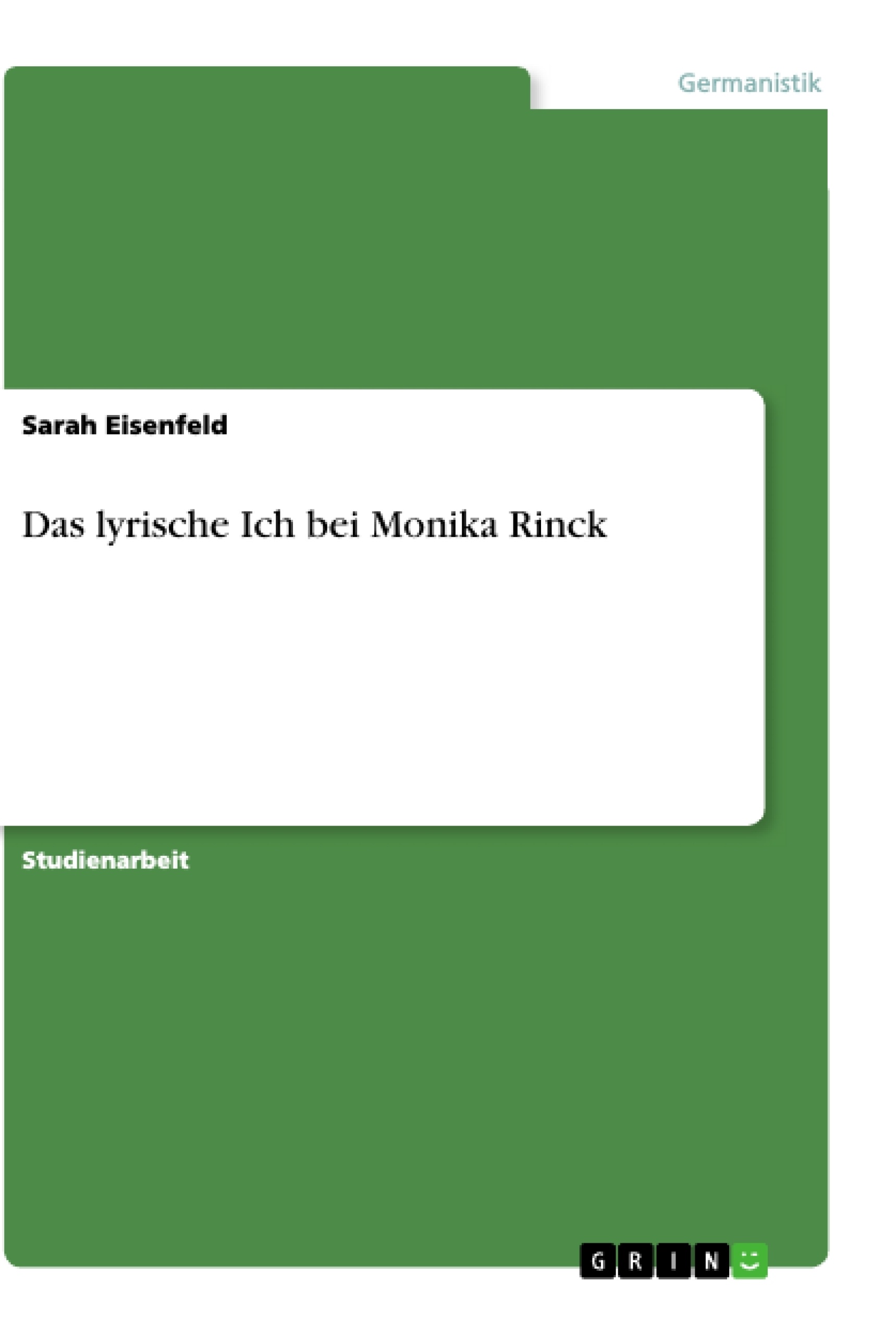Das lyrische Ich als Instanz subjektiver Aussprache ist eines der zentralen Felder der Lyrik und ist seit dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts Mittelpunkt zahlreicher Debatten in der Lyrikforschung. Kern dieser Debatten bilden meist Fragen wie: „Wer spricht in einem Gedicht? Welchen Status haben Stimmen, die in Gedichten vorkommen? Sind Autorsubjekt und lyrisches Ich strikt zu trennen oder kann das Ich mit dem Autor identifiziert werden?”. Somit wirft das lyrische Ich Fragen zu grundsätzlichen Problemen der Lyrik als Gattung auf. In vielen Fällen identifiziert man das lyrische Ich an der Ichform, also dem Personalpronomen in der ersten Person Singular, doch können auch andere Pronomen auf Sprechinstanzen hinweisen.
Die deutsche Dichterin Monika Rinck reflektiert und spielt sehr bewusst mit den unterschiedlichen Pronomen, ihren Bedeutungen und provoziert mit der gezielten Verwendung der unterschiedlichen Erscheinungsformen des lyrischen Ichs. Als eine der theorieversiertesten Lyrikerinnen der Gegenwart schreibt sie Gedichte, Prosa und Essays, in denen sie oftmals Sprachkritik und bewusste Provokation konventioneller Sprachnormen zum Durchbrechen alter Denkmuster nutzt. Rincks Gedichte zeichnen sich vor allem durch ihre vielstimmige Art und Weise aus. Diese Stimmenvielfalt erschafft Rinck durch den Gebrauch von Pronomen, welche oftmals als Spiegel von Persona fungieren. Rincks besonderer Umgang mit dem lyrischen Ich, mit besonderem Augenmerk auf die Verwendung von Personalpronomen ist deshalb Untersuchungsobjekt dieser Arbeit.
Zunächst wird die Historie des Begriffs des lyrischen Ich dargestellt: Die teils widersprüchlichen Theorien der Forschung werden begründet eingeordnet um eine sachangemessene und präzise Abbildung des breiten Forschungsspektrums des lyrischen Ich zu gewährleisten. Im Anschluss werden die neueren theoretischen Überlegungen zum Begriff und seiner Verwendung kurz beleuchtet. Schließlich wird auf dieser theoretischen Basis und mit Hilfe linguistischer und literaturtheoretischer Überlegungen das lyrische Ich bei Monika Rinck analysiert. Ein Vergleich zweier Gedichte der Autorin schließt diese Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DAS LYRISCHE ICH
- 2.1 DIE JAHRHUNDERTWENDE ALS GEBURTSSTUNDE DES LYRISCHEN ICHS
- 2.2 NEUERE THEORETISCHE ANSÄTZE
- 3. MONIKA RINCKS POETIK
- 3.1 DAS ICH UND DIE ANDEREN BEI MONIKA RINCK
- 4. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang der deutschen Lyrikerin Monika Rinck mit dem lyrischen Ich, insbesondere die Verwendung von Personalpronomen in ihren Gedichten. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Rincks Poetik im Kontext der Geschichte und Theorie des lyrischen Ichs zu analysieren und deren Bedeutung für ihr Werk herauszuarbeiten.
- Historische Entwicklung des Begriffs "lyrisches Ich"
- Neuere theoretische Ansätze zur Definition und Verwendung des lyrischen Ichs
- Analyse von Monika Rincks Umgang mit dem lyrischen Ich und verschiedenen Pronomen
- Die Rolle der Vielstimmigkeit in Rincks Lyrik
- Der Einfluss von Sprachkritik und Provokation auf Rincks Poetik
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung führt in die Thematik des lyrischen Ichs in der Lyrik ein und stellt die zentrale Frage nach der Beziehung zwischen Autorsubjekt und lyrischer Stimme. Sie beschreibt Monika Rincks Werk und ihren innovativen Umgang mit dem lyrischen Ich als Untersuchungsgegenstand. Die Arbeit kündigt eine historische und theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff des lyrischen Ichs an, gefolgt von einer Analyse von Rincks Poetik.
2. DAS LYRISCHE ICH: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs "lyrisches Ich", beginnend mit der Jahrhundertwende und der Abkehr von einer rein biographischen Interpretation lyrischer Texte. Es werden die verschiedenen, teilweise widersprüchlichen, theoretischen Ansätze zur Definition und Verwendung des lyrischen Ichs in der Literaturwissenschaft dargestellt, um ein umfassendes Verständnis des Forschungsgegenstands zu schaffen. Die Entwicklung des Begriffs wird von der traditionellen Vorstellung eines direkten Ausdrucks des dichterischen Selbst bis hin zu komplexeren, vielstimmigen Konzeptionen nachgezeichnet.
3. MONIKA RINCKS POETIK: Dieses Kapitel analysiert den spezifischen Umgang Monika Rincks mit dem lyrischen Ich. Es untersucht, wie Rinck durch den Einsatz verschiedener Pronomen und die bewusste Schaffung einer Vielstimmigkeit in ihren Gedichten spielt und reflektiert. Der Fokus liegt auf der Analyse ihrer Sprachverwendung, ihrer Sprachkritik, und wie sie konventionelle Sprachnormen bricht, um neue Denkweisen zu provozieren. Die Vielstimmigkeit in ihren Gedichten wird als zentrales Merkmal ihrer Poetik herausgestellt, welche durch den Gebrauch von Pronomen als Spiegel von Persona geschaffen wird.
Schlüsselwörter
Lyrisches Ich, Monika Rinck, Personalpronomen, Sprachkritik, Vielstimmigkeit, Moderne Lyrik, Poetik, Literaturwissenschaft, Sprachspiel, Pronomen, Persona.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Lyrischen Ichs bei Monika Rinck
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Umgang der deutschen Lyrikerin Monika Rinck mit dem lyrischen Ich, insbesondere die Verwendung von Personalpronomen in ihren Gedichten. Sie untersucht Rincks Poetik im Kontext der Geschichte und Theorie des lyrischen Ichs und deren Bedeutung für ihr Werk.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Begriffs "lyrisches Ich", neuere theoretische Ansätze zur Definition und Verwendung des lyrischen Ichs, die Analyse von Monika Rincks Umgang mit dem lyrischen Ich und verschiedenen Pronomen, die Rolle der Vielstimmigkeit in Rincks Lyrik und den Einfluss von Sprachkritik und Provokation auf Rincks Poetik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Geschichte und Theorie des lyrischen Ichs, ein Kapitel zur Poetik Monika Rincks und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des lyrischen Ichs und verschiedene theoretische Ansätze. Das dritte Kapitel analysiert Rincks spezifischen Umgang mit dem lyrischen Ich, ihre Sprachverwendung, Sprachkritik und die Vielstimmigkeit in ihren Gedichten. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Lyrisches Ich, Monika Rinck, Personalpronomen, Sprachkritik, Vielstimmigkeit, Moderne Lyrik, Poetik, Literaturwissenschaft, Sprachspiel, Pronomen, Persona.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, Rincks Poetik im Kontext der Geschichte und Theorie des lyrischen Ichs zu analysieren und deren Bedeutung für ihr Werk herauszuarbeiten. Es geht darum, zu verstehen, wie Rinck das lyrische Ich in ihren Gedichten verwendet und welche Rolle dies für ihre künstlerische Gestaltung spielt.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Analysemethode. Sie untersucht die Texte von Monika Rinck im Detail, insbesondere die Verwendung von Personalpronomen und die sprachlichen Mittel, die Rinck einsetzt, um das lyrische Ich zu gestalten. Die Analyse bezieht sich auf historische und theoretische Kontexte.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik und Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes (Monika Rinck und ihr Umgang mit dem lyrischen Ich).
Kapitel 2 (Das Lyrische Ich): Historische Entwicklung und theoretische Ansätze zum Begriff des lyrischen Ichs.
Kapitel 3 (Monika Rincks Poetik): Analyse von Rincks spezifischem Umgang mit dem lyrischen Ich, ihrer Sprachverwendung, Sprachkritik und der Vielstimmigkeit in ihren Gedichten.
Kapitel 4 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
- Quote paper
- Sarah Eisenfeld (Author), 2018, Das lyrische Ich bei Monika Rinck, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/459665