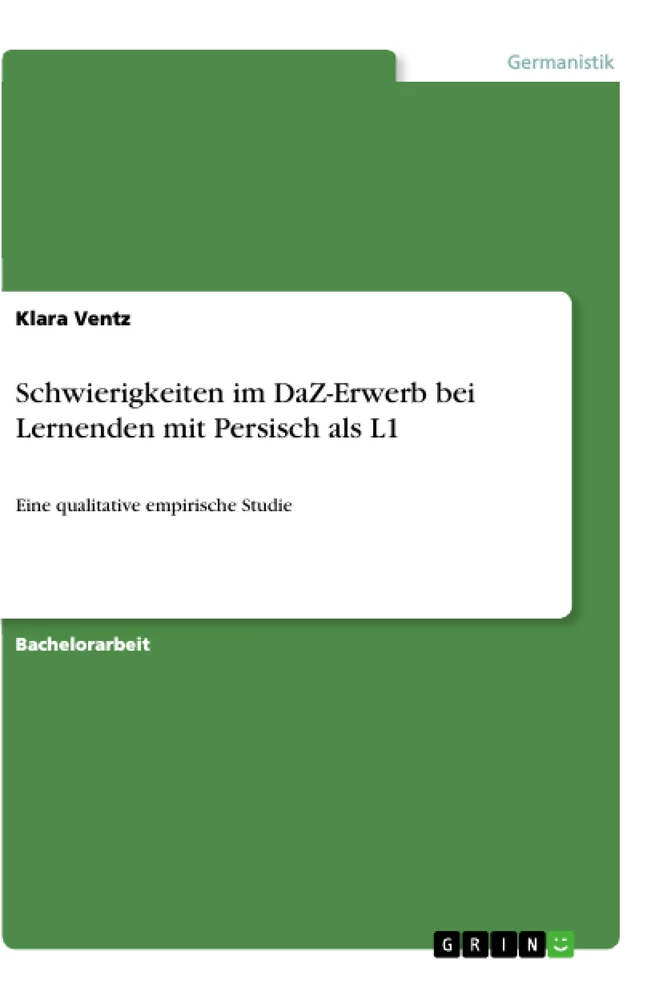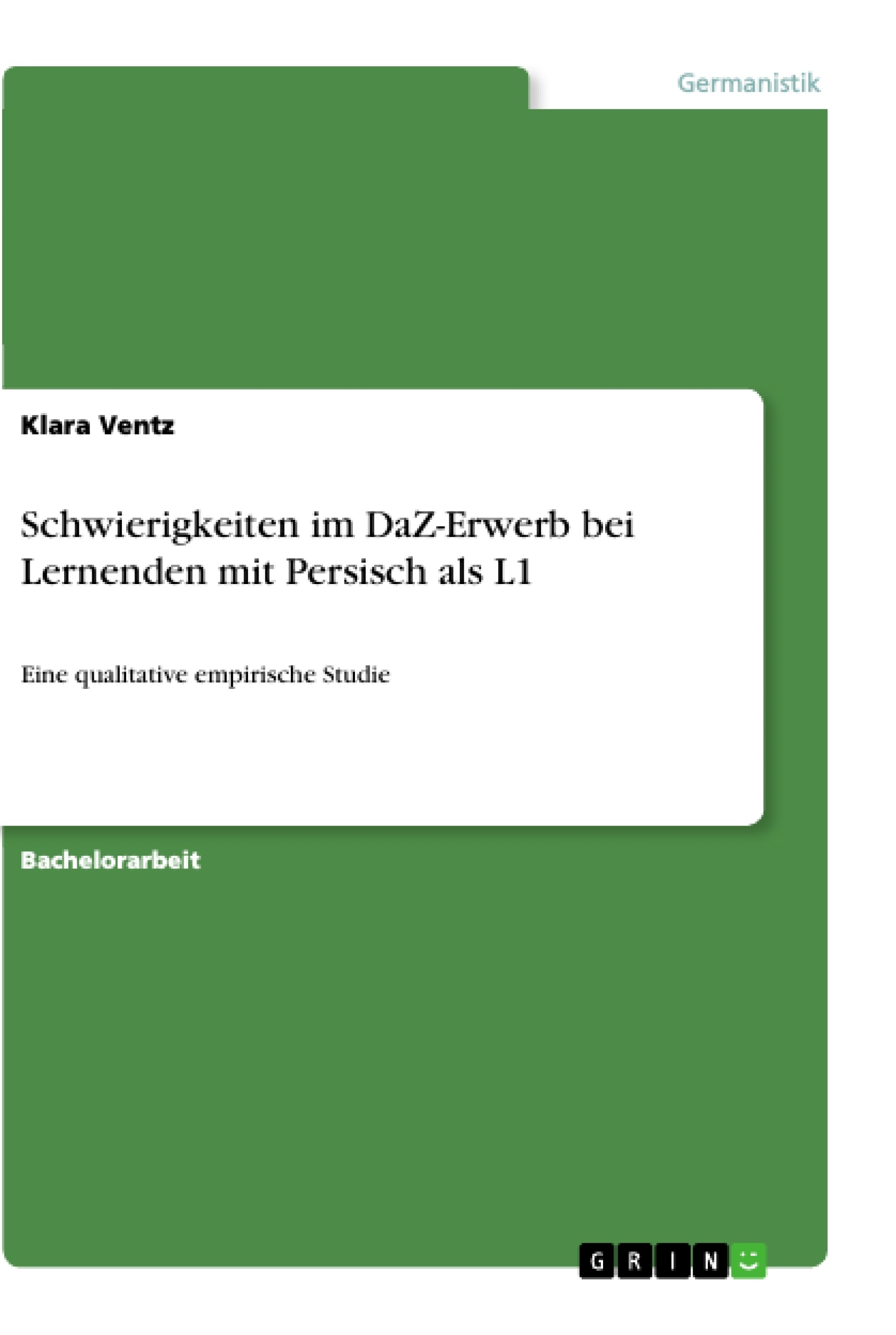Aufgeteilt ist die Arbeit in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Zunächst werden die Historie des Persischen und die geographische Verteilung der Sprecher und Varietäten vorgestellt. Danach werden spezifische Unterschiede zwischen dem Persischen und dem Deutschen innerhalb des Alphabets, der Morphologie und der Syntax aufgezeigt. Die morphologischen und syntaktischen Phänomene werden in drei Kategorien eingeteilt.
In der ersten Kategorie werden Phänomene untersucht, in denen der Lernende auf eine Leerstelle in seiner persischen Ausgangssprache trifft. Die zweite Kategorie umfasst Phänomene, bei denen der Lernende im Deutschen auf wesentlich komplexere Strukturen als im Persischen trifft, die Funktion des Phänomens jedoch bereits aus dem Persischen kennt. Die dritte Kategorie umfasst persische Phänomene, bei denen Lernende im Deut- schen auf eine Leerstelle treffen. Anschließend werden zu erwartenden Fehler für DaZ- Lernende erläutert und mit den Ergebnissen des Sprachvergleichs begründet. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die eigens erstellten Testverfahren und die Probanden vorgestellt.
In der Reflexion der Empirie werden die aufgestellten Fehlerhypothesen mit der empirischen Ergebnisauswertung überprüft. Im Schlussteil wird nach der Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit auf die Problematik bei der Ergebnisauswertung gesondert eingegangen. Das Fazit dient der Einord- nung der Ergebnisse in den pädagogischen Kontext. Hier soll beleuchtet werden, inwieweit die vorliegenden Ergebnisse über die Schwierigkeiten beim DaZ-Erwerb für Lernende mit Persisch als L1 im Unterricht genutzt werden können. Im abschließenden Ausblick wird aufgezeigt, welche Bereiche, die in der Problematik bereits erläutert wurden, als Grundlage weiterer Arbeiten dienen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau
- 2 Grundlagen des Persischen
- 2.1 Überblick
- 2.1.1 Historisch
- 2.1.2 Geographisch
- 2.3 Sprachliche Strukturen des Persischen
- 2.3.1 Alphabet und Schrift
- 2.3.2 Morphologie
- 2.3.3 Syntax
- 3 Empirische Befunde
- 3.1 Testaufbau
- 3.2 Ergebnisse und Auswertung
- 3.2.1 Morphologie
- 3.2.2 Syntax
- 3.3 Reflexion
- 4 Schluss
- 4.1 Zusammenfassung
- 4.2 Problematik
- 4.3 Fazit
- 4.4 Ausblick
- 5 Quellenverzeichnis
- 6 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Schwierigkeiten beim Erwerb von Deutsch als Zweitsprache (DaZ) bei Lernenden mit Persisch als Muttersprache (L1). Die Arbeit hat zum Ziel, spezifische Fehlermuster aufgrund der persischen Ausgangssprache aufzuzeigen und die größten Herausforderungen im DaZ-Erwerb zu identifizieren. Dabei wird der Einfluss von Transferphänomenen, aber auch von grundlegenden sprachlichen Unterschieden zwischen Persisch und Deutsch beleuchtet.
- Analyse spezifischer Fehlermuster im DaZ-Erwerb bei Persisch-Sprecher.
- Untersuchung des Einflusses der persischen Sprachstruktur auf den DaZ-Erwerb.
- Bewertung der Rolle von Transferphänomenen im Kontext der Interferenztheorie.
- Identifizierung der größten Schwierigkeiten beim Erwerb der deutschen Morphologie und Syntax.
- Diskussion der Bedeutung der Ergebnisse für die DaZ-Didaktik.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel legt die Motivation der Arbeit dar, die durch das steigende Interesse an der persischen Sprache in Deutschland aufgrund der Zuwanderung aus dem Iran und Afghanistan begründet wird. Es wird die Zielsetzung formuliert, die darin besteht, die spezifischen Schwierigkeiten im DaZ-Erwerb bei Persisch-Sprecher aufzuzeigen. Schließlich wird der Aufbau der Arbeit skizziert.
2 Grundlagen des Persischen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die persische Sprache, einschließlich ihrer historischen und geographischen Aspekte. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der sprachlichen Strukturen des Persischen, insbesondere des Alphabets, der Morphologie und der Syntax. Diese Beschreibung dient als Grundlage für den Vergleich mit der deutschen Sprache und die Analyse der Transferphänomene im späteren Kapitel.
3 Empirische Befunde: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zu den Schwierigkeiten im DaZ-Erwerb bei Lernenden mit Persisch als L1. Es beschreibt den Aufbau des verwendeten Testverfahrens und analysiert die Ergebnisse im Hinblick auf morphologische und syntaktische Fehler. Die Reflexion der Ergebnisse und ihrer Implikationen für die DaZ-Didaktik wird ausführlich behandelt.
Schlüsselwörter
Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Persisch als L1, Transferphänomene, Interferenztheorie, Morphologie, Syntax, Sprachvergleich, DaZ-Didaktik, Fehleranalyse, Spracherwerbsschwierigkeiten, Migranten, Indoeuropäische Sprachen.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Schwierigkeiten beim DaZ-Erwerb bei Persisch-Sprecher
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Herausforderungen beim Erlernen des Deutschen als Zweitsprache (DaZ) für Personen, deren Muttersprache Persisch ist. Sie konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Fehlermuster, die auf die persische Ausgangssprache zurückzuführen sind, und analysiert die größten Schwierigkeiten im DaZ-Erwerbsprozess.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, spezifische Fehlermuster im DaZ-Erwerb bei Persisch-Sprecher aufzuzeigen und den Einfluss der persischen Sprachstruktur auf den DaZ-Erwerb zu untersuchen. Weiterhin werden die Rolle von Transferphänomenen im Kontext der Interferenztheorie bewertet und die größten Schwierigkeiten beim Erwerb der deutschen Morphologie und Syntax identifiziert. Die Bedeutung der Ergebnisse für die DaZ-Didaktik wird ebenfalls diskutiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Analyse spezifischer Fehlermuster im DaZ-Erwerb bei Persisch-Sprecher; Untersuchung des Einflusses der persischen Sprachstruktur; Bewertung der Rolle von Transferphänomenen; Identifizierung der größten Schwierigkeiten im Erwerb der deutschen Morphologie und Syntax; Diskussion der Bedeutung der Ergebnisse für die DaZ-Didaktik.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Motivation, Zielsetzung, Aufbau); Grundlagen des Persischen (Überblick, historisch, geographisch, sprachliche Strukturen – Alphabet, Morphologie, Syntax); Empirische Befunde (Testaufbau, Ergebnisse und Auswertung – Morphologie, Syntax, Reflexion); Schluss (Zusammenfassung, Problematik, Fazit, Ausblick); Quellenverzeichnis und Anhang.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung, die spezifische Fehlermuster im DaZ-Erwerb bei Persisch-Sprecher analysiert. Das Kapitel "Empirische Befunde" beschreibt detailliert den Aufbau des verwendeten Testverfahrens und die Auswertung der Ergebnisse im Hinblick auf morphologische und syntaktische Fehler.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Persisch als L1, Transferphänomene, Interferenztheorie, Morphologie, Syntax, Sprachvergleich, DaZ-Didaktik, Fehleranalyse, Spracherwerbsschwierigkeiten, Migranten, Indoeuropäische Sprachen.
Welche Erkenntnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Erkenntnisse über spezifische Fehlermuster im DaZ-Erwerb bei Persisch-Sprecher, den Einfluss der persischen Sprachstruktur auf den DaZ-Erwerb und die Rolle von Transferphänomenen. Die Ergebnisse liefern wichtige Informationen für die DaZ-Didaktik und den Sprachunterricht für Persisch-Sprecher.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für DaZ-Lehrende, Sprachwissenschaftler, Studierende der Sprachwissenschaft und Didaktik sowie alle, die sich für den Spracherwerb und die Herausforderungen im Kontext der Mehrsprachigkeit interessieren. Sie bietet wertvolle Einblicke in die spezifischen Schwierigkeiten beim Erlernen des Deutschen durch Persisch-Sprecher.
- Quote paper
- Klara Ventz (Author), 2017, Schwierigkeiten im DaZ-Erwerb bei Lernenden mit Persisch als L1, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/458719