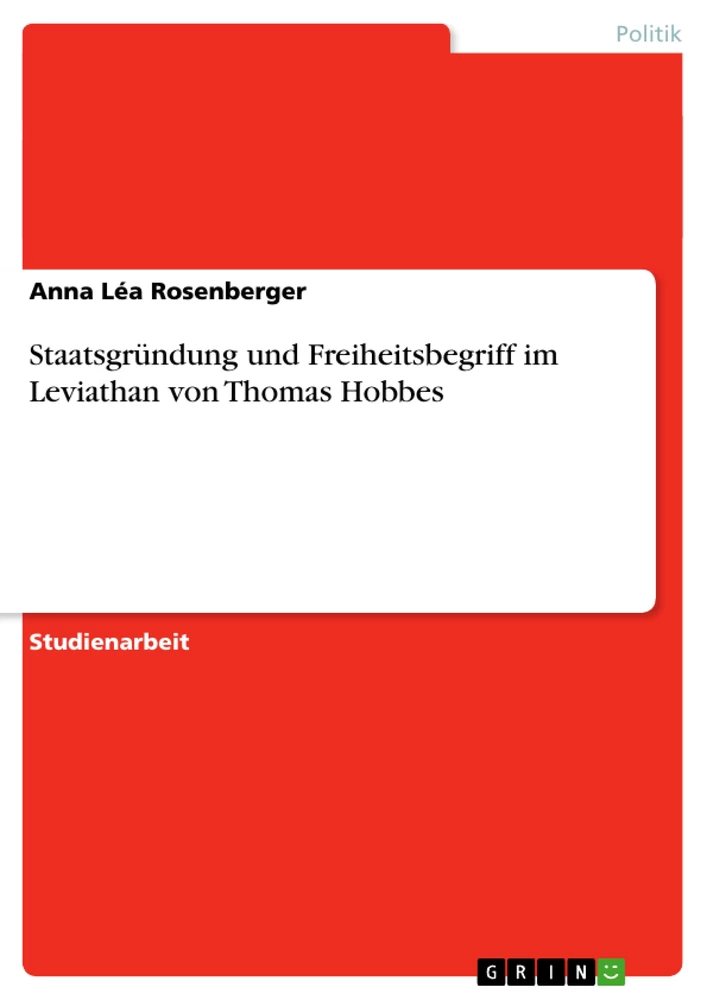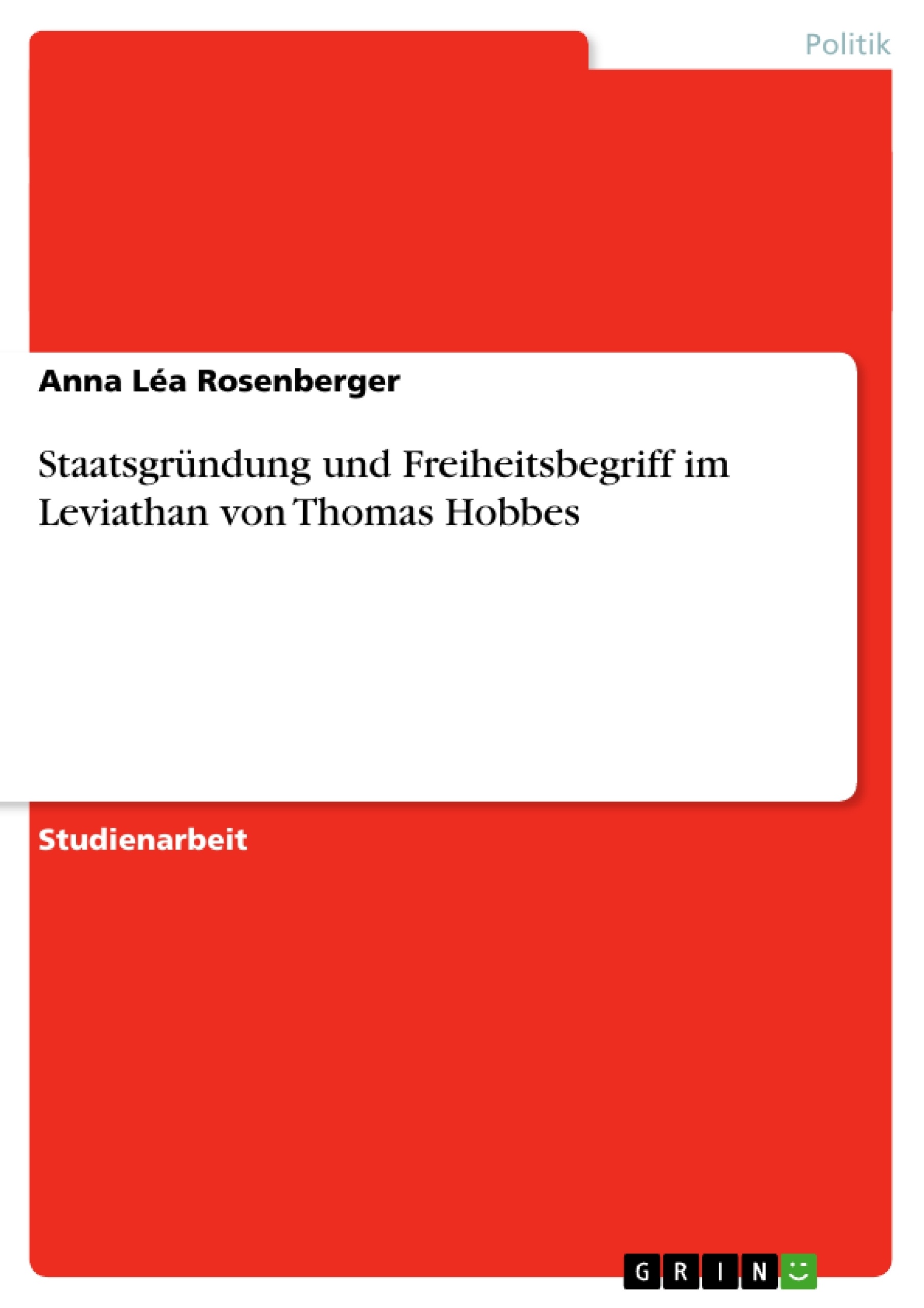Thomas Hobbes gilt als einer der Weichensteller für das neuzeitliche Denken der politischen Philosophie, in welchem ein grundlegender Perspektivenwechsel stattfindet: „War das mittelalterliche Denken charakterisiert durch die Orientierung an einer vorgegebenen Seinsordnung, die letztlich in Gott verbürgt ist, und das Sich-Einlassen auf diese Ordnung, so wird neuzeitlich gerade der Zweifel an jeder Ordnung zum Leitfaden der Gewissheit.“ Nun steht der Mensch als Schöpfer seiner selbst im Mittelpunkt der Betrachtung, er selbst legt seine Stellung in der Welt fest und bestimmt folglich auch die Form des menschlichen Zusammenlebens. Die wesentliche Frage, auf die Hobbes in seinen Werken eine Antwort zu geben versucht, lautet daher, wie ein Staat unter den Gegebenheiten der menschlichen Natur ausgestaltet sein muss, damit er dauerhaft bestehen und seinen einzelnen Gliedern ein bestmögliches Leben garantieren kann.
Worin jedoch sieht Thomas Hobbes die wesentlichen Merkmale des Menschen? Wie gestaltet sich menschliches Zusammenleben, wenn keine ordnende Hand eingreift und welche Regeln benötigt eine Gemeinschaft, wenn sie ihren Bestand sichern möchte? Und insbesondere: Wieviel Freiheit kann dem einzelnen in einem Hobbesschen Staat zugestanden werden? In der vorliegenden Arbeit werden diese Fragen anhand einer Analyse des im Jahre 1651 erschienenen Werkes „Leviathan“ behandelt, wobei der Untersuchung der dort entwickelten Freiheitskonzeption besonderes Gewicht zukommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Menschenbild im Leviathan
- Hauptteil
- Das Konstrukt des Naturzustands und sein Freiheitskonzept
- Vom Naturzustand zum Staat: der Vertragsschluss
- Die Freiheit der Untertanen im Leviathan-Staat
- Hobbes' Staatstheorie im Lichte der Entwicklung der Menschenrechte
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Thomas Hobbes' Werk „Leviathan“ mit dem Fokus auf die Entwicklung des Freiheitsbegriffs im Kontext seiner Staatstheorie. Sie beleuchtet das Menschenbild, den Naturzustand, den Vertragsschluss und die Freiheit der Untertanen im Leviathan-Staat.
- Das Menschenbild im Leviathan
- Die Konzeption des Naturzustands und die darin verankerte Freiheit
- Der Vertragsschluss als Grundlage für die Staatsgründung
- Die Freiheit der Untertanen im Leviathan-Staat
- Die Relevanz von Hobbes' Staatstheorie für die Entwicklung des Menschenrechtskonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor: Wie sieht Thomas Hobbes' Menschenbild aus, wie funktioniert das menschliche Zusammenleben im Naturzustand und wieviel Freiheit kann im Leviathan-Staat gewährt werden?
Kapitel 2 skizziert das im Leviathan gezeichnete Menschenbild und betont Hobbes' naturwissenschaftsorientierte und kausalistische Sichtweise auf das menschliche Leben.
Kapitel 3.1 analysiert das Konstrukt des Naturzustands und das damit verbundene Freiheitskonzept. Hobbes argumentiert, dass der Naturzustand von Egoismus und Konkurrenz geprägt ist, in dem jeder Einzelne über absolute Freiheit verfügt, jedoch gleichzeitig in ständiger Angst vor Tod und Gewalt lebt.
Kapitel 3.2 untersucht den Vertragsschluss als Mittel zur Überwindung des Naturzustands. Der Leviathan entsteht durch den Vertrag der Individuen, die ihre absolute Freiheit zugunsten von Sicherheit und Ordnung aufgeben.
Kapitel 3.3 beleuchtet die Freiheit der Untertanen im Leviathan-Staat und untersucht die möglichen Veränderungen in Bezug auf die Freiheitsrechte der Menschen. Hobbes argumentiert, dass die Freiheit im Leviathan-Staat begrenzt ist, da die Sicherheit und das Wohlergehen des Staates Vorrang haben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Thomas Hobbes' „Leviathan“, seinem Menschenbild, dem Naturzustand, dem Vertragsschluss, dem Leviathan-Staat, der Freiheit der Untertanen, der Entwicklung der Menschenrechte und der Relevanz von Hobbes' Staatstheorie für das Menschenrechtskonzept.
- Arbeit zitieren
- Anna Léa Rosenberger (Autor:in), 2005, Staatsgründung und Freiheitsbegriff im Leviathan von Thomas Hobbes, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/45870