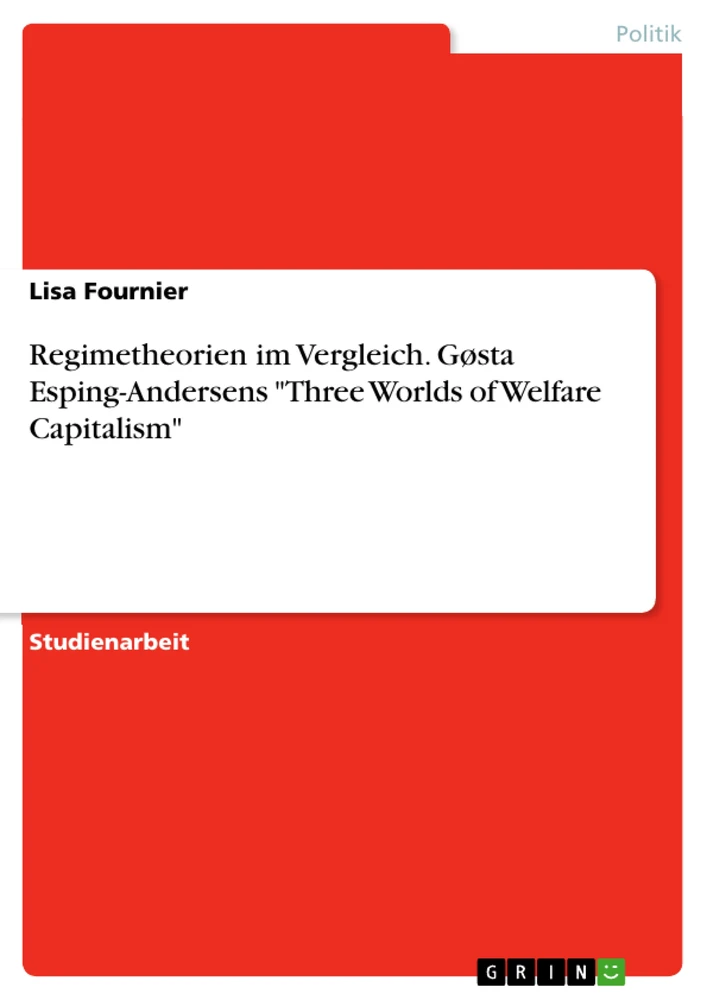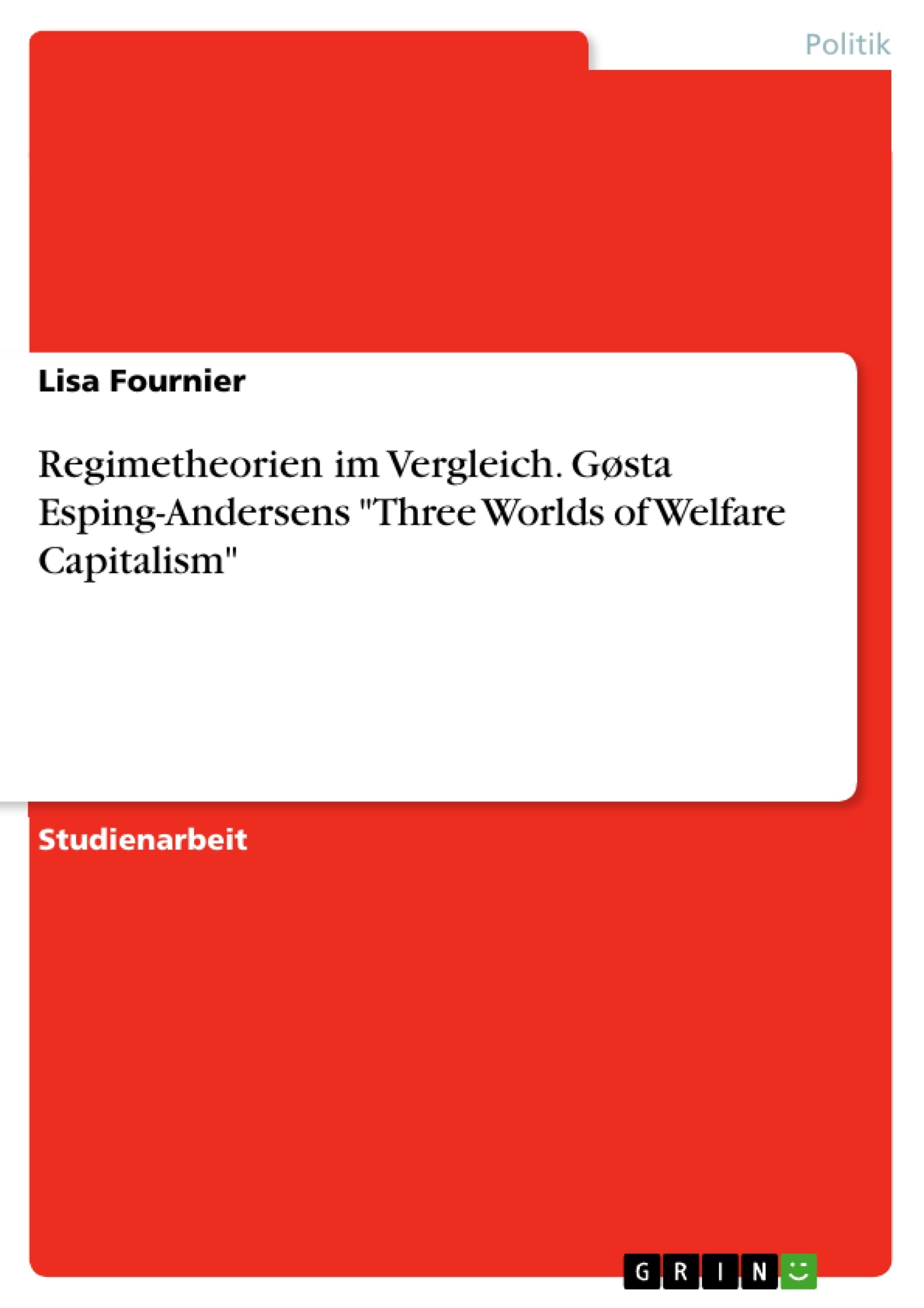„Three worlds of welfare capitalism or more?“. Genau mit dieser Fragestellung befassen sich W. Arts und J. Gelissen in ihrem Artikel aus dem Jahr 2002. Dieser Frage soll in dieser Ausarbeitung anhand ihres Artikels auf den Grund gegangen werden.
Im Fokus ihres Artikels steht der dänische Forscher Gøsta Esping-Andersen und seine Regimetheorie. Diese setzen sie in Vergleich zu unterschiedlichen Autoren, die alle ihre eigene Theorie entwickelt und Vorstellungen darin umgesetzt haben. Anhand dieser verschiedenen Auffassungen und Meinungen wird Esping-Andersens Theorie ebenfalls unter drei Gesichtspunkten kritisiert und es werden Alternativen vorgeschlagen, welche im genauen Vergleich gegenübergestellt und mit Hilfe von Tabellen veranschaulicht werden.
In dieser Ausarbeitung sollen nun die Ansätze des Textes ausgeführt und die wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen werden. Das Ziel ist eine Auseinandersetzung mit wichtigen Autoren und ihren alternativen Vorschlägen und Kritiken zu Esping-Andersens Regimetheorie, wodurch die oben benannte Frage, ob es drei oder mehrere Typisierungen gibt, beantwortet werden soll.
Die Thematik hat insofern Relevanz, dass eine Befassung mit den unterschiedlichen Vorstellungen eines Wohlfahrtsstaats der verschiedenen Länder in Europa nicht nur ein wichtiger Teil unseres Seminars (Arbeitsmärkte und Beschäftigung in Europa) war, sondern auch im Allgemeinen darüber informiert, wie unterschiedlich die Staaten auf globaler Sichtweise diesem Punkt sind. Außerdem gilt seine Arbeit als wichtiger Referenzpunkt für heutige Wohlfahrtsstaat-Forschungen.
Zuerst wird, um in die Thematik einzuleiten, der Begriff „Wohlfahrtstaat“ definiert und Gøsta Esping-Andersen kurz vorgestellt. Danach steigen wir mit seiner Theorie ein, welche detailliert präsentiert und erklärt wird. Die in dem Text erwähnten drei Kritikpunkte werden im Anschluss dargestellt und die unterschiedlich entwickelten Regimetheorien werden an dieser Stelle ebenfalls miteinander vergleichen. Passend dazu wird Esping-Andersens Reaktion auf die Kritik vorgestellt. Am Ende werden die wichtigsten Erkenntnisse anhand von den Gesamteinschätzungen der Autoren des Artikels und anderer Autoren zusammengefasst, um nochmal einen Gesamtüberblick zu schaffen. Im Anhang befinden sich veranschaulichende Bilder und Tabellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines
- Definition eines Wohlfahrtsstaats
- Zur Person Gøsta Esping-Andersen
- Esping-Andersens Regimetheorie
- Drei Kriterien für Respezifierung des Wohlfahrtsstaatskonzepts
- Ideal- und Realtypen
- Kritik & Vergleich
- „The Mediterranean“
- „The Antipodes“
- Gender, familialism and late mobilization
- Betrachtung der Tabellen
- Esping-Andersens Reaktion auf die Kritik
- Endergebnisse
- Diskussionsfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Artikel setzt sich kritisch mit der Regimetheorie von Gøsta Esping-Andersen auseinander und untersucht, ob die von ihm postulierten drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus eine ausreichende Beschreibung der Realität darstellen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Kritikpunkten an Esping-Andersens Modell und der Gegenüberstellung mit alternativen Regimetheorien. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, ob es drei oder mehr Typisierungen von Wohlfahrtsstaaten gibt.
- Kritik an Esping-Andersens drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus
- Analyse von alternativen Regimetheorien
- Vergleich der verschiedenen Typisierungen von Wohlfahrtsstaaten
- Diskussion der empirischen Relevanz der unterschiedlichen Modelle
- Bewertung der Robustheit von Esping-Andersens Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Artikels ein, der sich mit der Arbeit von Gøsta Esping-Andersen und dessen Regimetheorie auseinandersetzt. Der Artikel untersucht, ob es drei oder mehr Typisierungen von Wohlfahrtsstaaten gibt. Es wird die Relevanz der Thematik im Kontext des Seminars "Arbeitsmärkte und Beschäftigung in Europa" hervorgehoben und der Begriff "Wohlfahrtsstaat" definiert.
Kapitel 2 stellt Esping-Andersens drei Kriterien zur Respezifierung des Wohlfahrtsstaatskonzepts vor: Dekommodifizierung, Stratifizierung und die Verknüpfung des Wohlfahrtsstaats mit dem Markt und der Familie. Die drei idealtypischen Regimetypen werden anhand von Beispielen erläutert: der liberale Wohlfahrtsstaat (USA), der konservative Wohlfahrtsstaat (Deutschland) und der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat (Schweden).
Kapitel 4 beleuchtet drei Kritikpunkte an Esping-Andersens Theorie: die mangelnde Einbeziehung der mittelmeerischen Länder, die falsche Zuordnung von Australien und Neuseeland sowie die fehlende Berücksichtigung von Gender-Aspekten und Familienunterstützung. Es werden alternative Regimetheorien vorgestellt, die diese Kritikpunkte berücksichtigen.
Im Abschnitt 4.4 werden die wichtigsten Erkenntnisse aus den Tabellen im Anhang zusammengefasst. Es werden auffällige Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Modellen verschiedener Autoren aufgezeigt, sowie die Zuordnung bestimmter Länder zu den jeweiligen Typen diskutiert.
Kapitel 4.5 präsentiert Esping-Andersens Reaktion auf die Kritik an seiner Theorie. Er zeigt sich offen für einige der Kritikpunkte, hält jedoch an der Grundstruktur seiner drei Typen fest.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in diesem Text sind: Regimetheorie, Wohlfahrtsstaat, Dekommodifizierung, Stratifizierung, liberaler Wohlfahrtsstaat, konservativer Wohlfahrtsstaat, sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat, "The Mediterranean", "The Antipodes", Gender, Familienunterstützung, empirische Relevanz, Robustheit.
- Quote paper
- Lisa Fournier (Author), 2018, Regimetheorien im Vergleich. Gøsta Esping-Andersens "Three Worlds of Welfare Capitalism", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/457845