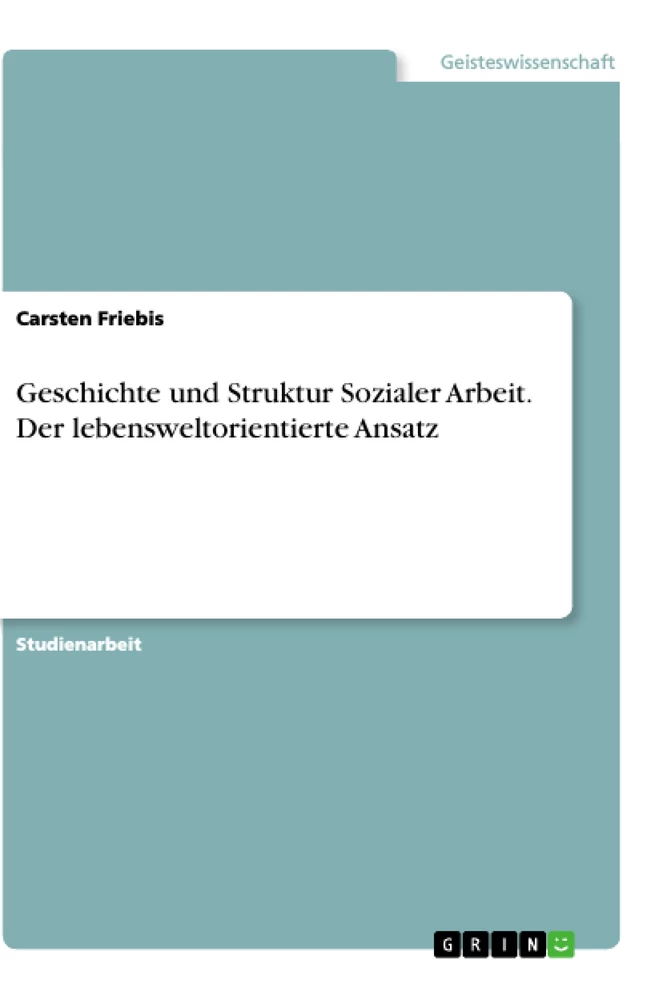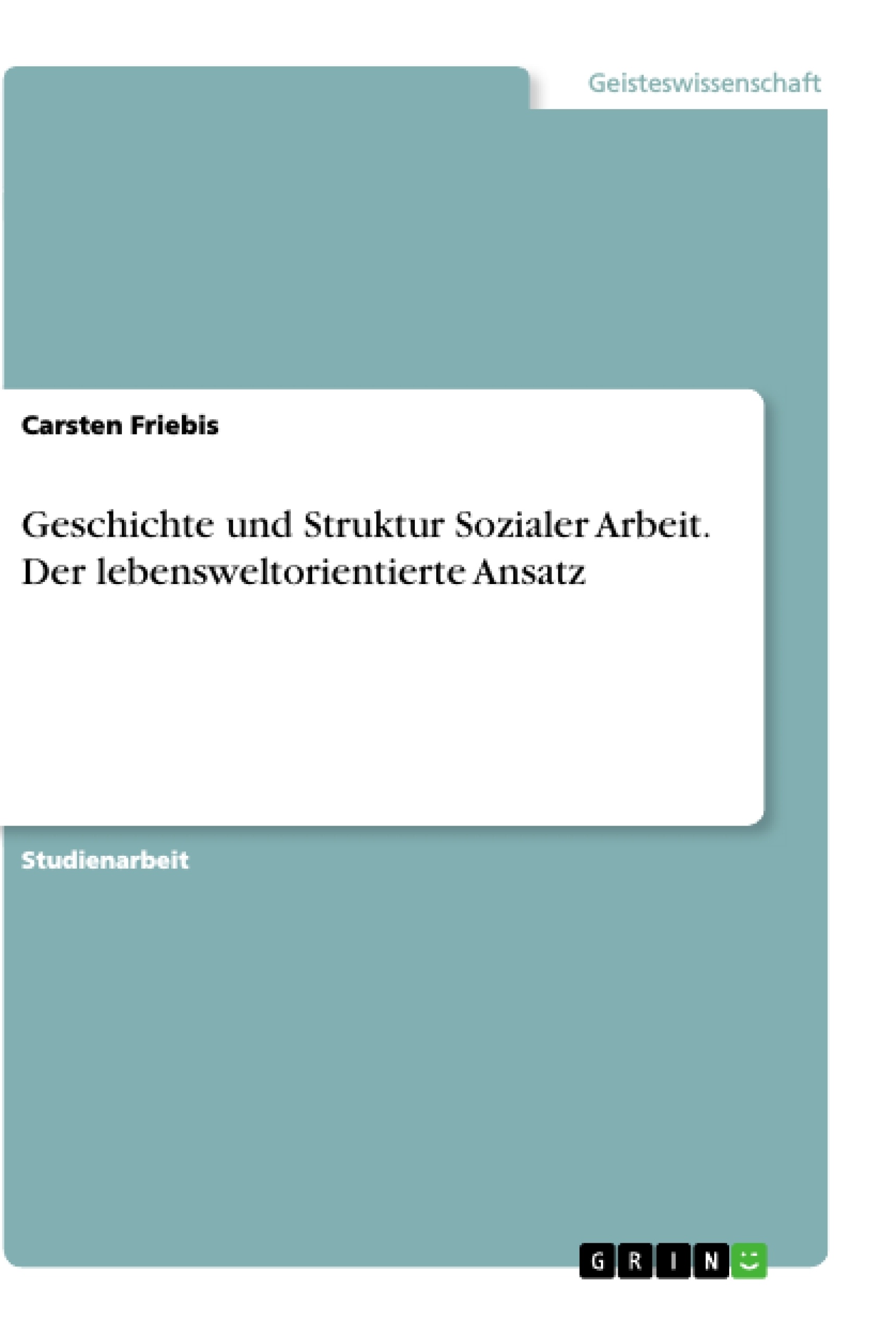Nach dem zweiten Weltkrieg, dem darauf folgendem Wiederaufbau, der verstärkten Institutionalisierung der Sozialen Arbeit und den Vorkommnissen, die auf die so genannte “schwarze Pädagogik” zurückgehen, kam es in den 60er Jahren, ausgelöst u.a. durch den Vietnamkrieg der Amerikaner, zu erneuten Veränderungen in der Gesellschaft. Die Jugend protestierte gegen „... Konsumorientierung, imperialistische Kriege und Ausbeutung der dritten Welt“ (Kuhlmann 2011, S. 43).
Die Soziale Arbeit versuchte zu dieser Zeit „... sich aus dem Schatten ihrer disziplinierenden und stigmatisierenden Tradition zu lösen...“ (Thiersch et al. 2012, S. 179). Es entstanden, geprägt von den Studentenbewegungen, neue soziale Bewegungen, die die einzelnen Handelsfelder der Sozialen Arbeit veränderten.
Die Individualisierung und Pluralisierung der Lebensverhältnisse forderte in den 1980er Jahren eine weitere Ausdifferenzierung der Theorieansätze der Sozialen Arbeit. Neben dem subjektorientierten Ansatz von Michael Winkler und dem systemtheoretischen Ansatz von Silvia Staub-Bernasconi, entwickelte Hans Thiersch den Ansatz der Lebensweltorientierung. Dabei wurde das Ziel verfolgt gerechtere Lebensverhältnisse zu schaffen, Demokratisierung und Emanzipation voranzutreiben und als Basis rechtlich gesicherte, fachlich verantwortbare Arbeit zu nutzen.
Inhaltsverzeichnis
- Die zentralen Begriffe, Bezugspunkte und Prämissen der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- Geschichtlicher Abriss
- Theoretische Wurzeln
- Aspekte der Lebensweltorientierung
- Handlungsmuster
- Kritik
- Struktur- und Handlungsmaximen
- Beschreibung der Strukturmaxime „Prävention“
- Vor- und Nachteile der „Prävention“
- Beschreibung der Strukturmaxime „Integration“
- Vor- und Nachteile der „Integration“
- Die Maxime Prävention in einem Handlungsfeld
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem lebensweltorientierten Ansatz in der Sozialen Arbeit. Er untersucht die historischen Wurzeln, theoretischen Grundlagen und zentralen Aspekte dieses Ansatzes sowie die damit verbundenen Struktur- und Handlungsmaximen.
- Historische Entwicklung und Kontext des lebensweltorientierten Ansatzes
- Theoretische Fundamente und Bezugspunkte
- Kernelemente und Praxisbezogene Aspekte der Lebensweltorientierung
- Struktur- und Handlungsmaximen: Prävention und Integration
- Anwendung der Maxime Prävention in einem konkreten Handlungsfeld
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zentrale Begriffe, Bezugspunkte und Prämissen der Lebensweltorientierung
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des lebensweltorientierten Ansatzes im Kontext der 1960er Jahre und der gesellschaftlichen Veränderungen dieser Zeit. Es werden die theoretischen Wurzeln im hermeneutisch-pragmatischen Ansatz, dem phänomenologisch-interaktionistischen Paradigma und der kritischen Alltagstheorie erläutert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Lebenswelt der AdressatInnen und der Relevanz von deren Ressourcen und Bewältigungsstrategien.
2. Struktur- und Handlungsmaximen
Dieses Kapitel widmet sich den Strukturmaximen „Prävention“ und „Integration“ innerhalb des lebensweltorientierten Ansatzes. Es werden die Beschreibungen der Maximen, ihre Vor- und Nachteile sowie die Bedeutung im Kontext der Sozialen Arbeit beleuchtet.
3. Die Maxime Prävention in einem Handlungsfeld
In diesem Kapitel wird die praktische Anwendung der Maxime Prävention in einem spezifischen Handlungsfeld der Sozialen Arbeit untersucht. Es werden konkrete Beispiele und Herausforderungen beleuchtet, die mit der Umsetzung des lebensweltorientierten Ansatzes in der Praxis verbunden sind.
Schlüsselwörter
Lebensweltorientierung, Soziale Arbeit, Prävention, Integration, Handlungsmuster, Alltagstheorie, Lebenswelt, Ressourcen, Kompetenzen, Empowerment, AdressatInnen, Selbstbestimmung, Kritik, neoliberale Tendenzen, Leistungsgesellschaft.
- Quote paper
- Carsten Friebis (Author), 2013, Geschichte und Struktur Sozialer Arbeit. Der lebensweltorientierte Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/456909