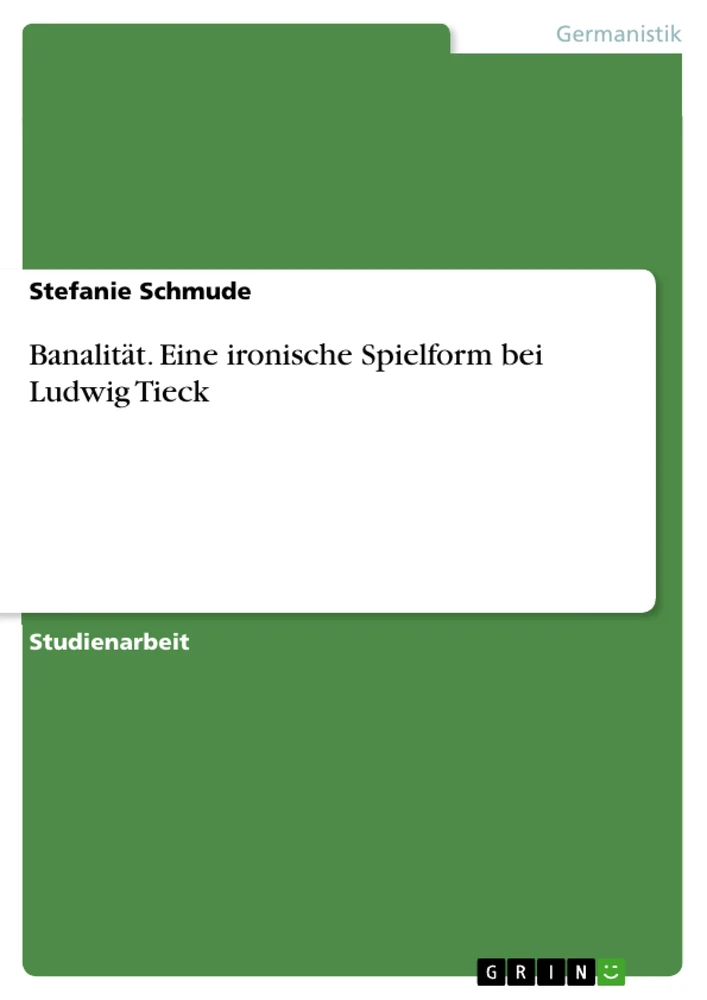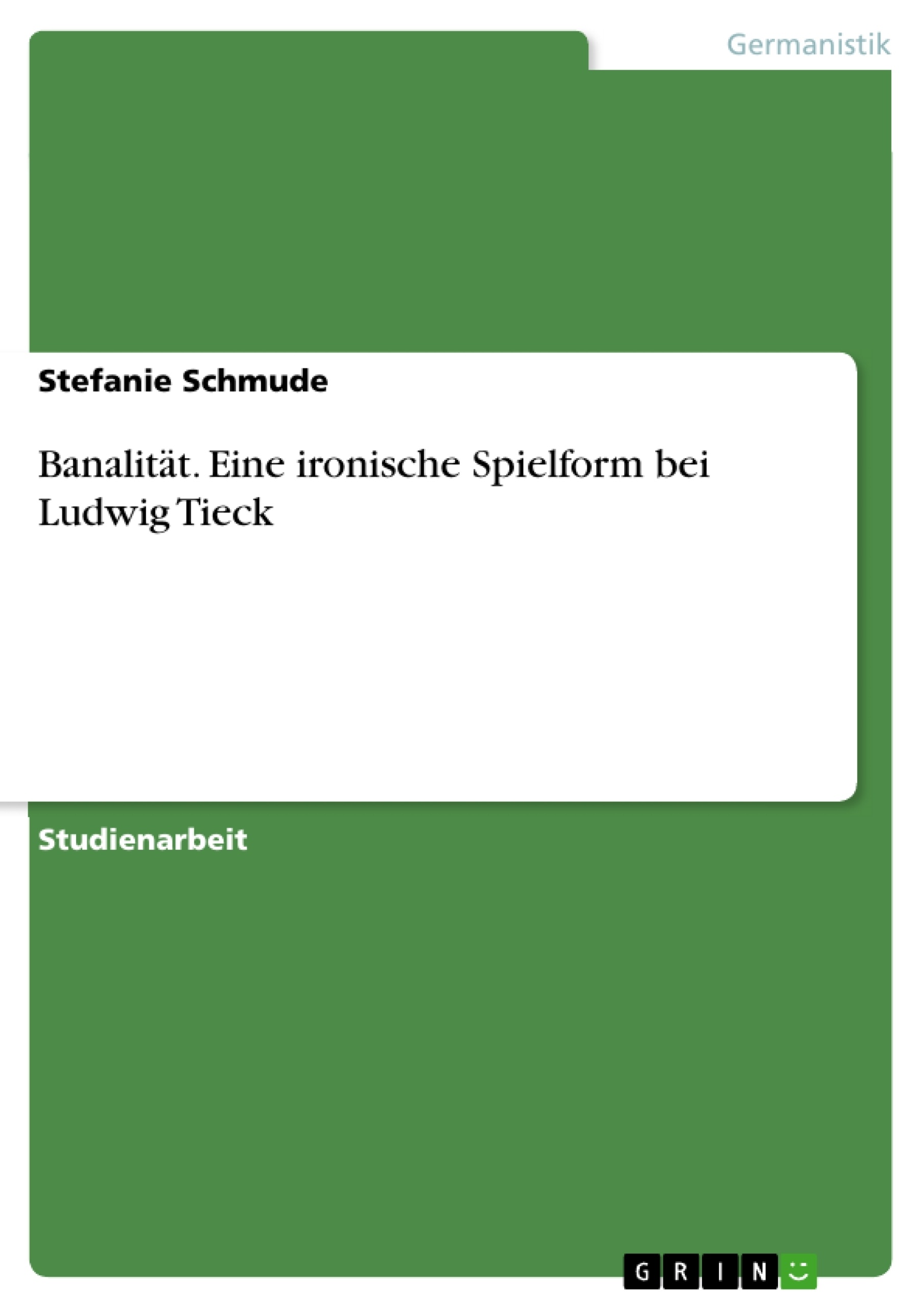Tiecks Komödie "Der gestiefelte Kater" kann als Grenzscheide in der Verwendung des Komischen in der Geschichte der deutschsprachigen Komödie betrachtet werden, da hier der für die Aufklärung typische Zusammenhang von Komik und Moral aufgelöst ist. Trotz des fehlenden komödientypischen happy ends handelt es sich um eine Komödie, die das Motiv des Mißverstehens und den Kontrast von Erwartung und Einlösung aufgreift. Als um 1800 die literarische Epoche der Aufklärung allmählich von der Frühromantik abgelöst wird, findet ein Paradigmenwechsel von der Psychologie des Gefühls und der Kritik sozialer Verhältnisse zur szenischen Selbstpräsentation der Kunst, von der Realitätshaltigkeit zur Selbstreferenz, vom Aufklärungslustspiel zur Transzendentalpoesie der romantischen Komödie statt.
Das Drama ist eine besondere Gattung für den Romantiker, da die dramatische Welt zugleich absolut und als hervorgebrachte auch transzendierbar ist. Hier ist sein ironisches Weltverständnis realisierbar, die Berührung des In-der-Welt-Seins mit dem Über-der-Welt-Stehen.
Der gestiefelte Kater wird häufig als romantische Ironie interpretiert, was angesichts der Selbstaufhebung als zentralem Mittel der romantischen Ironie Sinn ergibt. Allerdings ist auch eine gewisse Vorsicht bei dieser Interpretationsweise geboten, denn die von Schlegel geforderte Erhebung über die eigene Kunst geschieht nicht, da die übermütige Freiheit des Stücks selbst nicht ironisiert wird, und die Ironie Tiecks erfüllt auch nicht so ernste Funktionen wie die Selbstpräsentation von Kunst. Diese Komödie bleibt ohne das häufig in der Romantik vorkommende Unheimliche und ohne politische Persiflage, sie begnügt sich mit dem scherzhaften Spiel an sich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Banalität als Spielform der Ironie bei Tieck
- Banalität als ironische Spielform im Gestiefelten Kater
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Verwendung der Banalität als ironische Spielform im Werk von Ludwig Tieck. Insbesondere untersucht sie, wie Tieck dieses Element in seinem Drama "Der gestiefelte Kater" einsetzt, um ein spezifisches, ironisches Verständnis der Welt darzustellen.
- Die Rolle der Banalität in der Ironie bei Tieck
- Die Verwendung des Komischen und der Inkongruenz in Tiecks Dramen
- Die Abgrenzung zwischen Ironie, Satire und Komik im Werk Tiecks
- Die Kritik an der Interpretation von "Der gestiefelte Kater" als reine romantische Ironie
- Die Bedeutung von Tiecks Dramen für die Entwicklung des deutschen Dramas
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Forschung zu Ludwig Tiecks Werk und betont dessen Komplexität, insbesondere die Mischung von epischen, lyrischen und dramatischen Elementen. Sie hebt Tiecks Tendenz hervor, klassische Konventionen zugunsten einer spontanen Darstellung aufzugeben, sowie sein Interesse an der Zeitlichkeit und der intertextuellen Aufladung des Dramas.
2. Banalität als Spielform der Ironie bei Tieck
Dieser Abschnitt definiert das Komische und die Ironie anhand der Inkongruenz und Harmlosigkeit und untersucht die Beziehung zwischen Ironie, Komik und Satire. Er diskutiert die Schwierigkeit, Tiecks Theorie der Ironie aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit zu rekonstruieren.
3. Banalität als ironische Spielform im Gestiefelten Kater
Das Kapitel fokussiert auf Tiecks "Der gestiefelte Kater", um die Verwendung der Banalität als ironische Spielform zu untersuchen. Es analysiert die Rolle des Komischen und die Auflösung des Zusammenhangs von Komik und Moral, die für die Aufklärung typisch war.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf Ludwig Tieck, "Der gestiefelte Kater", Banalität, Ironie, Komik, Satire, Inkongruenz, Harmlosigkeit, Selbstreferenz, Selbstdekonstruktion, Romantik, Aufklärung, Drama, Dramaturgie, Intertextualität.
- Quote paper
- Stefanie Schmude (Author), 2014, Banalität. Eine ironische Spielform bei Ludwig Tieck, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/456895