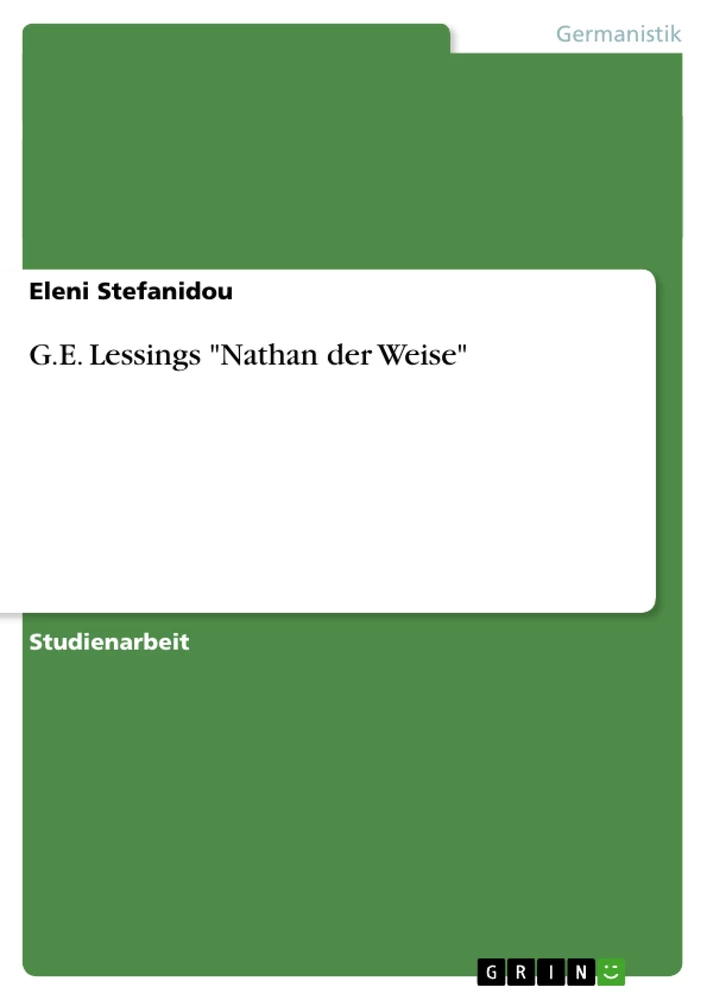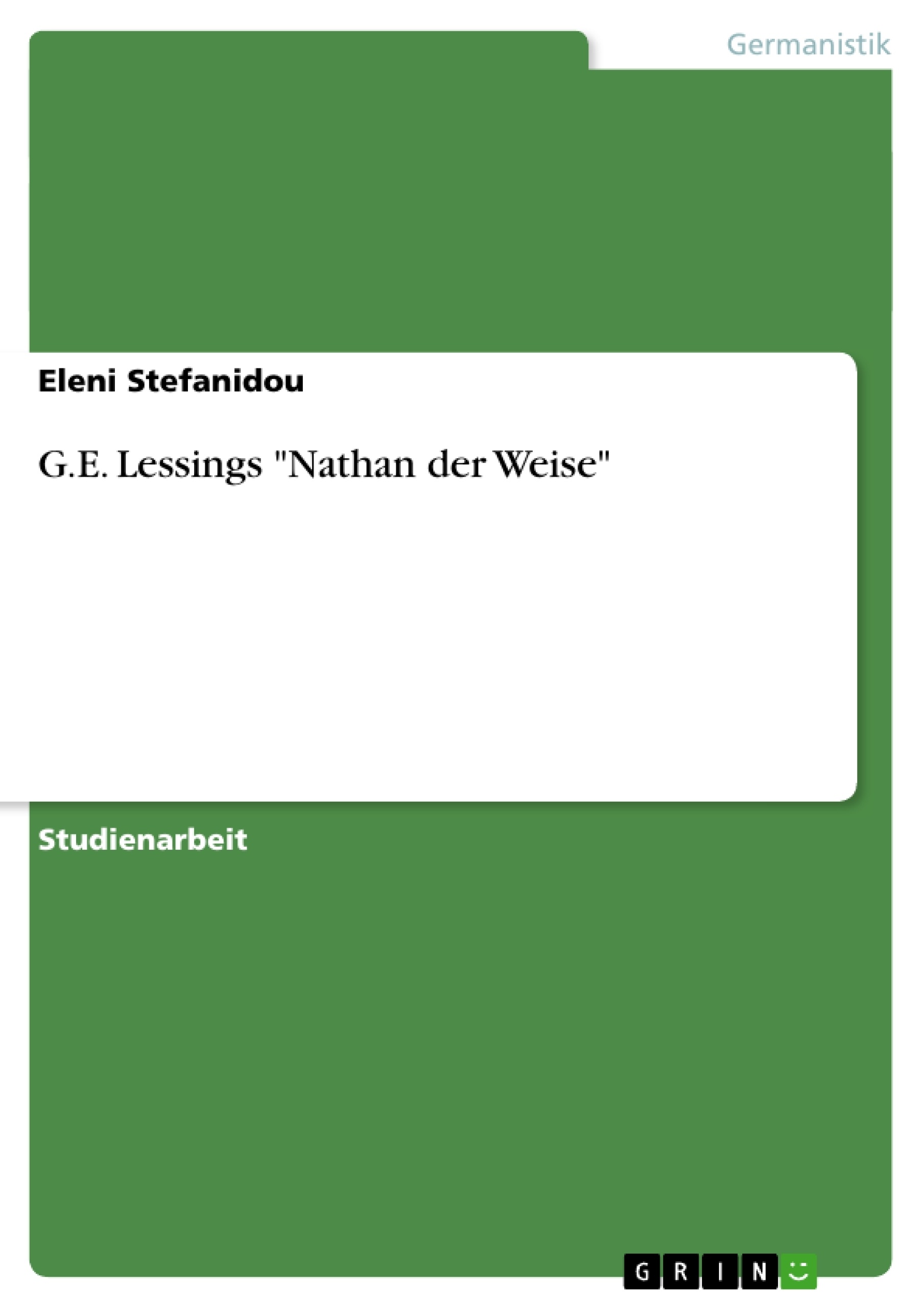„...der rechte Ring besitzt die Wunderkraft beliebt zu machen. Vor Gott und den Menschen angenehm.“ So heißt es in der Ringparabel, die Nathan dem Sultan Saladin erzählt. Nathan selbst besitzt zwar nicht diesen Ring, aber seine Weisheit verleiht ihm die Kraft, vor Gott und den Menschen angenehm zu sein. Denn er tritt seinen Mitmenschen vollkommen vorurteilsfrei gegenüber. Seit seiner Veröffentlichung im Jahre 1779 gilt somit Lessings dramatisches Gedicht „Nathan der Weise“ als Plädoyer für Toleranz und Humanität. Der Anlaß dazu war der Fragmentenstreit mit dem Hamburger Hauptpastor Goeze, der sich schließlich so zuspitzte, daß Mitte1778 Lessing die Zensurfreiheit entzogen wurde. Um weiterhin seine aufklärerischen Gedanken überzeugend transportieren zu können, schuf Lessing mit „Nathan dem Weisen“ einen erzieherischen Charakter, welcher hier näher betrachtet werden soll. Nathan ist ein jüdischer Kaufmann, der mit seiner Adoptivtochter Recha und deren christlicher Gesellschafterin Daja im Jerusalem des 12. Jahrhunderts lebt. Es ist also das Zeitalter der Kreuzzüge, welche von der Intoleranz der Religionen gegeneinander zeugen. In Jerusalem, wo die drei Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam aufeinandertreffen, schafft Nathan es durch seine Weisheit, Vertreter der Religionen zu Menschen zu erziehen.
Hier soll zunächst dargestellt werden, welche besonderen Eigenschaften diese Weisheit ausmachen, die dem Stück seinen heiteren und optimistischen Grundton verleiht und ein tragisches Ende der Verwicklungen verhindert. Gegenstand einer näheren Untersuchung soll aber vor allem eine bestimmte Fähigkeit Nathans sein. Als Erzieher wendet Nathan nämlich eine besondere Technik an. In Dialogen gibt er seinen Gesprächspartnern Denkanstöße, die zu vernünftiger Einsicht führen - sofern eine Bereitschaft oder Fähigkeit zum Dialog besteht. Diese geht dann einher mit der Bereitschaft zu menschlichem Handeln. In Gegenüberstellung zu den anderen Figuren des Dramas soll dabei mit Hilfe einer Rangordnung auch Nathans innere Überlegenheit verdeutlicht werden, denn er steht in der Fähigkeit zum Dialog und in Humanität allen als Vorbild voran. Besonders interessant wird es sein zu sehen, wie genau er erreicht, zwei ihm eher feindlich gesinnte Personen, Saladin und den Tempelherrn, zu seinen Freunden zu machen. Dies wird anhand der Analyse der Szenen II,5 und III,7 dargelegt werden. Das Augenmerk soll dabei in erster Linie auf Nathans Taktik und argumentatives Vorgehen liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nathans Weisheit
- Toleranz, Menschenkenntnis und Wohltätigkeit Nathans
- Judentum und Vorsehungsglaube
- Der Name „Nathan“
- Nathans Überlegenheit in Humanität und Dialog
- Der Patriarch
- Daja und Recha
- Al-Hafi und der Klosterbruder
- Der Tempelherr
- Sittah
- Saladin
- Schluß
- Literaturverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Lessings dramatisches Gedicht „Nathan der Weise“ und untersucht den Charakter Nathans als Vertreter der Toleranz und Humanität. Das Stück zeigt die Bedeutung der Weisheit, besonders im Hinblick auf den Umgang mit verschiedenen Religionen und Kulturen im mittelalterlichen Jerusalem.
- Nathans Weisheit als Ausdruck von Toleranz, Menschenkenntnis und Wohltätigkeit
- Die Rolle des Judentums und des Vorsehungsglaubens in Nathans Lebenswelt
- Nathans Fähigkeit zum Dialog und seine Überlegenheit in Humanität gegenüber anderen Figuren
- Nathans Erziehungsmethode und seine Fähigkeit, Feinde zu Freunden zu machen
- Die Darstellung des Judentums in „Nathan der Weise“ und die Herausforderungen des damaligen Kontextes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Textes stellt „Nathan der Weise“ als ein Plädoyer für Toleranz und Humanität vor, welches im Kontext des Fragmentenstreits mit Goeze entstanden ist. Der Text beleuchtet die Bedeutung von Nathans Weisheit im Stück, besonders in Bezug auf seine Toleranz und seine Fähigkeit, Menschen verschiedener Religionen zu vereinen.
Das Kapitel „Nathans Weisheit“ analysiert Nathans Toleranz, Menschenkenntnis und Wohltätigkeit, wobei der Text seinen Reichtum und seine Geschäftsreisen als Grundlage für seine Weitsicht und Verständnis für andere hervorhebt. Es werden auch die Auswirkungen des Vorsehungsglaubens auf Nathans Lebensweisheit untersucht, insbesondere im Hinblick auf seinen Umgang mit dem Verlust seiner Familie.
Das Kapitel „Nathans Überlegenheit in Humanität und Dialog“ analysiert Nathans Überlegenheit in Humanität und Dialog im Vergleich zu anderen Figuren im Stück, wie dem Patriarchen, Daja und Recha, Al-Hafi und dem Klosterbruder, dem Tempelherrn, Sittah und Saladin.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes umfassen „Nathan der Weise“, „Toleranz“, „Humanität“, „Weisheit“, „Judentum“, „Vorsehungsglaube“, „Dialog“, „Religion“, „Kultur“, „Kreuzzüge“, „Menschenkenntnis“, „Wohltätigkeit“, „Erziehung“, „Figurenanalyse“, „Fragmentenstreit“, „Goeze“, „Lessing“, „Toleranzgedanke“, „Mittelalter“, „Jerusalem“.
- Quote paper
- Eleni Stefanidou (Author), 1998, G.E. Lessings "Nathan der Weise", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/45283