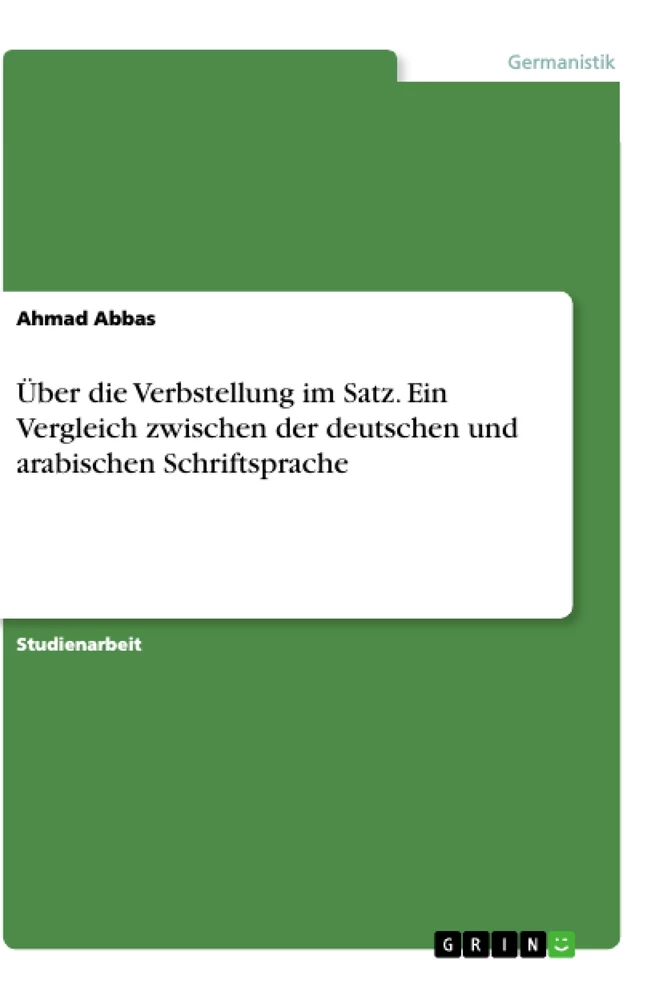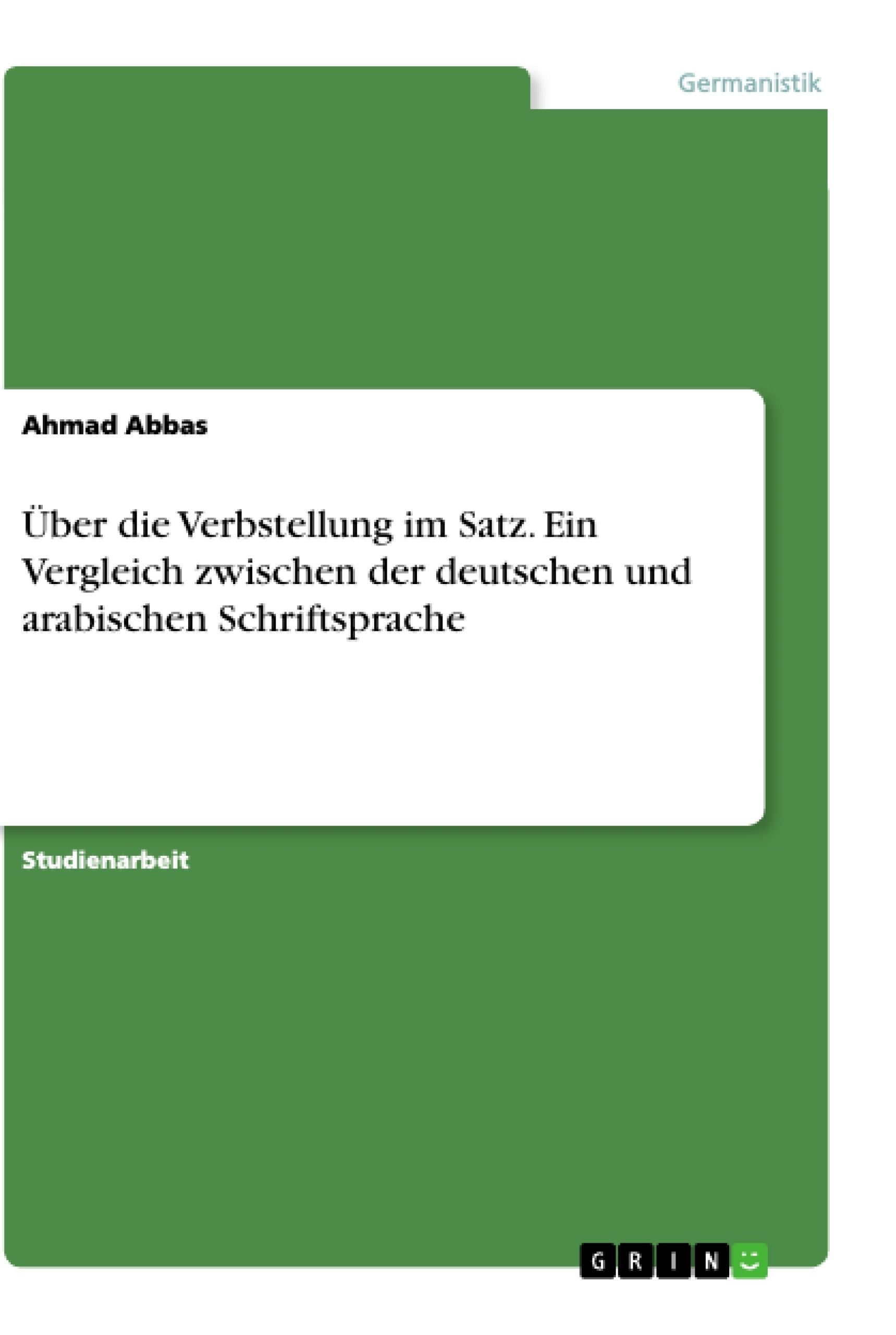Die folgende Arbeit hat zum Ziel, die Verbstellung in der arabischen und deutschen Schriftsprache zu vergleichen und aus den Erkenntnissen (mögliche) Rückschlüsse im Hinblick auf den DaF-/DaZ-Unterricht zu ziehen. Dazu wird zunächst in einem theoretischen Diskurs der Unterschied zwischen der Satzarten-Typologie und den Verbstellungstypen im Deutschen erläutert. Noch immer werden beide Klassifikationen, obgleich sie auf verschiedenen Ebenen ansetzen, fälschlicherweise einander gleichgesetzt. In einem weiteren Schritt werden die spezifischen Verbstellungstypen des Deutschen beleuchtet, um Aufschluss darüber zu erlangen, welches Wort- bzw. Verbstellungsschema dem Deutschen zugrunde liegt oder welche Tendenzen festzumachen sind. Die theoretischen Vorüberlegungen ermöglichen es, in die praktische Untersuchung überzugehen, in deren Kontext die Stellungsmöglichkeiten des Verbs in der arabischen Schriftsprache untersucht werden sollen. Anhand von zwei (zufällig) ausgewählten Zeitungsartikeln soll zunächst überprüft werden, inwieweit die These, das Arabische sei eine VSO-Sprache, der Realität des Standardarabischen entspricht. Finden wir in den Texten ausschließlich Verberstsätze? Ist die Verbposition in den Texten eine feste, oder variiert sie? Die Untersuchung und die anschließende Auswertung der beiden Sachtexte sollen Antworten auf diese Fragen liefern. Ohne den Anspruch auf eine repräsentative Untersuchung zu erheben, wird gezeigt, ob die Annahme der VSO-Stellung des Arabischen korrekt ist. Im vierten Kapitel sollen die Ergebnisse in den Kontext des DaF-/DaZ-Unterrichts gerückt werden: Inwieweit kann der Vergleich der beiden Wortstellungsmuster (insbesondere der Verbstellung) Deutschlernern mit Arabisch L1 einen besseren Zugang zur deutschen Sprache verschaffen? Inwieweit kann die Kenntnis über die scheinbar unterschiedlichen Wortstellungstypen DaF-/DaZ-Lehrkräften dazu verhelfen, die deutsche Satzstruktur der erwähnten Zielgruppe besser zu vermitteln? Diese Fragen bilden den Kern des vierten Kapitels, ehe die gesamte Arbeit in einem abschließenden Schlussteil resümiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Satzarten-Typologie
- 2.2 Klassifikation nach Verbstellungstypen
- 2.3 Stellungen des finiten Verbs im Deutschen
- 3. Untersuchungen zur Verbstellung im Arabischen
- 3.1 Forschungsstand
- 3.2 Methodik
- 3.3 Auswertungen
- 3.3.1 Text 1
- 3.3.2 Text 2
- 4. Konsequenzen für den DaF-/DaZ-Unterricht?
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen Vergleich der Verbstellung in der deutschen und arabischen Schriftsprache durchzuführen und daraus Schlussfolgerungen für den DaF-/DaZ-Unterricht abzuleiten. Es wird untersucht, inwieweit die unterschiedlichen Verbstellungsmuster den Lernerfolg beeinflussen können.
- Vergleich der Verbstellung im Deutschen und Arabischen
- Analyse der Satzarten-Typologie im Deutschen
- Untersuchung der Verbstellungstypen im Deutschen
- Auswertung von Textbeispielen aus dem Arabischen
- Implikationen für den DaF-/DaZ-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Verbstellung im Satz ein und hebt die zentrale Rolle des finiten Verbs hervor. Sie erläutert den Unterschied in der Verbstellung zwischen Deutsch (Verb-Zweit-Stellung und Verb-End-Stellung) und Arabisch (VSO-Struktur) und benennt die Zielsetzung der Arbeit: einen Vergleich der Verbstellungen und die Ableitung von Konsequenzen für den DaF-/DaZ-Unterricht.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel differenziert zwischen Satzarten-Typologie und Verbstellungstypen. Es betont, dass diese beiden Konzepte, obwohl oft verwechselt, unterschiedliche Ebenen der Satzanalyse betreffen. Die Satzarten-Typologie beschreibt die kommunikative Funktion eines Satzes, während die Verbstellungstypen die Position des Verbs im Satz betrachten. Das Kapitel analysiert verschiedene Satzarten im Deutschen und beleuchtet die spezifischen Verbstellungstypen, um das zugrundeliegende Wort- bzw. Verbstellungsschema zu verstehen.
3. Untersuchungen zur Verbstellung im Arabischen: Dieses Kapitel untersucht die Verbstellung im Arabischen. Es beginnt mit einer Darstellung des Forschungsstands und der Methodik. Die anschließende Auswertung von zwei ausgewählten arabischen Texten überprüft die Hypothese, dass Arabisch eine VSO-Sprache ist, indem sie die tatsächliche Verbposition in den Texten analysiert und deren Variabilität untersucht. Die Analyse beleuchtet, ob die VSO-Stellung im untersuchten Korpus konsistent auftritt oder ob Variationen vorliegen.
4. Konsequenzen für den DaF-/DaZ-Unterricht?: Dieses Kapitel diskutiert die Bedeutung der Erkenntnisse aus dem Vergleich der Verbstellung für den DaF-/DaZ-Unterricht. Es untersucht, wie das Verständnis der unterschiedlichen Wortstellungsmuster Deutschlernern mit Arabisch als Muttersprache helfen kann, die deutsche Sprache besser zu verstehen und wie DaF-/DaZ-Lehrkräfte dieses Wissen nutzen können, um die deutsche Satzstruktur effektiver zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Verbstellung, Satzstruktur, Deutsch, Arabisch, DaF, DaZ, Satzarten-Typologie, Verbstellungstypen, VSO, SVO, SOV, Vergleichende Sprachwissenschaft, Sprachunterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Verbstellung im Deutschen und Arabischen
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit vergleicht die Verbstellung im Deutschen und Arabischen und leitet daraus Konsequenzen für den Deutsch-als-Fremdsprache (DaF) und Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Unterricht ab. Im Fokus steht der Einfluss unterschiedlicher Verbstellungsmuster auf den Lernerfolg.
Welche Aspekte der Verbstellung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Verbstellung, darunter die Satzarten-Typologie (kommunikative Funktion des Satzes), Verbstellungstypen (Position des Verbs im Satz), und konkrete Verbpositionen in deutschen und arabischen Texten (z.B. VSO, SVO, SOV).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen (Satzarten-Typologie und Verbstellungstypen im Deutschen), Untersuchungen zur Verbstellung im Arabischen (inklusive Forschungsstand, Methodik und Auswertung von Textbeispielen), Konsequenzen für den DaF-/DaZ-Unterricht und Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Methode, die die Verbstellung im Deutschen und Arabischen kontrastiert. Im Kapitel zu den Untersuchungen im Arabischen wird eine konkrete Methodik zur Analyse von Textbeispielen beschrieben, die die Hypothese einer VSO-Struktur im Arabischen überprüft.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Textanalysen im arabischen Teil werden präsentiert, wobei untersucht wird, ob die VSO-Stellung konsistent auftritt oder Variationen vorliegen. Die Arbeit zeigt auf, wie diese Ergebnisse für den DaF-/DaZ-Unterricht relevant sind.
Welche Schlussfolgerungen werden für den DaF-/DaZ-Unterricht gezogen?
Die Arbeit diskutiert, wie das Verständnis der unterschiedlichen Wortstellungsmuster Deutschlernern mit Arabisch als Muttersprache helfen kann, die deutsche Sprache besser zu verstehen und wie DaF-/DaZ-Lehrkräfte dieses Wissen nutzen können, um die deutsche Satzstruktur effektiver zu vermitteln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Verbstellung, Satzstruktur, Deutsch, Arabisch, DaF, DaZ, Satzarten-Typologie, Verbstellungstypen, VSO, SVO, SOV, Vergleichende Sprachwissenschaft, Sprachunterricht.
- Quote paper
- Ahmad Abbas (Author), 2018, Über die Verbstellung im Satz. Ein Vergleich zwischen der deutschen und arabischen Schriftsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/452530