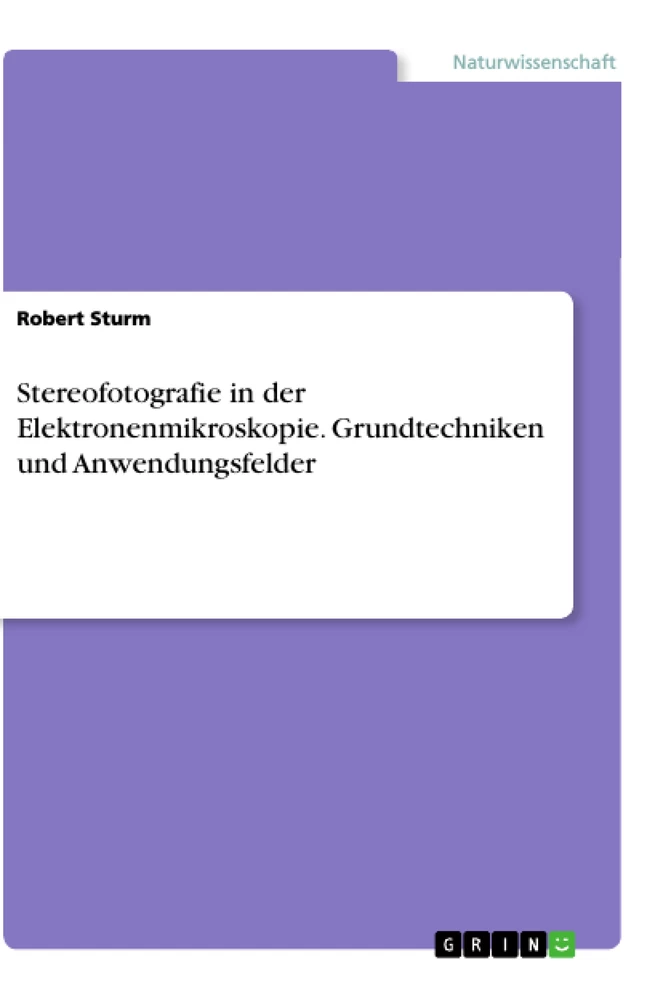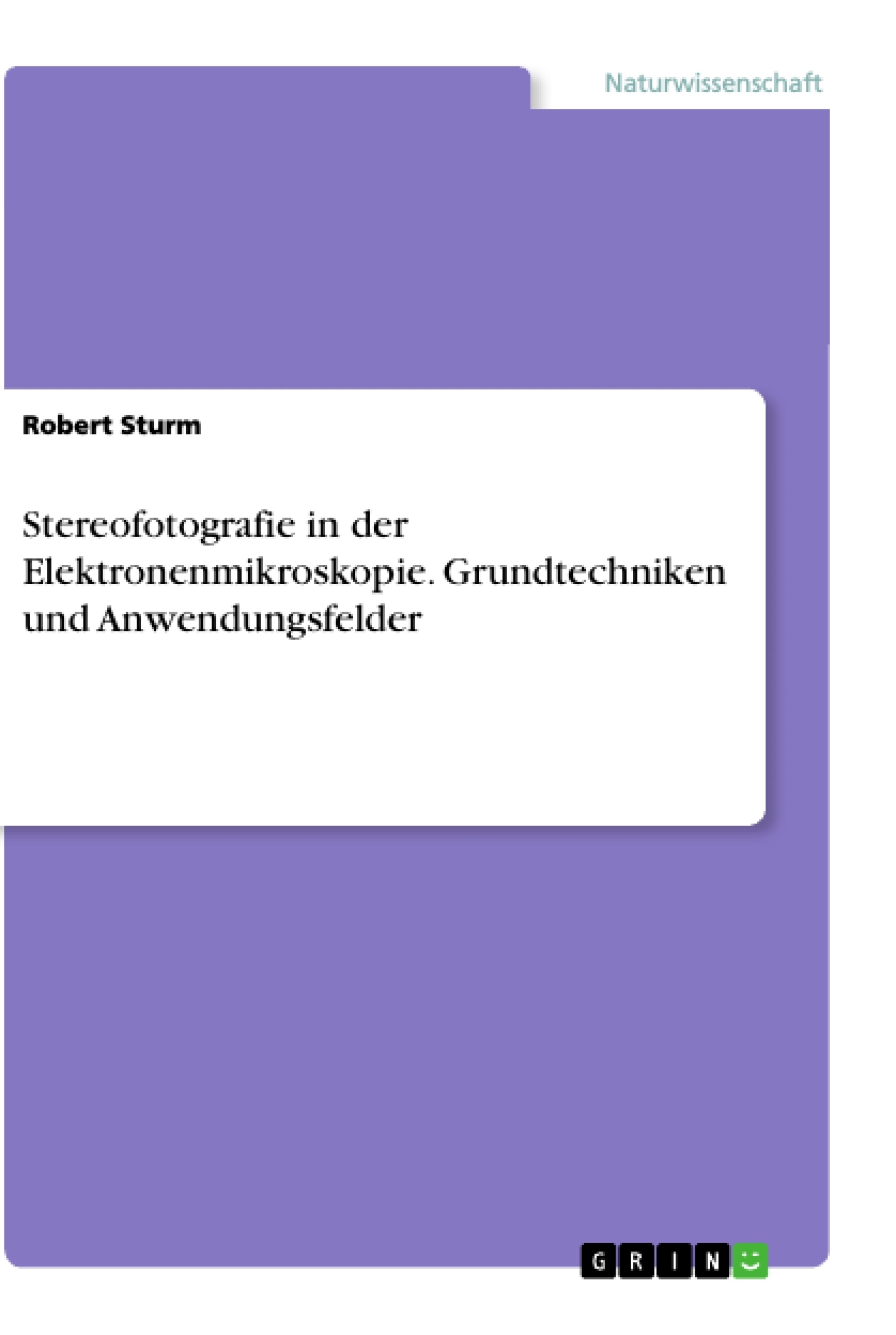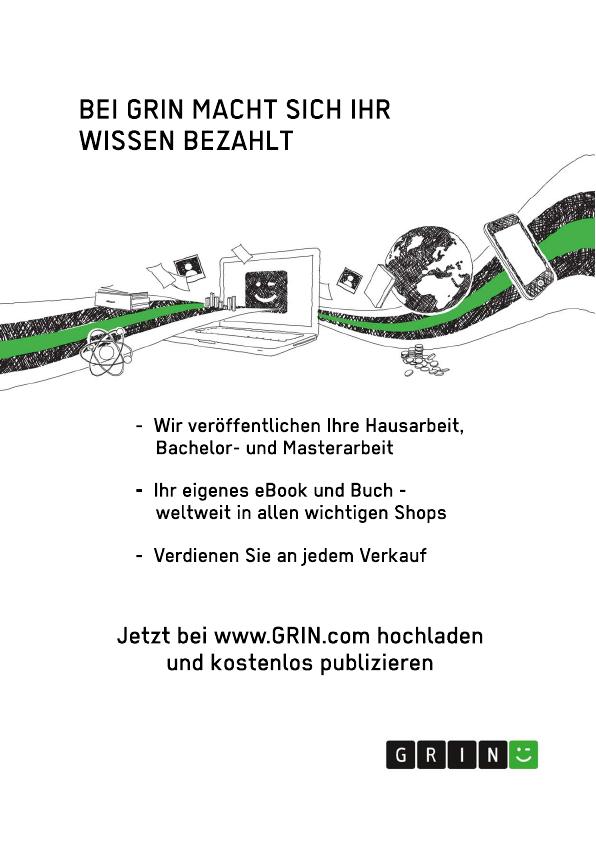Dieses Buch beschäftigt sich mit verschiedenen Anwendungsbereichen des stereoskopischen Verfahrens in der Rasterelektronenmikroskopie. Dafür werden die vier wissenschaftlichen Disziplinen Biologie, Mikropaläontologie, Kristallografie und Humanmedizin einer näheren Betrachtung unterzogen. In allen genannten Fällen wird umfangreiches Bildmaterial präsentiert und ausführlich dokumentiert.
Dabei wird unter anderem den Fragen nachgegangen, inwieweit die Stereoskopie überhaupt wissenschaftliche Relevanz besitzen kann und welche Entwicklungen des Verfahrens in den kommenden Jahren zu erwarten sind.
Die Stereoskopie verzeichnet seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts eine gesteigerte Verwendung in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Nachdem sich dieses optische Verfahren zunächst in der herkömmlichen Fotografie etabliert hatte, fand es auch seinen sukzessiven Eingang in die Licht- und Elektronenmikroskopie. Dort gelingt es bereits mit einfachen Handgriffen, spektakuläre Raumbilder der Untersuchungsobjekte herzustellen. Zudem besteht die Möglichkeit, schon vorhandene Fotografien mithilfe geeigneter Computersoftware mit zusätzlicher dreidimensionaler Information auszustatten. Die wesentlichen Grundzüge der stereoskopischen Bildgestaltung in der Elektronenmikroskopie sollen hier präsentiert werden.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 - Einleitung
1.1 Kurzer hustorischer Überblick zum stereoskopischen Verfahren
1.2 Physikalische Grundzüge der stereoskopischen Visualisierungsmethode
1.3 Aufnahme und Betrachtung elektronenmikroskopischer Stereobilder
Kapitel 2 - Biologie
2.1 Die Biologie und ihre Verwendung von licht- und elektronen mikroskopischen Methoden
2.2 Bedeutung und Anwendung stereoskopischer Techniken in der Biologie
2.3 Bildbeispiele aus verschiedenen Forschungsbereichen der Biologie
Kapitel 3 - Mikropaläontologie
3.1 Die Mikropaläontologie und ihre Nutzung der Licht- und Elektronenmikroskopie
3.2 Bedeutung und Anwendung stereoskopischer Verfahren in der Mikropaläontologie
3.3 Bildbeispiele aus verschiedenen Forschungsbereichen der Mikropaläontologie
Kapitel 4 - Kristallografie
4.1 Die Wissenschaft der Kristallografie und ihre Verbindung zur Elektronenmikroskopie
4.2 Bisherige Nutzung stereoskopischer Methoden in der Kristallografie
4.3 Bildbeispiele aus verschiedenen Forschungsbereichen der Kristallografie
Kapitel 5 - Humanmedizin
5.1 Werdegang der Elektronenmikroskopie in der Humanmedizin
5.2 Etablierung stereoskopischer Verfahren in der Humanmedizin
5.3 Bildbeispiele aus verschiedenen medizinischen Bereichen
Kapitel 6 - Schlussbemerkungen
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Vorwort
S eit der Mitte des vorigen Jahrhunderts gilt die Rasterelektronenmi- kroskopie als bedeutende Technik zur Veranschaulichung kleinster Strukturen und als fester Bestandteil des methodischen Spektrums der Naturwissenschaften, Medizin und Technik. Das optische Verfahren hat gerade in den vergangenen Dekaden etliche Entwicklungsschritte durchlaufen, so dass heute etwa die Möglichkeit besteht, äußerst instabile Oberflächen wie jene von Eiskristallen oder sogar lebende Mikroorganismen zu untersuchen. Das Elektronenmikroskop gelangt überall dort zum Einsatz, wo entweder die Auflösungsgrenze des Lichtmikroskops deutlich unterschritten wird oder eine möglichst exakte Bewertung superfizieller Objekteigenschaften anzustreben ist.
In den letzten Jahren bestand in der Rasterelektronenmikroskopie der vermehrte Wunsch nach einer dreidimensionalen Abbildung der auf dem Bildschirm betrachteten Strukturen. Hier haben sich stereoskopische Auf- nahme- und Visualisierungsmethoden als sehr hilfreich erwiesen, da ihre Realisierung keines großen technischen Aufwandes bedarf. Dadurch kön- nen sie von einer breiten Anwendergruppe genutzt werden. Neben der „klassischen“ Herstellung von Stereobildern, bei welcher das Untersu- chungsobjekt aus zwei verschiedenen Perspektiven fotografiert wird, tritt gegenwärtig auch in verstärktem Maße die computerunterstützte Stereo- skopie in den Vordergrund. Bei dieser Methode wird mithilfe spezifischer Renderverfahren aus einer Einzelfotografie ein 3D-Bild konstruiert; damit kann man vor allem alten Bildbeständen durch Hinzufügung räumlicher Information „neues Leben“ einhauchen.
Das vorliegende Buch beschäftigt sich primär mit verschiedenen Anwen- dungsbereichen des stereoskopischen Verfahrens in der Rasterelektro- nenmikroskopie, wobei die vier wissenschaftlichen Disziplinen Biologie, Mikropaläontologie, Kristallografie und Humanmedizin diesbezüglich ei- ner näheren Betrachtung unterzogen werden sollen. In allen genannten Fällen wird umfangreiches Bildmaterial präsentiert und ausführlich doku- mentiert. Die Monografie geht dabei unter anderem den Fragen nach, in- wieweit die Stereoskopie überhaupt wissenschaftliche Relevanz besitzen kann und welche Entwicklungen des Verfahrens in den kommenden Jah- ren zu erwarten sind.
Kapitel 1 Einleitung
Die Stereoskopie stellt im Allgemeinen ein optisches Verfahren dar, bei dem mithilfe zweier Flachbilder (zweidimensional) ein Raumbild (dreidimensional) eines beliebigen Objektes hergestellt wer- den kann. Die beiden Fotografien zeigen den Gegenstand dabei aus leicht unterschiedlichen Blickwinkeln und werden dem Betrachter in Form eines Stereobildpaares (Stereogramm) präsentiert. Blickt nun je- des Auges auf das ihm zugewiesene Einzelbild (stereoskopisches Halb- bild), so findet im Gehirn eine Verschmelzung von linkem und rechtem Halbbild statt, was im Endeffekt die Entstehung eines räumlichen Ein- drucks zur Folge hat. Aus physikalischer Sicht stellt das stereoskopische Verfahren eine Art der optischen Täuschung dar, weil der Blick auf das Stereogramm im menschlichen Gehirn letztendlich dieselbe Wirkung wie die Betrachtung des fotografierten Gegenstandes selbst erzeugt. Wie in diesem Kapitel dargelegt werden soll, entwickelte der Mensch bereits im ausgehenden Mittelalter eine Faszination für das räumliche Sehen, welche bis zum heutigen Tag bestanden geblieben ist und durch den enormen technischen Fortschritt eine kontinuierliche Steige- rung erfahren hat. Die hinter dem stereoskopischen Verfahren stehen- den physikalischen Prinzipien sind relativ leicht verständlich, sollen aber aufgrund zahlreicher vergangener Publikationen zu dem Thema nur in aller Kürze angerissen werden. Als ein im Zusammenhang mit dieser Abhandlung sicherlich essenzielles Thema gilt die in der Raster- elektronenmikroskopie verwendete Methodik der Stereobildaufnahme, wobei zwei unterschiedliche Techniken ࢼ eine gerätebezogene und eine computerunterstützte ࢼ angesprochen werden sollen. Zum Ab- schluss werden noch verschiedene Betrachtungsmethoden vorgestellt.
1.1 Kurzer historischer Überblick zum stereosko- pischen Verfahren
Der Begriff der Stereoskopie leitet sich von den altgriechischen Wörtern stereos (solide, starr, körperlich, räumlich) und skopeů (prüfen, untersu- chen, ansehen, betrachten) ab. Er bezeichnet im Allgemeinen einen Teil- bereich der Optik, welcher sich mit der Erzeugung räumlicher Darstellun- gen auf Basis der oben genannten Halbbilder auseinandersetzt [1-10]. Die Grundidee der Stereoskopie geht eigentlich schon auf Leonardo da Vinci zurück, der Experimente zum räumlichen Sehen durchführte und damit einige Grundlagen für die moderne Optik schuf. Um 1600 gelang dem Italiener Jacopo Chimenti da Empoli die Erstellung einer ersten ste- reoskopischen Tuschezeichnung, welche einen bei der Arbeit tätigen Bild- künstler aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zeigt. Obwohl die bei- den Abbildungen teilweise signifikante Unterschiede aufweisen, lassen sie sich dennoch zu einem Raumbild verschmelzen und in Bezug auf ihre räumliche Tiefe erkunden [2, 3].
Im Jahre 1838 veröffentlichte der Engländer Charles Wheatstone grundle- gende Theorien zum stereoskopischen Bildgebungsverfahren. Zudem ent- wickelte er ein Spiegelstereoskop, welches die getrennte Betrachtung der beiden Halbbilder des Stereogramms ermöglichte und dadurch eine we- sentliche Unterstützung für den Bildverschmelzungsprozess darstellte [11]. Da dieses Gerät sehr groß und unhandlich war und mit dem Auf- kommen der Stereofotografie in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Ruf nach kleineren Bildbetrachtern immer lauter wurde, kam es unter Oliver Wendell Holmes zur Entwicklung des Prismenstereoskops. Dieses an eine großdimensionierte Brille erinnernde Gerät ist mit zwei Fresnel-Prismen bestückt, die automatisch jedem Auge das entsprechende Halbbild zu- weisen. Das Stereoskop ist über einen speziellen Holzsteg mit einem Bild- halter verbunden, welcher dem Betrachter das Stereogramm im richtigen Abstand zu präsentieren vermag [1-3].
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war die hinter dem stereoskopischen Verfahren stehende Technik bereits weit vorangeschritten. Neben immer kompakteren Stereoskopen wurden nun auch Stereokameras mit entsprechenden Doppelobjektiven konzipiert. In Teilen Europas entstand ein regelrechter „Stereo-Boom“, durch den allmählich auch die breitere Bevölkerung Zugang zu dieser faszinierenden Visualisierungstechnik er- hielt. In mit speziellen Großstereoskopen ausgestatteten Salons wurden gegen Bezahlung eines Eintrittsgeldes Raumbildserien aus Natur und Technik sowie vom aktuellen Weltgeschehen vorgeführt [1-3].
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfolgte man vonseiten der Ka- merahersteller primär das Ziel, die 3D-Fotografie einer immer größeren Anzahl an Menschen zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck wurden relativ kostengünstige Doppelobjektivkameras und Betrachter entwickelt, welche sich auch Leute mit kleinerem Geldbeutel leisten konnten. Für viele Menschen gestaltete sich die Anschaffung einer derartigen Ge- rätschaft trotz sinkender Preise nach wie vor als sehr schwierig, so dass die massenhafte Verbreitung der stereoskopischen Technik letztendlich fehlschlug [2]. In der Nachkriegszeit unternahm man mit der Entwicklung immer günstigerer Stereokameras und Stereovorsätze erneut den Ver- such, die 3D-Fotografie als Massenmedium zu etablieren. Vor allem in den 1950er und 1960er Jahren konnte das Bildgebungsverfahren einen stetig wachsenden Zulauf verzeichnen, wobei sich amerikanische Herstel- ler durch die Entwicklung innovativer Systeme eine Spitzenposition auf dem Markt erkämpfen konnten [1-3]. Nachdem die Stereoskopie in den folgenden Jahrzehnten ein wenig in Vergessenheit geraten war, erlebte sie ab den 2000er Jahren mit dem 3D-Kino und 3D-Fernsehen wiederum eine bemerkenswerte Renaissance [2].
Die erstmalige wissenschaftliche Nutzung des stereoskopischen Verfah- rens datiert an die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, wobei zunächst vor allem die Archäologie, Topografie und Meteorologie erhöhtes Interesse an der 3D-Fotografie bekundeten. Von Flugzeugen, Luftschiffen und Heißluftballonen aus wurden stereoskopische Aufnahmen der überfloge- nen Landschaft sowie von archäologischen Stätten oder größeren Wol- kenformationen angefertigt. Mithilfe spezieller Stereoskope konnten auf Basis des vorhandenen Bildmaterials exakte Vermessungen von Land- schaftsformen oder Wolkenstrukturen getätigt werden [1, 3, 6-10]. Im Laufe des 20. Jahrhunderts konnte sich die Raumfotografie in immer mehr wissenschaftlichen Disziplinen etablieren und avancierte schließlich auch in den Naturwissenschaften zu einem häufig verwendeten opti- schen Verfahren. In manchen Forschungsfeldern, welche einen erhöhten Bedarf nach räumlicher Bildinformation besitzen, zählt die Stereoskopie bereits zu den Standardmethoden [1-5].
In der näheren Vergangenheit vermochte die dreidimensionale Visuali- sierung insbesondere in den naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen vermehrt in den Mikrokosmos vorzudringen. Mithilfe speziel- ler Kamerasysteme und Aufnahmemethoden gelang die Erzeugung licht- und elektronenmikroskopischer Raumfotografien, welche eine genauere und gezieltere Untersuchung der Studienobjekte ermöglichten [1-5]. Aus gegenwärtiger Sicht darf davon ausgegangen werden, dass das 3D-Bild in der Mikroskopie in Zukunft noch wesentlich an Stellenwert gewinnen wird, da es für die Beantwortung spezifischer wissenschaftlicher Fragen von erheblichem Nutzen sein kann.
1.2 Physikalische Grundzüge der stereoskopischen Visualisierungsmethode
Die hinter dem stereoskopischen Sehen stehenden physikalischen Prinzi- pien wurden erstmals durch Hermann von Helmholtz [12] einer ausführli- chen Betrachtung unterzogen. Beim räumlichen Sehen können die einzel- nen Bildpunkte eines Objektes auf die Ebene des linken und rechten Halb- bildes projiziert werden (Abb. 1.1). Wenn man mit den optischen Sinnesorganen den vorderen Punkt A in den Fokus nimmt, kommen die beiden sichtbaren Punkte B und D auf der Projektionsebene rechts und links ne- ben diesem Konzentrationspunkt zu liegen. Die horizontalen Abstände A‘-B‘ und A‘-D‘ beziehungsweise A‘‘-B‘‘ und A‘‘-D‘‘ sind für die Tiefenwahr- nehmung von essenzieller Bedeutung, da sich mit ihrer Hilfe die soge- nannten Horizontalparallaxen oder Deviationen (d) korrespondierender Bildpunkte (B‘/B‘‘ und D‘/D‘‘) ermitteln lassen. Diesen physikalischen Pa- rametern liegt die einfache Formel d = (K‘-X‘) - (K‘‘-X‘‘) zugrunde, wobei in den Klammern die auf der Projektionsebene gemessenen Distanzen zwischen Konzentrations- oder Fokuspunkt (K) und beliebigem Objekt- punkt (X) dargestellt sind. Die Differenz dieser Abstände zwischen linkem und rechtem Halbbild kann laut obiger Formel zu positiven oder negati- ven Werten führen. Positive Werte der Deviation zeigen per definitionem ein gegenüber dem Fokuspunkt in die Tiefe versenktes Objekt an, wohin- gegen bei negativen Deviationswerten eine Ausdehnung des Gegenstan- des vor dem Fokuspunkt erfolgt. Der in der Abbildung gezeigte Punkt C ist für die Augen nicht sichtbar und spielt demzufolge für die Tiefenwahr- nehmung keine Rolle [1, 3-5].
Die Objektpunkte A, B und D werden nach erfolgter Zentralspiegelung der zugehörigen Lichtstrahlen an den Augenlinsen auch auf die Netzhaut des linken und rechten Auges projiziert. Hier sind ebenfalls entsprechende Distanzen zwischen den Projektionspunkten Al, Bl und Dl beziehungswei- se Ar, Br und Dr erkennbar, welche innerhalb des Netzhautareals die glei- chen Deviationen hervorrufen, wie sie bereits weiter oben für die Projek- tionsebene definiert wurden. Da bei Fokussierung des Punktes A die Ob- jektpunkte B und D an unterschiedlichen Positionen der linken und rech- ten Retina abgebildet werden, würde es im Gehirn normalerweise zur Ent- stehung eines Doppelbildes des betrachteten Gegenstandes kommen. Ge- gen diese ungewollte Situation ergreift das menschliche Nervenzentrum eine wirksame Maßnahme, indem es die unterschiedlich positionierten Punkte einem Verschmelzungsprozess unterzieht und entsprechende Deviationen als Rauminformation abspeichert. Die Fusion bildet also letztendlich die Grundlage für das räumliche Wahrnehmungsvermögen des Menschen [2, 3].
Abbildung 1.1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einfache Skizze zur Erklärung jener physikalischen Grundlagen, welche hinter dem Raumsehen und der stereoskopischen Bildgebung stehen (a = Abstand Projektionsebene [PE] - Auge, b = Augenabstand, e = Abstand Projektionsebene - Objekt, t = wahrgenommene Objekttiefe.
Abbildung 1.2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der physikalische Parameter der Deviation und sein Einfluss auf die ste- reoskopische Bildwirkung. Oben: Längen zur Berechnung der Deviation (L = Länge der horizontalen Bildkante), Mitte: Heraushebung der Elemente aus der Bildebene (d < 0), unten: Versetzung der Elemente hinter die Bild- ebene (d > 0).
Für das stereoskopische Verfahren ist nun entscheidend, dass die von den Bildpunkten A‘, B‘ und D‘ beziehungsweise A‘‘, B‘‘ und D‘‘ ausgehenden Lichtstrahlen in den Augen exakt die gleichen Abbildungsmuster erzeugen wie die von den eigentlichen Objektpunkten A, B und D ausgehenden Strahlen. Dies wiederum bedeutet, dass das menschliche Auge grundsätzlich nicht mehr zwischen dem Stereobild eines Objektes und dem Objekt selbst unterscheiden kann. In beiden Fällen erfolgt eine identische räumliche Wahrnehmung. Die Stereoskopie vermag also mithilfe zweier Flachbilder (zweidimensional) die Erzeugung eines Raumbildes (dreidimensional) zu erwirken [1-3, 12].
Die Deviation gilt nicht nur als maßgeblicher physikalischer Parameter zur Beschreibung des stereoskopischen Effektes, sondern bringt auch die Art und Intensität der beobachteten Raumwirkung eines Stereogramms zum Ausdruck (Abb. 1.2). Bei einem Stereobildpaar wird die absolute Devia- tion (d) nach der simplen Gleichung d = xl - xr ermittelt, wobei xl den Ab- stand zwischen beliebigem Punkt und rechter Vertikalkante des linken Halbbildes, xr hingegen den Abstand zwischen korrespondierendem Punkt und rechter Vertikalkante des rechten Halbbildes bezeichnet. Bei einer horizontalen Kantenlänge (L) der Halbbilder von 65 mm belaufen sich optimale Absolutdeviationen auf einige Millimeter. In der Optik kommt es häufig auch zur Definition der sogenannten relativen Devia- tion, welche das mathematische Verhältnis zwischen absoluter Deviation und Länge der horizontalen Bildkante beschreibt. Im Idealfall nimmt die- ser Parameter Werte zwischen 1 und 3 % an [1-3, 12].
Aus der obigen Formel lässt sich wiederum ablesen, dass die absolute Deviation für xl > xr positive Werte und für xl < xr negative Werte an- nimmt. Im Falle einer positiven Deviation werden einzelne auf den Halb- bildern dargestellte Objekte hinter die Bildebene oder das sogenannte Scheinfenster versetzt. Bei einer negativen Deviation hingegen werden die Gegenstände aus der Bildebene herausgehoben (Abb. 1.2, 1.3). Eine Steigerung der absoluten beziehungsweise relativen Deviation führt zu einer Intensivierung dieser Effekte. Zu hohe Deviationswerte haben je- doch den Verlust der Fähigkeit des Gehirns zur Bildfusion zur Folge [1].
Abbildung 1.3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bildbeispiel zur Wirkung der Deviation: (a) Positive Deviation mit Versetzung einzelner Elemente hinter die Bildebene, (b) negative Deviation mit Heraushebung einzelner Elemente aus der Bildebene.
1.3 Aufnahme und Betrachtung elektronenmikro- skopischer Stereobilder
In der Rasterelektronenmikroskopie stehen zwei unterschiedliche Mög- lichkeiten zur Herstellung von Stereobildern zur Verfügung. Bei der klas- sischen Methode wird die Position des Untersuchungsobjektes relativ zum Elektronenstrahl durch einfaches Kippen des Probenhalters verän- dert (Abb. 1.4). Der auf den Träger aufgebrachte Gegenstand wird nach entsprechender Vorbehandlung und Einführung in das Mikroskop zu- nächst in die gewünschte Ausgangsposition gebracht und unter Zuhilfe- nahme des angeschlossenen Bildgebungssystems fotografiert. Danach erfolgt ein geringfügiges Schwenken des Probenhalters, wobei sich der Kippwinkel zur weitgehenden Vermeidung von Abbildungsfehlern auf 3 bis 5° belaufen sollte [13-20]. Von dem neu positionierten Objekt wird nun das zweite Halbbild angefertigt, welches mit der ersten Aufnahme zu einem Stereogramm kombiniert werden kann. Bei diesem Bilderzeugungs- verfahren ist stets zu berücksichtigen, dass beide Aufnahmen unter iden- tischen Bedingungen (Beschleunigungsspannung, Strahlstrom) getätigt wurden. Zudem ist von der Erzeugung jeglicher Vertikalparallaxe, wie sie etwa durch zusätzliche Drehung oder Verschiebung des Probenträgers entstehen kann, abzusehen [13, 14].
Ein alternatives Verfahren sieht die computerunterstützte Erzeugung von Stereobildern aus einer einzelnen elektronenmikroskopischen Fotografie vor. Diese Methode kann überall dort ihre Anwendung finden, wo altes Bildmaterial von nicht mehr vorhanden Proben vorliegt, welches einer modernen stereoskopischen Bearbeitung unterzogen werden soll. Gene- rell steht für diesen Zweck bereits eine große Auswahl an Computerpro- grammen zur Verfügung, die sich durch eine mehr oder weniger große Benutzerfreundlichkeit auszeichnen. Die auf einem einzelnen Flachbild basierende Generierung eines Raumbildes wird gleichermaßen durch kommerzielle und frei verfügbare Software ermöglicht [21, 22].
Abbildung 1.4
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Klassisches Verfahren zur Aufnahme von elektronenmikroskopischen Stereobildern.
Als ein kostenlos erhältliches und leicht zu bedienendes Computerpro- gramm mit der oben angesprochenen Fähigkeit gilt die von H. Cypionka entwickelte Software mit der Bezeichnung PICOLAY [21]. Dessen eigentli- che Funktion besteht in der Herstellung von Stereobildern aus sogenann- ten Bildstapeln, welche durch die Fotografie transparenter Objekte unter stetiger vertikaler Verschiebung der Fokusebene entstehen. Zusätzlich bietet das Programm die Produktion eines imaginären Bildstapels auf Ba- sis einer Einzelfotografie an, wobei dieser theoretisch berechnete Stapel wiederum als Grundlage für stereoskopische Transformationsverfahren anzusehen ist [13, 14, 21, 22].
Voraussetzung für die Modellierung eines Bildstapels ist die Bereitstellung von Tiefeninformation. Die Funktion von PICOLAY gründet hier auf der Hypothese, dass bei frontaler Beleuchtung des Objektes durch ver- schiedene physikalische Effekte eine kontinuierliche Helligkeitsabnahme vom Vorder- zum Hintergrund des zugehörigen Bildes entsteht. Dieser Helligkeitsgradient kann für die Berechnung einer Objekttiefenkarte (ob- ject depth map oder ODM) genutzt werden, aus welcher sich verschie- dene Ebenen herausextrahieren lassen. Damit liegt letztlich der gewünsch- te und stereoskopisch verwertbare Bildstapel vor. Das Programm bietet anhand der Objekttiefenkarte die Möglichkeit einer geringfügigen Dre- hung des abgebildeten Objektes und einer Erzeugung von rotationsba- sierten Stereogrammen. Dazu ist es allerdings notwendig, die Verläufe von teilweise sichtbaren Oberflächen oder Strukturen durch entspre- chende Renderverfahren zu extrapolieren. Gerade dieser Schritt kann bei komplex gestalteten Gegenständen zahlreiche Fehler in sich bergen, wo- durch es im resultierenden Stereobild zu etlichen Ungenauigkeiten der Darstellung kommen kann [13, 14]. Hier ist der Benutzer durch eigenstän- diges Experimentieren mit den Programmeinstellungen aufgefordert, die für das jeweilige Bild optimale stereoskopische Lösung herauszufinden. Bei der Betrachtung von Stereobildpaaren ist grundsätzlich zwischen der Verwendung von optischen Hilfsmitteln und sogenannten autostereosko- pischen Methoden zu unterscheiden. Zu den wichtigsten Betrachtungs- geräten von klassischen Stereogrammen zählen das bereits angesproche- ne Stereoskop und die etwas handlichere Stereobrille. Werden die beiden Halbbilder in eine Rot-Cyan-Anaglyphe transformiert, ist zur Wahrneh- mung des dreidimensionalen Effektes eine entsprechende Farbbrille he- ranzuziehen. Stereoskop und Stereobrille besitzen die primäre Aufgabe, jedes Auge auf das ihm zugewiesene Halbbild zu lenken, so dass eine ge- trennte Inspektion von linker und rechter Fotografie erfolgen kann. Zu diesem Zweck gelangen im Allgemeinen zwei physikalische Prinzipien zur Anwendung. Beim Spiegelstereoskop werden die von den Halbbildern ausgehenden Lichtstrahlen an speziellen Spiegelkonstruktionen reflek- tiert, wodurch eine strikte Trennung der von den beiden Fotografien aus- gesandten Lichtinformation stattfindet. Im Endeffekt bekommt das linke Auge lediglich das linke Halbbild, das rechte Auge hingegen nur das rechte Halbbild zu sehen. Kleinere Stereoskope und Stereobrillen verfü- gen über zwei nebeneinander angeordnete und gleichsam als Brillenglä- ser fungierende Fresnel-Prismen, an denen die von den Bildern ausge- henden Lichtstrahlen eine zweifache Brechung erfahren. Beim Eintritt des Lichtes in das jeweilige Prisma kommt es zu einer Brechung zum Lot, wo- hingegen der Lichtaustritt aus dem Prisma durch eine Brechung vom Lot begleitet wird. Als Resultat dieses Phänomens empfängt das linke Auge wiederum lediglich die Lichtinformation des linken Halbbildes und das rechte Auge die entsprechende Information des rechten Halbbildes [1-3]. Bei den autostereoskopischen Betrachtungstechniken kann eine Unter- scheidung zwischen Parallel- und Kreuzblick getroffen werden (Abb. 1.5). Im ersten Fall werden die Sehachsen der beiden Augen entspre- chend dem Namen der Technik parallel zueinander ausgerichtet, so dass das linke Auge nur noch das linke Halbbild erblickt und das rechte Auge lediglich noch das rechte Halbbild in den Blick nimmt. Die Betrachtungs- methode kann dadurch effizient unterstützt werden, dass man einen als Trennwand zwischen den beiden Sehachsen fungierenden Gegenstand an das Gesicht hält. Im einfachsten Fall kann auch die Handfläche als ent- sprechendes Hilfsmittel herangezogen werden. Durch die gezielte Aus- richtung der optischen Achsen auf korrespondierende Punkte der beiden Halbbilder tritt der bereits beschriebene Bildfusionsprozess mit der Ent- stehung eines zentralen Raumbildes auf. Der Parallelblick setzt voraus, dass der horizontale Abstand zweier zusammengehörender Bildpunkte etwa dem Augenabstand (65 mm) entspricht. Wird diese Distanz überschritten, nehmen die Augen eine Divergenzstellung ein, welche den Verschmelzungsprozess verhindern kann [1-3].
Abbildung 1.5
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Autostereoskopische Betrachtungsmethoden, welche relativ leicht erlernbar sind und zu unterschiedlichen bildlichen Resultaten führen.
Der Kreuzblick zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass das linke Auge auf das rechte Halbbild, das rechte Auge hingegen auf das linke Halbbild gelenkt wird. Zu diesem Zweck sind die Augen in eine extreme Konvergenzstellung (Schielen) mit entsprechender Überkreuzung der op- tischen Achsen zu bringen. Um diese ungewohnte Augenstellung zu erreichen, nimmt man den Zeigefinger der rechten Hand zu Hilfe. Man hält den Kopf senkrecht über das Stereogramm gebeugt und setzt den Finger zunächst an der Nasenspitze an. Nun führt man den Finger langsam von der Nase in Richtung Stereobildpaar, wobei man seinen Blick stets auf die Fingerspitze richtet. Wenn der Finger einen gewissen Abstand zur Bild- ebene aufweist, beginnt sich aufgrund der Schielstellung der Augen all- mählich ein zentrales Raumbild aufzubauen, welches die gewünschte dreidimensionale Information enthält. Die große Kunst dieser Blicktechnik besteht nun darin, die Augenposition nach Entfernung des Fingers beizu- behalten und die optischen Organe dabei nur mäßigen Anstrengungen auszusetzen. Grundsätzlich besitzt der Kreuzblick gegenüber dem Paral- lelblick den Vorteil, dass die Abstände zwischen zwei korrespondierenden Bildpunkten wesentlich größer als der Augenabstand sein können. Als Nachteile sind hingegen die ungewohnte Augenstellung und die Erzeu- gung eines verkleinerten Raumbildes anzusehen [1-3]. Diese beiden Phä- nomene haben zur Folge, dass eine länger dauernde Betrachtung der Stereogramme für wissenschaftliche Zwecke relativ schwerfällt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kapitel 2 Biologie
In diesem Kapitel soll zunächst der Frage nachgegangen werden, in- wieweit sich stereoskopische Techniken in den einzelnen biologischen Disziplinen bislang etablieren konnten. Zahlreiche wissenschaftli- che Felder wie Entomologie, Arachnologie, Mikrobiologie oder Zellbio- logie bedienen sich einer Vielzahl an optischen Verfahren, unter wel- chen die Licht- und Elektronenmikroskopie eine übergeordnete Posi- tion einnehmen. Gerade in den vergangenen Jahrzehnten hat die Ent- wicklung immer neuer mikroskopischer Techniken und Komponenten dazu geführt, dass die Abbildungsqualität insgesamt einer signifikan- ten Steigerung zugeführt und die Auflösungsgrenze sukzessive nach unten verschoben werden konnte. Da im Rasterelektronenmikroskop einzelne biologische Objekte durch Schwenken des Probenträgers zwar dreidimensional betrachtet werden können, diese wertvolle Bildinfor- mation jedoch lange Zeit nicht auf betreffenden Fotografien abgespei- chert wurde, bot die Stereoskopie insbesondere in den letzten Jahren eine willkommene Hilfestellung, deren wissenschaftlicher Nutzen nach wie vor zur Diskussion steht. Anhand von umfangreichem Bildmaterial soll hier geklärt werden, ob die stereoskopische Visualisierung das Potenzial zur Lösung komplexerer Forschungsfragen mitbringt.
2.1 Die Biologie und ihre Verwendung von licht- und elektronenmikroskopischen Methoden
Die Biologie stellt die einzelnen Lebewesen in ihren Mittelpunkt und re- präsentiert damit ein Teilgebiet der Naturwissenschaften. Im Allgemeinen befasst sie sich mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen und versucht dabei vor allem, die Spezifitäten verschiedener Organismen herauszuarbeiten. Die Biologie gliedert sich aufgrund ihrer Komplexität in zahlreiche Disziplinen auf, unter welchen die Zoologie, Botanik und Mikrobiologie eine übergeordnete Stellung einnehmen, die Genetik, Molekularbiologie, Zellbiologie, Ökologie und Biophysik jedoch ebenfalls von entscheidender Bedeutung sind [23, 24].
Die Geschichte der biologischen Wissenschaft reicht bis in die Antike zu- rück. Bereits der Naturphilosoph Thales von Milet sah im Wasser den Ur- sprung aller Dinge, womit er den modernen Theorien zur Evolution des Lebens vorgriff [25]. In den nachfolgenden Jahrhunderten und im Mittelal- ter blieb die Biologie auf Naturbeobachtungen beschränkt und verzich- tete dabei auf jeglichen experimentellen Zugang. Die zum damaligen Zeit- punkt aufgestellten Theorien wurden noch sehr stark von der Vier-Ele- mente-Lehre und vom biblischen Schöpfungsmythos beeinflusst [26]. Erst mit dem Einsetzen der wissenschaftlichen Revolution in der Neuzeit wand- te man sich wieder sukzessive vom Übernatürlichen ab. In dieser Epoche wurde mit der Entwicklung einer Vielzahl an Methoden und technischen Apparaturen begonnen, welche die biologische Forschung der nachfol- genden Jahrhunderte in entscheidendem Maße prägen sollten [27].
Im 19. Jahrhundert führten unter anderem die Arbeiten eines Gregor Mendel an Pflanzenkreuzungen und die Werke der Evolutionstheoretiker Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin und Alfred Russel Wallace dazu, dass die biologische Naturforschung eine kontinuierliche Verwissen- schaftlichung im heutigen Sinne erfuhr. Der Begriff der Biologie fand an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert seine erstmalige Erwähnung, wobei eine umfassendere Prägung dieses Terminus durch den deutschen Anatomen und Physiologen Karl Friedrich Burdach erfolgte [28]. Die mo- derne Biologie des 20. Jahrhunderts vermochte in immer kleinere Dimen- sionen vorzudringen, wodurch es zur stetigen Entwicklung neuer Teildis- ziplinen wie Zell- und Molekularbiologie oder Gentechnik kam [23, 24].
Zu den wesentlichen Arbeitsmethoden der Biologie zählen neben dem strukturierten Beobachten insbesondere die mikroskopische und fotogra- fische Dokumentation von natürlichen Objekten und Prozessen. Im 19. Jahrhundert konnte sich das Lichtmikroskop als wichtiges technisches Hilfsmittel zur Beobachtung von kleineren Strukturen wie Zellen und Zell- organellen dauerhaft etablieren. Diese Stellung behielt das Gerät bis zum heutigen Tage im Wesentlichen bei. In den vergangenen Jahrzehnten er- folgte durch die Entwicklung immer neuer Verfahren (z. B. Fluoreszenz- mikroskopie, Interferenzkontrastmikroskopie, Laser-Scanning-Mikrosko- pie) eine fortwährende Modernisierung des lichtmikroskopischen Verfah- rens. Zudem trat die nach wellenoptischen Gesetzmäßigkeiten funktio- nierende Elektronenmikroskopie zum Methodenspektrum hinzu und zählt mittlerweile zum technischen Standard der biologischen Forschung. Während die Rasterelektronenmikroskopie (REM) die Untersuchung klein- ster oberflächlicher Strukturen ermöglicht und damit gleichermaßen für die Strukturbiologie und biologische Systematik zu einem essenziellen Verfahren gerät, gelingt mit der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) ein Einblick in die Ultrastruktur von Zellen mit der Darstellung win- ziger zellulärer Bestandteile (z. B. DNS, Ribosomen, Membranen, Mikrotu- buli) [5, 13, 14, 29].
Als neue Errungenschaft der hochauflösenden Bildgebungsverfahren kann das Helium-Ionen-Mikroskop angesehen werden, bei dem das zu untersuchende Objekt mit einem Helium-Ionenstrahl abgetastet wird. Das Gerät zeichnet sich im Vergleich zu anderen Focused-Ion-Beam-Mi- kroskopen dadurch aus, dass die Heliumionen infolge ihrer geringen Masse nur minimale Sputtereffekte erzeugen und dadurch zu einer ver- nachlässigbaren Zerstörung der Objektoberfläche führen. Die Abbe’sche Auflösungsgrenze, welche von der De-Broglie-Wellenlänge des Teilchen- strahls bestimmt wird, ist beim Helium-Ionen-Mikroskop noch deutlich geringer als beim Elektronenmikroskop, wodurch man mit der Visualisierung sogar auf die atomare Ebene hinabsteigen kann. Ein weiterer Vorteil des Gerätes besteht in der Erzeugung exzellenter Tiefenschärfen und der geringfügigeren Schädigung von Polymeren[30]. Es ist anzunehmen, dass die Ionenmikroskopie in den kommenden Jahren sukzessive an die Stelle der Elektronenmikroskopie treten wird.
Abbildung 2.1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Stereoskopische Fotografie einer Schwebfliege, welche sich auf dem Blatt einer Stechpalme platziert hat.
Abbildung 2.2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Stereoskopische Fotografie des Blütenstandes der Passionsblume.
2.2 Bedeutung und Anwendung stereoskopischer Techniken in der Biologie
Die stereoskopische Bildgebung verfügt in der Biologie und ihren einzel- nen Disziplinen nicht über jene lange Tradition, wie sie etwa für die Me- teorologie, Topografie oder Archäologie konstatiert werden kann. Den- noch ist es ihr vor allem in den letzten Jahrzehnten gelungen, ihren Stel- lenwert in der biologischen Forschung kontinuierlich anzuheben [1-3, 29, 31-33]. Die 3D-Fotografie etablierte sich zunächst in der makroskopi- schen Welt, wobei entsprechende Raumbilder von verschiedensten tieri- schen und pflanzlichen Lebewesen angefertigt wurden (Abb. 2.1, 2.2).
Abbildung 2.3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lichtmikroskopische Stereofotografie des räuberischen Ostrakoden Daphnia sp. Anhand des Raumbildes kann ein plastischerer Eindruck des entsprechenden Objektes gewonnen werden. Zudem lassen sich einzelne Strukturen wesentlich besser differenzieren.
Seit den 1980er Jahren drang das Verfahren auch vermehrt in den Mikrokosmos vor. Mithilfe spezieller technischer Methoden wurden zunächst lichtmikroskopische Stereofotografien erzeugt, welche Kleinlebewesen oder einzelne Organe zur Darstellung bringen (Abb. 2.3). In weiterer Fol- ge breiteten sich die Verfahren der dreidimensionalen Bildgebung auch auf die Elektronenmikroskopie mit ihrem gesteigerten Auflösungsvermö- gen aus [31-33]. Gegenwärtig ist wohl davon auszugehen, dass die Ste- reoskopie dauerhaft in der Biologie ihren Platz finden und früher oder später in den Kanon der Standardmethoden aufgenommen wird. Deshalb wird mancherorts bereits eine Diskussion über jene zukünftige Verwen- dung der Raumfotografie geführt, welche über den Charakter der reinen Präsentation hinausgeht.
2.3 Bildbeispiele aus verschiedenen Forschungsbe- reichen der Biologie
Als besonders beliebte Motive der biologischen Elektronenmikroskopie gelten alle Arten von Milben (Acari), bei denen es sich um eine Unterklas- se der Spinnentiere (Arachnida) handelt. Mit ungefähr 50.000 Arten stel- len sie die größte Gruppe innerhalb der Spinnentiere dar. Aufgrund ihrer entfernten Verwandtschaft besitzen Milben einen ähnlichen Körperbau wie Spinnen (Bild 1, 2). Ihre Größe schwankt zwischen 0,1 mm und, im Falle von vollgesogenen Zeckenweibchen, 3 cm. Die Fortbewegung der Tiere erfolgt absolut betrachtet relativ langsam, weshalb sie andere Orga- nismen wie beispielsweise Insekten als Transportmittel benutzen (Phore- sie), um dadurch größere Distanzen überwinden zu können. Während ih- res Transfers saugen sich einige Milbenspezies an den Wirt an und er- nähren sich von dessen Körpersäften [34-36].
Rund die Hälfte aller Milbenarten lebt im Boden, wobei unter optimalen Umgebungsbedingungen Besiedlungsdichten von einigen hunderttausend Individuen pro m² erreicht werden können. Viele Milben nisten sich im Feder- oder Haarkleid fremder Organismen ein. Auch die meisten Menschen beherbergen diese Tiere, so etwa Haarbalgmilben an der Haarwurzeln der Augenwimpern[35]. Milben verfolgen höchst unterschiedliche Lebensweisen: Neben räuberischen Arten gibt es solche, die sich von Pflanzen oder Pilzen ernähren, und solche, die von Aas oder abgestorbenem Gewebe leben. Ein Großteil der Spezies lebt jedoch parasitär auf fremden Organismen [34-36].
Einem breiteren Publikum sind die Milben vor allem wegen ihrer Schad- wirkung bekannt geworden. Die Tiere treten beispielsweise als Vorrats- schädlinge in Mehl- und Getreidelagern auf und stellen dadurch für die regionale Landwirtschaft ein teils massives Problem dar. Ebenso bedeut- sam ist ihre Rolle als Krankheitsverursacher. Ausscheidungen von Haus- staubmilben können beim Menschen Hausstauballergien auslösen, wäh- rend Grabmilben das Krankheitsbild der Krätze (Mensch) beziehungswei- se Räude (Tier) hervorrufen können. Milben fungieren freilich nicht nur als Krankheitserreger, sondern auch als Überträger von Krankheiten wie Fleckfieber, virale Hirnhautentzündung oder Borreliose [34].
Auch Ameisen haben in den vergangenen Jahrzehnten ihren vermehrten Eingang in die Elektronenmikroskopie gefunden, da viele ihrer Merkmale nur bei entsprechenden Vergrößerungsstufen dokumentiert werden kön- nen (Bild 3). Im Allgemeinen bilden diese Insekten eine eigene, aus mehr als 13.000 Arten bestehende Familie innerhalb der Ordnung der Haut- flügler (Hymenoptera). Die bis zu 2 cm großen Tiere leben vor allem in den tropischen, subtropischen und gemäßigten Klimazonen der Erde, wobei alle bekannten Arten in Staaten organisiert sind und die bedeu- tendste Gruppe eusozialer Insekten darstellen. Ameisen bilden eine Viel- zahl an unterschiedlichen Lebensweisen aus, unter denen die nomadische Jagd sowie das Auftreten als Sammler und Züchter in besonderer Weise hervorzuheben sind [37].
Ameisen zeigen einen typischen dreigliedrigen Körperbau, wobei die geknieten Antennen als ihre wichtigsten und vielfältigsten Sinnesorgane gelten. Diese dienen in erster Linie zum Tasten, Riechen und Schmecken, werden aber auch zur Wahrnehmung von Temperaturänderungen, Luft- strömungen und Kohlendioxidgradienten in der Luft verwendet. Der Kopf der Tiere verfügt über kleine, gut ausgebildete Komplexaugen und kau- ende Mundwerkzeuge, die ihnen die Zerkleinerung fester Nahrung we- sentlich erleichtert [38].
Eine gänzlich andere Kopfmorphologie liegt bei den Schmetterlingen (Lepidoptera; Bild 4) vor, welche über einen langen, eingerollten Saug- rüssel, große Komplexaugen und ebenso mächtige Antennen verfügen. Auffällig ist zudem die dichte Bedeckung der Körperabschnitte mit feinen Sinneshärchen und Schuppen, welche als charakteristisch für diese Insek- tengruppe gelten [39].
Bei Insekten und Spinnen sind die lokomotorischen Extremitäten nahezu identischen aufgebaut. Grundsätzlich lässt sich eine Fünfgliedrigkeit der Gliedmaßen konstatieren, wobei von oben nach unten die Hüfte (Coxa), der Schenkelring (Trochanter), der Schenkel (Femur), die Schiene (Tibia) und der Fuß (Tarsus) unterschieden werden können. Der Fuß besteht ge- wöhnlich aus fünf weiteren Abschnitten (Tarsomere) und einem Endstück. Das erste Fußglied besitzt auch die Bezeichnung Fersenglied (Metatar- sus), während das letzte Fußglied als Krallen- oder Klauenglied bezeich- net wird. Am als Prätarsus benannten Endglied befinden sich in der Regel Krallen und Haftpolster, welche die Tiere dazu befähigen, sich an glatten Oberflächen anzuheften [39, 40].
Je nach Art der Fortbewegung kann eine Unterscheidung der lokomotori- schen Extremitäten in Lauf-, Sprung-, Schwimm-, Fang-, Grab- oder Sam- melbein getätigt werden. Grundsätzlich ist das Bein als Teil des Außen- skeletts aufzufassen, wobei einzelne für die Bewegung zuständige Mus- keln über Sehnen an seiner harten Chitinhülle ansetzen. Die Verbindung der einzelnen Beinglieder erfolgt durch weichere Gelenkhäute. Zwischen Schenkel und Schiene wird durch die Muskelbewegung lediglich ein Beu- gen und Strecken ermöglicht, während der Schenkelring auch eine Dre- hung gestattet. Im Tarsus selbst liegt keine Muskulatur vor, so dass die Bewegung der Krallen über die in Schenkel und Schiene sitzenden Mus- keln und ein langes Sehnensystem zu erfolgen hat. Die Beine können be- wegliche Dornen besitzen, welche ebenfalls mit entsprechender Muskula- tur verbunden sind [40].
Die Bildbeispiele zeigen den tarsalen Beinabschnitt der Blumenspinne Diaea sp. (Bild 5, 14) und der Fruchtfliege Drosophila melanogaster (Bild 6). Im ersten Fall sind die Klauen überproportional stark ausgeprägt, wo- durch dem Tier eine feste Verbindung mit dem Untergrund ermöglicht wird. Im zweiten Fall sind die Klauen eher zart gehalten, was dafürspricht, dass sie keine übergeordnete Funktion für das Insekt besitzen.
Die Tau- oder Fruchtfliege, welche in Mitteleuropa eine weite Verbreitung besitzt, verfügt auch über das für Insekten charakteristische Facetten- oder Komplexauge (Bild 7, 8). Dieses optische Sinnesorgan zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass es aus zahlreichen Einzelaugen (Ommati- dien) zusammengesetzt ist, wodurch das Tier ein Bild seiner Umgebung aus einzelnen Bildpunkten generieren kann. Grundsätzlich befinden sich die Facettenaugen an den beiden Seiten des Insektenkopfes, weshalb sie ab und zu auch die Bezeichnung „Seitenaugen“ tragen. Sie besitzen nä- herungsweise die Gestalt einer Halbkugel, wodurch jedes ihrer Ommati- dien in eine geringfügig andere Richtung orientiert ist. Die Größe der Au- gen hängt im Wesentlichen mit der Lebensweise ihrer Träger zusammen, wobei schnell fliegende und/oder räuberische Insektenarten die mit Ab- stand größten optischen Sinnesorgane entwickeln. Die Komplexaugen sind starr mit der Kopfkapsel verbunden und können deshalb im Gegen- satz zu den Augen der Säugetiere nicht bewegt werden [39, 41].
Die Anzahl der Ommatidien schwankt von Spezies zu Spezies und oftmals auch zwischen den Geschlechtern einer Art. Manche Insekten besit- zen Komplexaugen mit weit weniger als hundert Einzelaugen, während andere entsprechende Sinnesorgane mit mehreren tausend Ommatidien entwickeln. Der dioptrische Apparat eines Einzelauges setzt sich aus einer Chitinlinse und einem darunterliegenden Kristallkegel zusammen. Das Licht fällt nun durch die Linse ins Auge und erreicht anschließend den Kristallkegel, von wo es weiter zu den Sehstäbchen (Rhabdome) geleitet wird. Diese werden von lichtempfindlichen Sehzellen mit entsprechenden Sehpigmenten eingehüllt. Am basalen Ende jedes Ommatidiums werden die optischen Wahrnehmungen über Nervenfasern der nachgeschalteten Neuronen zum Gehirn weitergeleitet. Je nach Aufbau und neuronaler Ver- schaltung werden drei Typen von Facettenaugen unterschieden, nämlich die Appositionsaugen bei Taginsekten, die optischen Superpositionsau- gen bei Nachtinsekten und die neuronalen Superpositionsaugen bei schnell fliegenden Insekten [41].
Als Fühler oder Antennen wird das am Kopf der meisten Arthropoden an- setzenden, gegliederten Extremitätenpaar bezeichnet, welches mit zahl- reichen Sinneshärchen und Geruchsorganen ausgestattet ist. Grundsätz- lich ist zwischen Glieder- und Geißelantennen zu unterscheiden, wobei der erste Typus nicht bei Insekten beobachtet werden kann und sich durch die Beweglichkeit jedes einzelnen Gliedes auszeichnet. Die für Kerb- tiere typische Geißelantenne setzt sich aus einem oftmals vergrößerten Basalglied (Scapus), einem vielfach sphärischen Wendeglied (Pedicellus) und der Geißel (Flagellum) zusammen, welche eine unterschiedliche An- zahl variabel geformter Geißelglieder (Flagellomere) enthält [39, 42].
Die Geißelantenne der Insekten wird im Allgemeinen mit Hämolymphe versorgt und ist von zahlreichen Tracheen durchzogen. Der Scapus sitzt in einer pfannenartigen Vertiefung der hart sklerotisierten Kopfkapsel und ist in alle Richtungen beweglich. Während die ersten beiden Segmente über eine entsprechende Muskulatur verfügen, beinhaltet die Antennengeißel keine eigenen Muskeln, kann aber durch die Bewegung der Grundglieder in ihrer Lage verändert werden. Die Anzahl der Geißelglieder variiert zwischen 1 und 150, wobei die meisten Käfer über 11 derartige Segmente verfügen[42].
Die Antennen der Insekten sind mit einer Vielzahl an Sinnesorganen besetzt, unter denen Tast- und Geruchssensillen eine besondere Rolle spielen. Dies zeigt sich beispielsweise bei einem elektronenmikroskopischen Stereobild der Antennenoberfläche der Wespe (Bild 9). Hier treten abwechselnd feine Trichobothrien und olfaktorische Organe auf, die dem Insekt eine entsprechend hohe Sinnesleistung bescheren. Die dreidimensionale Fotografie liefert einen wesentlich besseren Eindruck von dieser komplex gestalteten Oberfläche. Dies gilt auch für die an den Fühlern sitzenden Sinneshärchen der Bartmücke (Bild 10) und die Fühleroberfläche des Tagpfauenauges (Bild 12), bei welcher abwechselnd chemische Sinnesorgane und sehr feine Schuppen auftreten.
Die bereits mehrfach angesprochenen Schuppen können als determinati- ve Merkmale der Schmetterlinge (Lepidoptera) angesehen werden. Grund- sätzlich treten diese auf den Flügeloberflächen auf und werden oftmals auch als „Schmetterlingsstaub“ bezeichnet. Sie können aber auch auf Kopf-, Brust- und Hinterleibsabschnitt sowie auf den Genitalien ausgebil- det sein. Schuppen sind in den meisten Fällen Hohlstrukturen und kön- nen in drei Klassen eingeteilt werden: (1) dachpfannenförmige (lamelläre) Schuppen, (2) haarförmige (piliforme) Schuppen, (3) andere Formen [43]. Als Hauptmaterial der Schuppen tritt das Chitin auf, welches letztendlich für die physikalischen und strukturellen Eigenschaften des Objektes ver- antwortlich zeichnet. Wie an einzelnen Schuppen des Tagpfauenauges (Bild 11) recht gut demonstriert werden kann, weist die äußere (obere) Oberfläche der Objekte eine feine Strukturierung auf, wohingegen die aufliegende Seite glatt ist [43]. Neben der typischen Färbung kann es auch zur Entwicklung von UV- und Polarisationsmustern kommen. Zudem erzeugen die Schuppen nicht selten spezifische Reflexionseffekte, welche zur Vermittlung innerartlicher Signale über größere Sichtentfernungen dienen. Die von den Schuppen hervorgerufene Flügelmusterung besitzt mehrere Funktionen, unter denen Tarnung, Mimese, Warnzeichen, Mimi- kry und Partnerwahl besonders hervorzuheben sind. Zuletzt sei in diesem Zusammenhang noch die Bedeutung dieser Objekte hinsichtlich des Auf- triebs, der Tarnung des Geleges und der Wärmespeicherung genannt [39, 43].
Die cuticuläre Körperoberfläche des Kurzflügelkäfers (Familie Staphylinidae) ist durch stachelartige Strukturen gekennzeichnet (Bild 13), welche ebenfalls eine Funktion als Tastsinn erfüllen und auf einem unregelmäßig geformten Untergrund aufsitzen. Die Tiere bewohnen hauptsächlich steinigen oder sandigen Boden und sind deshalb zu einer ständigen sensorischen Erkundung ihrer Umwelt gezwungen.
Als beliebtes Untersuchungsobjekt der Arachnologie gilt zweifelsohne die Zebraspringspinne (Salticus scenicus), welche von der Deutschen Arach- nologischen Gesellschaft (DAG) zur Spinne des Jahre 2005 gewählt wurde und ihren Namen der schwarz-weißen Zeichnung verdankt. Als ein weite- res auffälliges Merkmal des etwa 1 cm großen Tieres gelten die beiden großen Frontaugen, die seitlich von etwas kleineren Augen flankiert wer- den (Bild 15). Diese spezielle Anordnung der optischen Sinnesorgane er- möglicht den Spinnen einerseits eine wesentlich bessere Sicht im Nahbe- reich und andererseits einen Rundumblick und das Erkennen von hinter dem Tier lauernden Gefahren [44]. Bei der Jagd nähert sich die Zebra- springspinne langsam an ein Insekt an und springt von relativ großem Abstand auf das Beutetier, welches sofort mit einem gezielten Giftbiss getötet wird. Das Insekt wird solange mit den kräftigen Beinen festgehal- ten, bis die Wirkung des Giftes einsetzt. Vor seinem Sprung sichert sich das Tier mit einem Faden, so dass es nach missglücktem Angriff wieder an seinem Ausgangspunkt zurückkehren kann [44, 45].
Die Wolfspinne (Familie Lycosidae) stellt in der Arachnologie ein ebenso spannendes Objekt wie die Springspinne dar. Sie zählt zu den ungefährli- chen „Taranteln“ und fällt insbesondere durch den stark behaarten Kör- per, die vergrößerten Mittelaugen und die sehr kräftigen Kieferklauen auf, welche in seltenen Fällen die menschliche Haut durchdringen können (Bild 16) [45]. Heimische Wolfspinnen bewohnen zumeist Erdhöhlen, die sie mit Spinnseide auskleiden. Auch die Krautschicht und der Zwischen- raum von Steinen werden als Habitate genutzt, wobei sich die Tiere hier spezielle Wohngeniste anlegen. In der Nacht verlassen die Spinnen ihr Versteck und begeben sich auf die Jagd. Im Gegensatz zu den Spring- spinnen agieren Wolfspinnen als reine Lauerjäger, welche an günstigen Plätzen auf ein vorbeikommendes Insekt warten und dieses mit ihren großen Klauen ergreifen. Manche Arten besitzen die Fähigkeit, ihre Beu- tetiere auf der glatten Wasseroberfläche zu verfolgen [45].
Zu den wesentlichen Sinnesorganen der Spinnentiere zählt das soge- nannte Lyraförmige Organ (Lyriformes Organ), bei welchem mehrere Spaltsinnesorgane parallel zueinander angeordnet sind und der Wahr- nehmung von Schwingungen in der Umwelt dienen. Dieses befindet sich in großer Anzahl auf dem gesamten Körper des Tieres, vor allem jedoch auf den lokomotorischen Extremitäten (Bild 17). Dadurch vermögen die Spinnen festzustellen, ob sich potenzielle Beutetiere oder Feinde in un- mittelbarer Nähe aufhalten. Das Lyraförmige Organ besitzt neben der er- läuterten Wahrnehmung von mechanischen Schwingungen zusätzlich noch die Aufgabe, Information über die Stellung der Gliedmaßen relativ zueinander zu liefern. Somit fungiert es auch als sogenannter Propriore- zeptor. Die einzelnen Spaltsinnesorgane sind grubenartige Vertiefungen in der Cuticula, die ihrerseits von einer dünnen Membran überzogen sind. Die Membran überträgt Verformungen, welche durch Druck auf die relativ starre Cuticula entstehen, auf zwei Nervenenden, die den Reiz an das Gehirn weiterleiten. Die Längen einzelner Spalte variieren in der Regel zwischen 15 und 120 μm [39, 44].
Zu den mechanischen Sinnesorganen der Spinnen zählen auch die Tri- chobothrien, bei denen es sich um sehr lange Tasthaare mit der Fähigkeit zur Wahrnehmung von Luftvibrationen handelt. Sinneshärchen treten ins- besondere an Beinen und Pedipalpen von Spinnentieren auf (Bild 18) und dienen bis zu einem gewissen Maße auch der Orientierung (Ortho- bothriotaxis) [45]. In Bezug auf ihre Struktur zeichnen sich die Organe durch feinste Härchen (Durchmesser: 5 bis 15 μm) aus, welche 100 bis 1.500 μm aus der Cuticulaoberfläche herausragen. Sie stehen über eine dünne, gespannte Membran mit der umgebenden Cuticula in Verbindung und lassen sich bereits durch geringste Luftbewegungen auslenken. Mit wachsender Länge der Härchen nimmt die Erregungsschwelle ab, so dass diese im Extremfall bei Luftgeschwindigkeiten von weit weniger als 1 mm/s liegt. Der Auslenkungswinkel wird durch den Rand der Cuticulagrube auf 25 bis 35° begrenzt[45].
Bei zahlreichen Vertretern der Orthopteren erfolgt die Übertragung der Spermatozoen vom Männchen zum Weibchen mithilfe einer sogenann- ten Spermatophore. Dabei handelt es sich um eine azelluläre, aus Kapsel (Ampulla), langem Schlauch und Ankerplatte bestehende Struktur, welche während des Kopulationsvorganges an der weiblichen Genitalöffnung fi- xiert wird. Der Schlauch wird in weiterer Folge in den Ductus receptaculi eingeführt, damit die in der Ampulla gelagerten Keimzellen in das Recep- taculum seminis (Spermatheka) transportiert werden können [46-50]. Bei der australischen Feldgrille Teleogryllus commodus nimmt die Ampulla ei- ne ellipsoide Gestalt an, wobei sich der äquatoriale Durchmesser auf un- gefähr 0,5 mm beläuft Wie im elektronenmikroskopischen Raumbild sehr schön zu erkennen ist, befindet sich die Spermienmasse in einer zentralen Kammer, welche von mehreren unterschiedlich dicken Membranen umgeben ist (Bild 19). An der Spitze der Spermatophore ist ein Druckkörper positioniert, der nach Vollzug des Paarungsprozesses seine Flüssigkeit an die Ampulla abgibt, was wiederum dazu führt, dass die Spermatozoen in relativ geregelter Art und Weise durch den Schlauch gedrückt werden [46-50].
[...]
- Quote paper
- Dr. Robert Sturm (Author), 2018, Stereofotografie in der Elektronenmikroskopie. Grundtechniken und Anwendungsfelder, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/450166