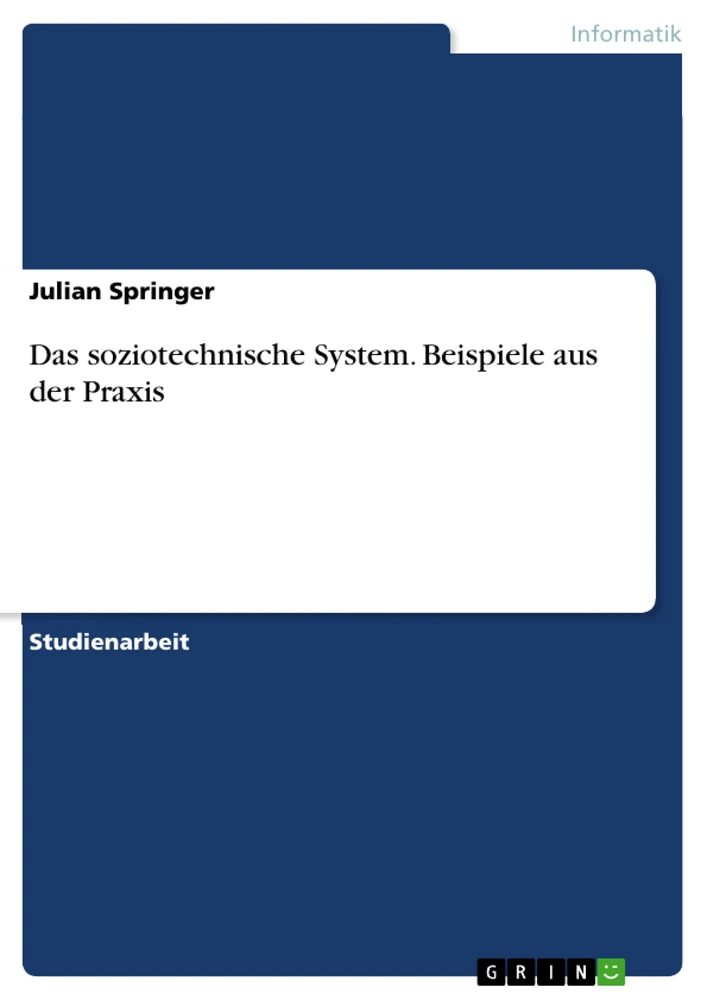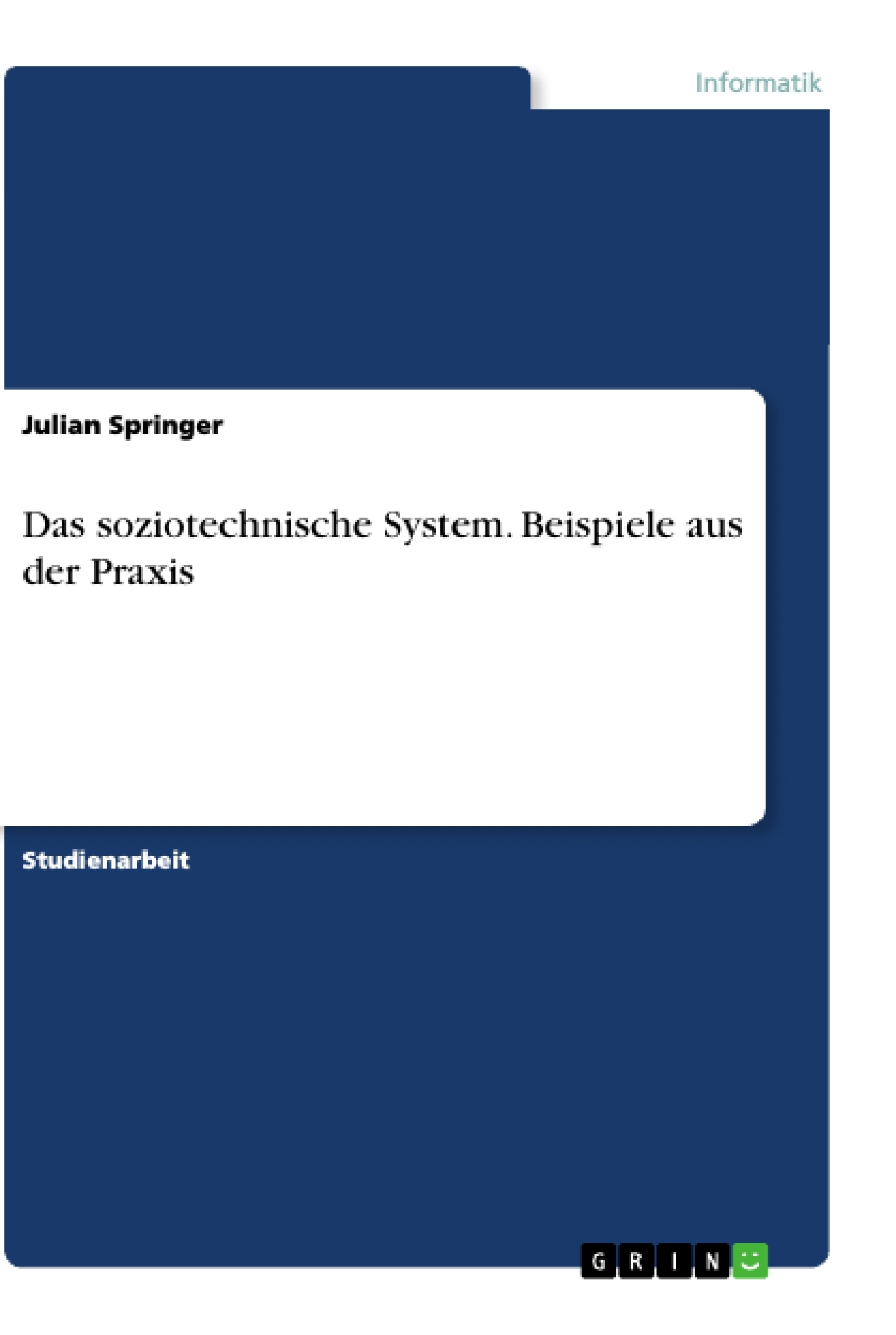Bei der Einführung von soziotechnischen Systemen muss jedes Unternehmen sein eigenes individuelles Konzept finden. Der Begriff wurde traditionell verwendet, um Technologien in ihrem sozialen Umfeld zu identifizieren. Heutzutage benutzt man den Begriff aber um Systeme, die mit Menschen, anderen Technologien, physischen Gegebenheiten, Prozessen und Informationen interagieren, zu identifizieren. Der größte Einfluss und zudem schwerste kalkulierbare Faktor sind die turbulenten Arbeitsumgebungen in denen Schwankungen und Störungen auftreten, die psychologisch eingeschätzt werden müssen. Die größte Herausforderung ist es diese Störungen des soziotechnischen Systems bereits in der Modellierung des individuellen Konzepts bestmöglich zu minimieren. Um die Lücke zwischen dem sozialen- und technischen Teilsystem so gering wie möglich zu halten, gibt es verschiedene Ansätze, wie man potenzielle Störungen am besten identifizieren kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Vorgehensweise
- Grundlagen
- Entstehung des soziotechnischen Systems
- Der soziotechnische Systemansatz
- Die Grundzüge des soziotechnischen Systems
- Vier Grundannahmen des soziotechnischen Systems
- Adaptionsfähigkeit der Mitarbeiter in Transformationsperioden
- Beispiele aus der Praxis
- Industrie 4.0 als soziotechnisches System
- Umsetzung Bosch
- Umsetzung Daimler
- Computergestützte Kommunikation als soziotechnisches System
- Definition computergestützte Kommunikationssysteme
- Voraussetzungen soziotechnischer Kommunikationssysteme
- Aufbau sozialer Netzwerke
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und den Einfluss soziotechnischer Systeme im Arbeitsalltag. Sie beleuchtet den soziotechnischen Systemansatz, dessen Grundzüge und vier Grundannahmen, sowie die Adaptionsfähigkeit von Individuen in diesem Kontext. Das Ziel ist es, ein Verständnis für die Interaktion zwischen sozialen und technischen Systemen zu vermitteln.
- Entstehung und Grundlagen soziotechnischer Systeme
- Der soziotechnische Systemansatz und seine Prinzipien
- Praxisbeispiele der Umsetzung soziotechnischer Systeme
- Herausforderungen und Chancen soziotechnischer Systeme
- Adaptionsfähigkeit von Mitarbeitern in dynamischen Arbeitsumgebungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problemstellung der individuellen Konzepterstellung für die Einführung soziotechnischer Systeme in Unternehmen. Sie hebt die Komplexität der Interaktion zwischen Technologie, Mensch und Arbeitsumgebung hervor und betont die Schwierigkeit, Störungen in diesen Systemen vorherzusagen und zu minimieren. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der folgenden Kapitel.
Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des soziotechnischen Systems anhand der Studie von Trist & Bamforth im englischen Kohlebergbau. Die Analyse der Arbeitsorganisation im "Shortwall"- und "Longwall"-System zeigt die Bedeutung der Berücksichtigung sowohl sozialer als auch technischer Aspekte für eine effiziente und motivierende Arbeitsgestaltung. Es werden die zentralen Konzepte des soziotechnischen Ansatzes, seiner Grundzüge und Grundannahmen vorgestellt, mit dem Fokus auf die Notwendigkeit einer optimalen Ergänzung beider Subsysteme.
Beispiele aus der Praxis: Dieses Kapitel präsentiert Fallstudien zur Umsetzung soziotechnischer Systeme in der Praxis, mit Industrie 4.0 und computergestützter Kommunikation als Beispielen. Es werden konkrete Umsetzungen bei Bosch und Daimler im Kontext von Industrie 4.0 analysiert, sowie die Voraussetzungen für erfolgreiche soziotechnische Kommunikationssysteme untersucht. Der Aufbau sozialer Netzwerke im Kontext computergestützter Kommunikation wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Soziotechnisches System, Industrie 4.0, Computergestützte Kommunikation, Arbeitsorganisation, Human Factors, Adaptionsfähigkeit, Transformation, Tavistock-Institut, Trist & Bamforth.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziotechnische Systeme im Arbeitsalltag
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und den Einfluss soziotechnischer Systeme im Arbeitsalltag. Sie beleuchtet den soziotechnischen Systemansatz, dessen Grundzüge und vier Grundannahmen, sowie die Adaptionsfähigkeit von Individuen in diesem Kontext. Das Ziel ist es, ein Verständnis für die Interaktion zwischen sozialen und technischen Systemen zu vermitteln.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Grundlagen soziotechnischer Systeme, den soziotechnischen Systemansatz und seine Prinzipien, Praxisbeispiele der Umsetzung (u.a. Industrie 4.0 und computergestützte Kommunikation bei Bosch und Daimler), Herausforderungen und Chancen soziotechnischer Systeme sowie die Adaptionsfähigkeit von Mitarbeitern in dynamischen Arbeitsumgebungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Grundlagenteil, einen Teil mit Praxisbeispielen und eine Zusammenfassung mit Ausblick. Die Einleitung beschreibt die Problemstellung und die Zielsetzung. Der Grundlagenteil beleuchtet die Entstehung des soziotechnischen Systems und seine zentralen Konzepte. Der Praxisbeispiel-Teil präsentiert Fallstudien zu Industrie 4.0 und computergestützter Kommunikation. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche konkreten Beispiele werden behandelt?
Konkrete Beispiele umfassen die Umsetzung von Industrie 4.0 bei Bosch und Daimler sowie die Analyse computergestützter Kommunikationssysteme. Die Arbeit untersucht die Voraussetzungen für erfolgreiche soziotechnische Kommunikationssysteme und den Aufbau sozialer Netzwerke in diesem Kontext.
Welche Schlüsselkonzepte werden erklärt?
Die Arbeit erklärt zentrale Konzepte des soziotechnischen Systemansatzes, seine Grundzüge und vier Grundannahmen. Sie beleuchtet die Bedeutung der Berücksichtigung sowohl sozialer als auch technischer Aspekte für eine effiziente und motivierende Arbeitsgestaltung und den Zusammenhang mit der Adaptionsfähigkeit der Mitarbeiter.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Soziotechnisches System, Industrie 4.0, Computergestützte Kommunikation, Arbeitsorganisation, Human Factors, Adaptionsfähigkeit, Transformation, Tavistock-Institut, Trist & Bamforth.
Was ist die zentrale Problemstellung der Einleitung?
Die Einleitung beschreibt die Problemstellung der individuellen Konzepterstellung für die Einführung soziotechnischer Systeme in Unternehmen. Sie hebt die Komplexität der Interaktion zwischen Technologie, Mensch und Arbeitsumgebung hervor und betont die Schwierigkeit, Störungen in diesen Systemen vorherzusagen und zu minimieren.
Was wird im Kapitel "Grundlagen" behandelt?
Das Kapitel "Grundlagen" beleuchtet die Entstehung des soziotechnischen Systems anhand der Studie von Trist & Bamforth im englischen Kohlebergbau. Es werden die zentralen Konzepte des soziotechnischen Ansatzes, seiner Grundzüge und Grundannahmen vorgestellt, mit dem Fokus auf die Notwendigkeit einer optimalen Ergänzung beider Subsysteme (soziales und technisches System).
Was wird im Kapitel "Beispiele aus der Praxis" behandelt?
Das Kapitel "Beispiele aus der Praxis" präsentiert Fallstudien zur Umsetzung soziotechnischer Systeme in der Praxis, mit Industrie 4.0 und computergestützter Kommunikation als Beispielen. Konkrete Umsetzungen bei Bosch und Daimler im Kontext von Industrie 4.0 werden analysiert, sowie die Voraussetzungen für erfolgreiche soziotechnische Kommunikationssysteme untersucht. Der Aufbau sozialer Netzwerke im Kontext computergestützter Kommunikation wird ebenfalls thematisiert.
- Quote paper
- Julian Springer (Author), 2017, Das soziotechnische System. Beispiele aus der Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/449751