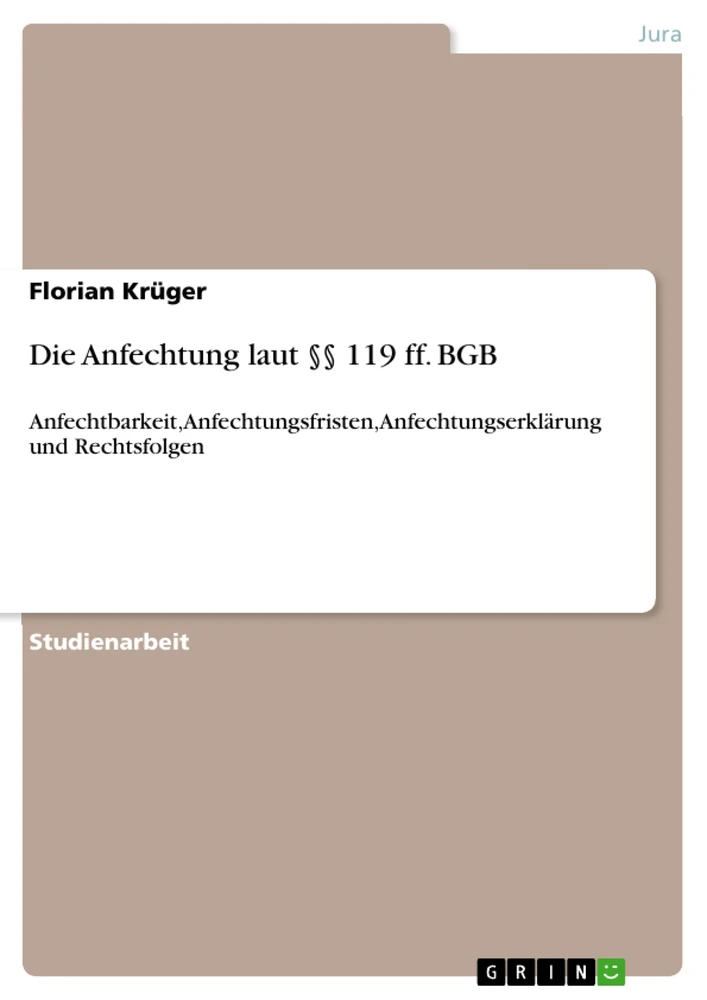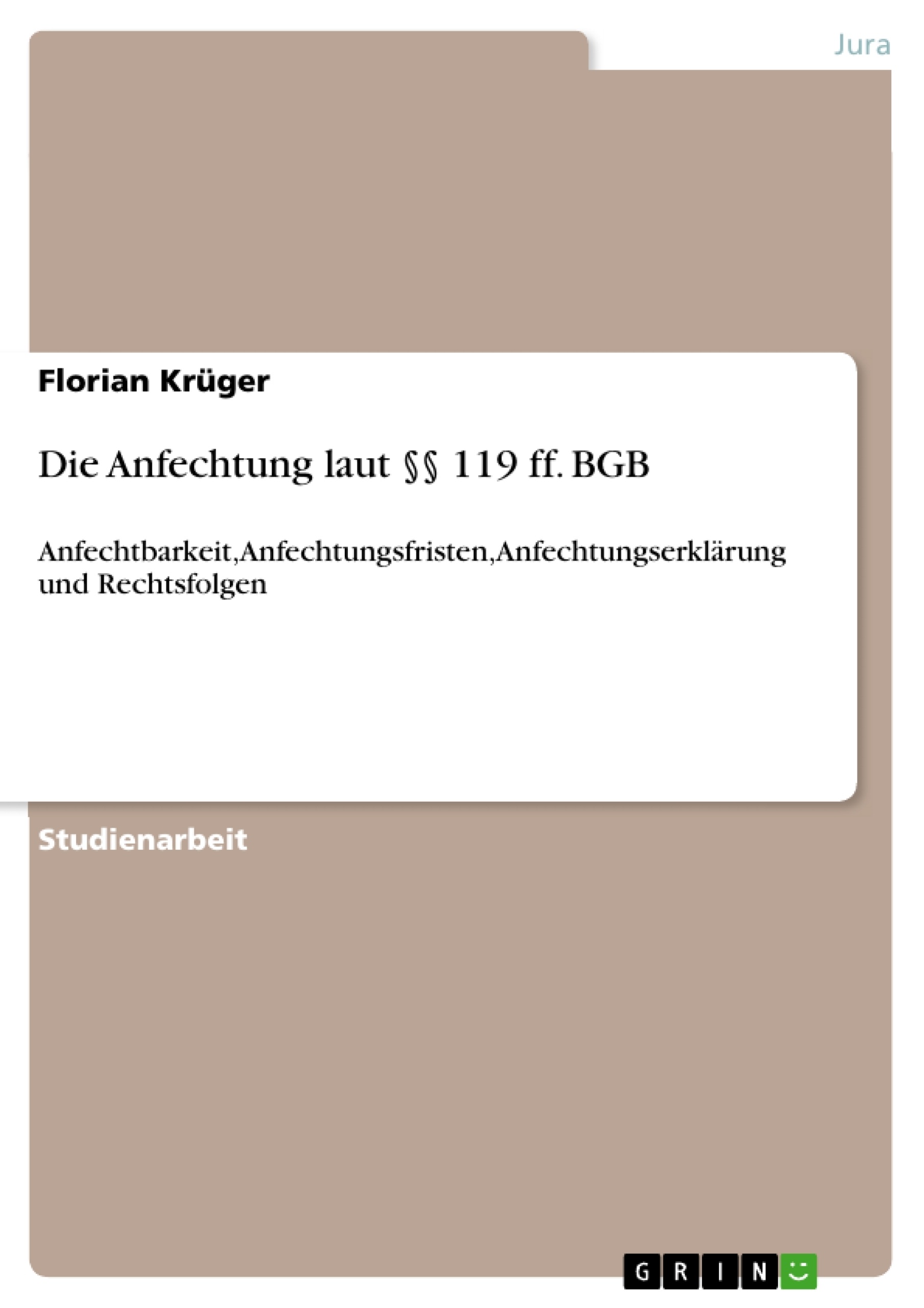Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Anfechten von Willenserklärungen im Sinne der §§ 119 ff. BGB. Sie soll einen weitreichenden Überblick über die verschiedenen Anfechtungsgründe, sowie deren Rechtsfolgen geben.
Um diesen grundlegenden Abschnitt im Bereich der Rechtsgeschäfte nachvollziehbar darzustellen, soll zunächst auf das Wesen der Anfechtung an sich eingegangen werden. Die Anfechtung ist eine einseitige Willenserklärung, die durch formfreie Erklärung, bei Täuschung oder Drohung, bei falscher Übermittlung oder bei Irrtum, im Sinne des § 143 BGB der gegenseitigen Partei entgegengebracht werden kann.
Wenn einer der oben erwähnten Anfechtungsgründe vorliegt, so handelt es sich automatisch um ein anfechtbares Rechtsgeschäft, welches bei Anfechtung von vornherein als nichtig anzusehen ist. Es wird sozusagen im Sinne des § 142 BGB rückwirkend vernichtet. Besonderes Augenmerk ist auf den § 119 BGB zu richten, da man hier nochmal zwischen drei verschiedenen Anfechtungsgründen unterscheiden muss. Hier spricht man vom Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum sowie dem Eigenschaftsirrtum. Bei diesen Anfechtungsgründen gilt es wiederum wichtige Unterscheidungen zu machen, die in den entsprechenden Kapiteln noch genauer erläutert werden.
Außerdem soll in Verbindung der berechtigten Anfechtungsgründe auch der Motivirrtum behandelt werden, welcher keinen berechtigten Anfechtungsgrund darstellt.
So unterscheidet man, nimmt man zum § 119 BGB noch die §§ 142, 143 BGB hinzu, also insgesamt zwischen fünf Anfechtungsgründen, welche in dieser Seminararbeit abgehandelt und mit entsprechenden Beispielen veranschaulicht werden. Ebenso werden zu einigen Beispielen, Rechtsprechungen vorgestellt und damit verschiedene Problemstellungen aufgezeigt.
Außerdem wird in dieser Seminararbeit das Zustandekommen von solchen Anfechtungen erläutert. Zu nennen sind hier die Anfechtungserklärung nach § 143 BGB und die Anfechtungsfristen nach §§ 1215, 124 BGB6. Abschließend soll auf die Rechtsfolgen der Anfechtung eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Anfechtbarkeit wegen Irrtums, § 119 BGB
- 2.1 Inhaltsirrtum, § 119 I 1. Alternative BGB
- 2.1.1 Verlautbarungsirrtum
- 2.1.2 Identitätsirrtum
- 2.1.3 Rechtsfolgenirrtum
- 2.1.4 Kalkulationsirrtum
- 2.2 Erklärungsirrtum, § 119 2. Alternative BGB
- 2.3 Eigenschaftsirrtum, § 119 II BGB
- 2.3.1 Verkehrswesentliche Eigenschaften
- 2.3.2 Verkehrswesentliche Eigenschaften einer Person
- 2.3.3 Verkehrswesentliche Eigenschaften einer Sache
- 2.4 Motivirrtum
- 3 Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung, § 120 BGB
- 3.1 Willenserklärung
- 3.2 Übermittlungsperson oder einrichtung
- 3.3 Unbewusst unrichtige Übermittlung
- 3.4 Unkenntnis des Empfängers
- 4 Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung, § 123 BGB
- 4.1 Arglistige Täuschung
- 4.1.1 Täuschung
- 4.1.2 Arglist
- 4.2 Widerrechtliche Drohung
- 4.2.1 Drohung
- 4.2.2 Widerrechtlichkeit
- 5 Anfechtungsfristen
- 5.1 Anfechtungsfrist nach § 121 BGB
- 5.2 Anfechtungsfrist nach § 124 BGB
- 6 Anfechtungserklärung, § 143 BGB
- 7 Rechtsfolgen
- 7.1 Schadensersatzpflicht des Anfechtenden, § 122 BGB
- 7.2 Wirkung der Anfechtung, § 142 BGB
- III. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit widmet sich der Anfechtung von Willenserklärungen im Sinne der §§ 119 ff. BGB und bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Anfechtungsgründe und deren Rechtsfolgen. Die Arbeit beleuchtet das Wesen der Anfechtung und erläutert die verschiedenen Anfechtungsgründe, insbesondere den Inhaltsirrtum, den Erklärungsirrtum und den Eigenschaftsirrtum. Auch der Motivirrtum, der keine rechtliche Grundlage für eine Anfechtung bietet, wird beleuchtet. Zudem werden Rechtsprechungen vorgestellt und verschiedene Problemstellungen anhand von Beispielen aufgezeigt.
- Anfechtung von Willenserklärungen
- Verschiedene Anfechtungsgründe nach §§ 119 ff. BGB
- Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum, Eigenschaftsirrtum
- Motivirrtum
- Rechtsfolgen der Anfechtung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Anfechtung von Willenserklärungen ein und gibt einen Überblick über die verschiedenen Anfechtungsgründe und deren Rechtsfolgen. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Anfechtbarkeit wegen Irrtums im Sinne des § 119 BGB. Hier werden verschiedene Arten von Irrtümern, wie Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum und Eigenschaftsirrtum, erläutert und anhand von Beispielen veranschaulicht. Kapitel 3 befasst sich mit der Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung, wie sie im § 120 BGB geregelt ist. Hier werden die Voraussetzungen für eine Anfechtung aufgrund falscher Übermittlung genauer betrachtet. Kapitel 4 untersucht die Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung nach § 123 BGB. Hier werden die Voraussetzungen für eine Anfechtung aufgrund arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung beleuchtet. Kapitel 5 behandelt die verschiedenen Anfechtungsfristen, wie sie in den §§ 121 und 124 BGB geregelt sind. Kapitel 6 erläutert die Anfechtungserklärung nach § 143 BGB und ihre Bedeutung für die Gültigkeit der Anfechtung. Kapitel 7 beleuchtet die Rechtsfolgen der Anfechtung, insbesondere die Schadensersatzpflicht des Anfechtenden nach § 122 BGB und die Wirkung der Anfechtung nach § 142 BGB.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit konzentriert sich auf die rechtlichen Grundlagen der Anfechtung von Willenserklärungen im deutschen Recht. Zentrale Themen sind die verschiedenen Anfechtungsgründe, wie Irrtum, falsche Übermittlung, Täuschung und Drohung, sowie deren Rechtsfolgen. Die Arbeit analysiert die entsprechenden Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere §§ 119 ff. BGB, § 142 BGB und § 143 BGB, und beleuchtet wichtige Rechtsprechungen zum Thema. Die Arbeit befasst sich mit den verschiedenen Arten von Irrtümern, wie Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum und Eigenschaftsirrtum, und zeigt die Unterschiede zwischen rechtlich relevanten Irrtümern und Motivirrtümern auf. Zudem werden die Voraussetzungen für eine Anfechtung aufgrund falscher Übermittlung sowie arglistiger Täuschung und widerrechtlicher Drohung erläutert. Schließlich werden die rechtlichen Folgen der Anfechtung, wie Schadensersatzpflicht und Wirkung der Anfechtung, besprochen.
- Quote paper
- Florian Krüger (Author), 2018, Die Anfechtung laut §§ 119 ff. BGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/449041