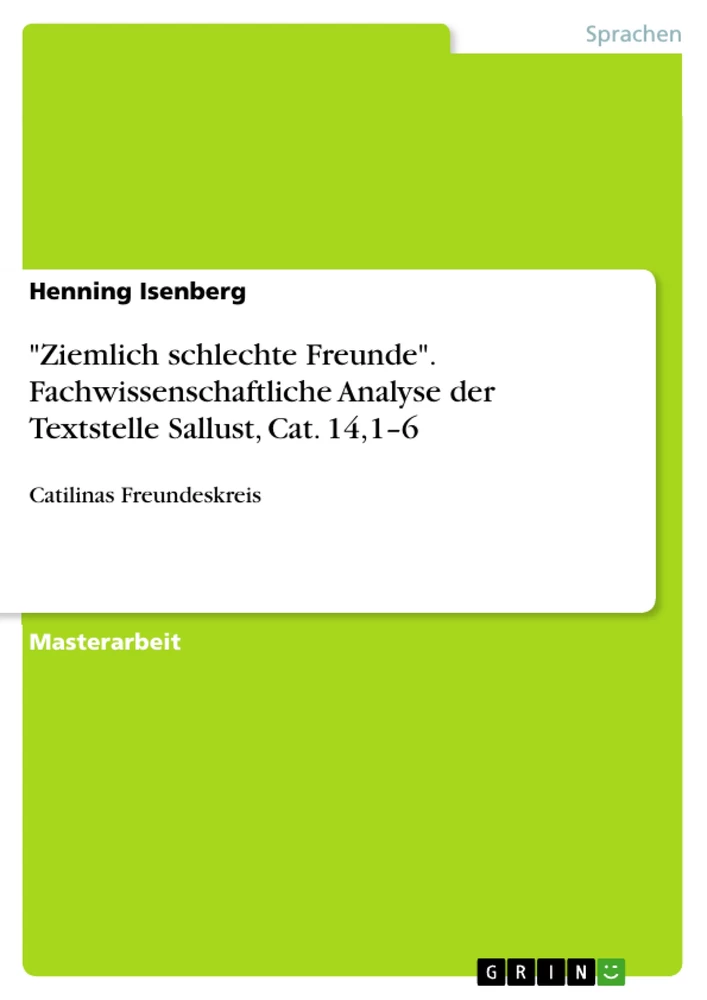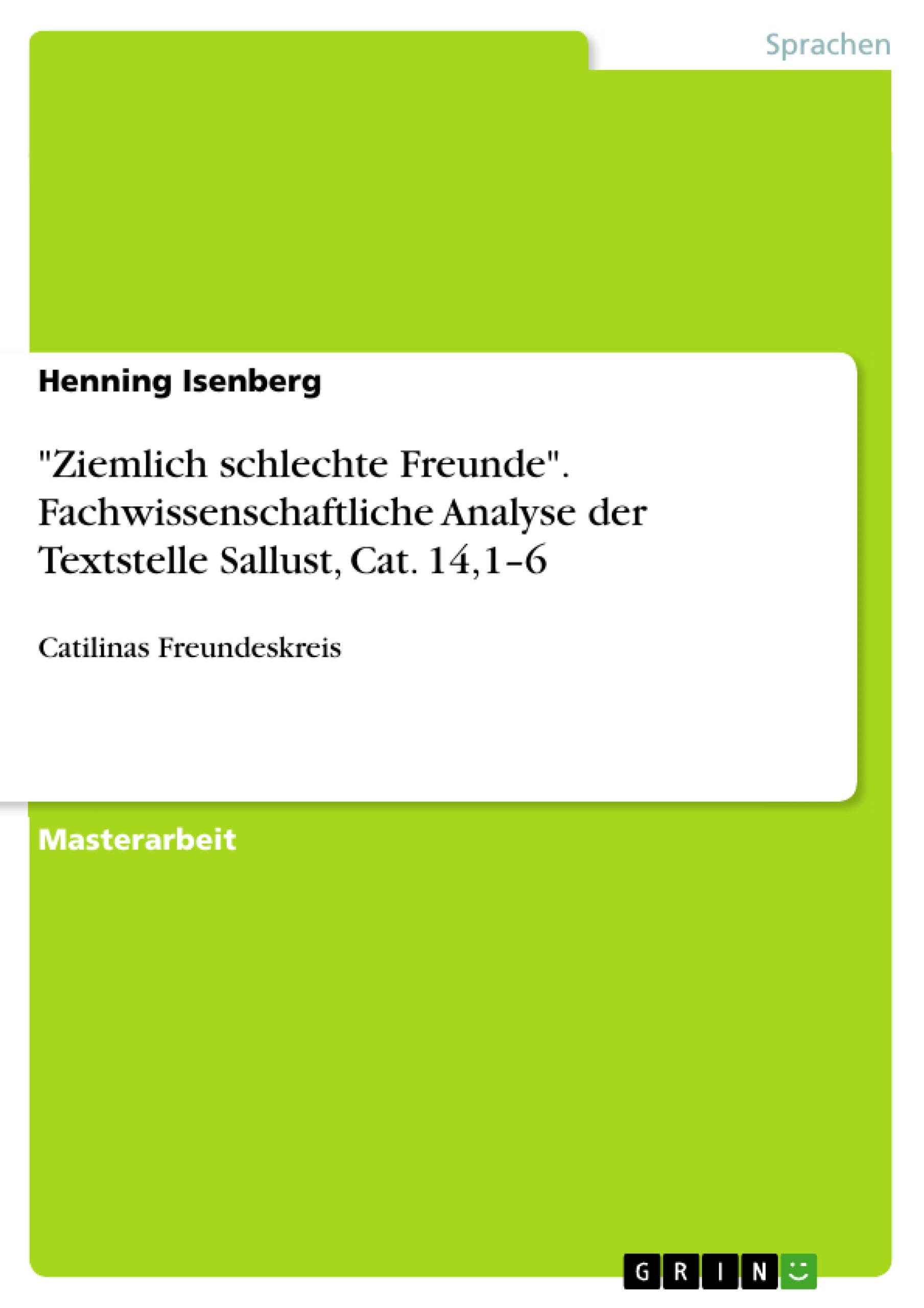Sallust hat seinen festen Platz im Lektürekanon des heutigen Lateinunterrichts zurecht, auch wenn eine Schwierigkeit darin liegt, seine tiefgründigen und auch schwierigen Schriften den Lernenden verständlich zu machen und gleichzeitig dem lateinischen Autor gerecht zu werden. Die Bewunderung Sallusts hat schon antike Wurzeln, überdauerte das Mittelalter und trägt sich bis in die heutige Zeit. Die Catilinarische Verschwörung, aus der die hier zu untersuchende Textstelle stammt, gehört seit dem Mittelalter zur schulischen Pflichtlektüre und die Beschäftigung mit dieser erfreut sich auch heutzutage noch reger Beliebtheit bei Lateinlehrenden. Sallust weist dabei elementare Unterschiede zu den meisten prosaischen Schriftstellern seines Jahrhunderts auf, da seine politische Karriere im Gegensatz zu der eines Cicero oder seines römischen Vorbilds Cato dem Älteren ziemlich erfolglos verlief und es ihm nach Caesars Tod nicht vergönnt war, den Zeitpunkt für den Rückzug aus dem politischen Geschehen selbst zu bestimmen. Doch auch in einem anderen Metier kann Sallust mit Recht als wenig schulmäßiger Autor gelten: In seinem Stil. Denn dieser bildet wohl genau das Pendant zur ciceronisch ausschweifenden Wortfolge und dessen oftmals beobachtbaren Hang zum parallelen Aufbau, indem Sallust durch seine Kürze und seine Variation stark pointiert. Bei Sallust gibt es „keinen gnädigen Überfluss in Prosa“ und zurecht wurde, so Jessen, darauf hingewiesen, dass man aus Sallusts Sätzen kein Wort streichen könne, ohne dabei den Sinn zu verändern oder gar zu verlieren. Sallust gelingt es wie keinem Zweitem, Personen und Ereignisse herauszugreifen und sie mit knappen und prägnanten Strichen zu zeichnen. Durch diese literarische Technik erlangte er posthum bis in die heutige Zeit große Anerkennung und sie hielt sein Werk über all die Jahrhunderte hinweg lebendig. Sallusts Prosa ist demnach zusammen mit Ciceros besonders gut dazu geeignet, den Lernenden das breite Spektrum der unterschiedlichen Stile innerhalb der römischen Prosa des 1. Jahrhunderts v. Chr. zu versinnbildlichen. Sie ist in Form der Historiographie dabei mehr als bloße Kürze, Variation und bissige Pointierung. An erster Stelle eine Kunstform bildet sie neben den Gattungen der Rhetorik und der Philosophie die dritte Säule der römischen Kunstprosa.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sallust: Der Autor und sein Werk
- 2.1. Römische Geschichtsschreibung als literarische Gattung
- 2.2. Sprache und Stil
- 2.3. Quellen und Vorbilder
- 2.4. Überlieferungsgeschichte
- 3. Zeilenkommentar zu der Textstelle Sall. Cat. 14,1–6
- 3.1. Übersetzung der Textstelle
- 3.2. Einordnung der Textstelle in den Werkkontext
- 3.3. Inhalt der Textstelle
- 3.4. Kommentierung
- 4. Didaktische Aufarbeitung der Textstelle Sall. Cat. 14, 1–6
- 4.1. Einbettung Sallusts in den Kernlehrplan des Landes Nordrhein-Westfalens (NRW)
- 4.2. Didaktische Überlegungen zur Textstelle Cat. 14,1-3
- 4.3. Konzeption einer Unterrichtseinheit
- 4.4. Konzeption der Unterrichtsreihe
- 5. Fazit Chancen und Probleme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Eignung der Textstelle Sallust, Cat. 14,1-6 für den Lateinunterricht. Das Ziel ist die fachwissenschaftliche und fachdidaktische Analyse dieser Textstelle, um ihre Lernförderlichkeit zu bewerten. Die Arbeit gliedert sich in eine Analyse von Sallusts Werk und Stil, eine detaillierte fachwissenschaftliche Kommentierung der Textstelle und schließlich didaktische Überlegungen zur Einbettung in den Unterricht.
- Sallusts Leben und Werk im Kontext der römischen Geschichtsschreibung
- Stilistische Analyse von Sallusts Prosa und deren didaktische Relevanz
- Fachwissenschaftliche Kommentierung der Textstelle Sallust, Cat. 14,1-6
- Didaktische Konzeption einer Unterrichtseinheit und -reihe basierend auf der Textstelle
- Chancen und Herausforderungen bei der Behandlung der Textstelle im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Wahl der Textstelle Sallust, Cat. 14,1-6 für die Analyse. Sie betont Sallusts herausragende Stellung im Lateinunterricht trotz der Schwierigkeiten, seine Werke für Schüler verständlich zu machen. Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Arbeit vor und skizziert den Aufbau der einzelnen Kapitel. Der Gegenwartsbezug Sallusts wird durch Vergleiche mit aktuellen politischen Figuren angedeutet, um die Relevanz des Werkes für die Schüler hervorzuheben.
2. Sallust: Der Autor und sein Werk: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Sallusts Leben und Werk. Es beleuchtet die römische Geschichtsschreibung als literarische Gattung, analysiert Sallusts einzigartigen Sprachstil – geprägt von Kürze und Prägnanz im Gegensatz zum ausschweifenden Stil Ciceros – und untersucht seine Quellen und Vorbilder. Die Überlieferungsgeschichte der Catilinarischen Verschwörung wird ebenfalls betrachtet. Der Abschnitt betont Sallusts Kunstfertigkeit und den didaktischen Wert seines Stils für den lateinischen Unterricht.
3. Zeilenkommentar zu der Textstelle Sall. Cat. 14,1–6: Dieses Kapitel beinhaltet eine detaillierte fachwissenschaftliche Analyse der ausgewählten Textstelle. Es bietet eine Übersetzung, ordnet die Textstelle in den Gesamtkontext des Werkes ein, beschreibt ihren Inhalt und liefert eine eingehende kommentierte Interpretation. Die Analyse deckt die sprachlichen Besonderheiten auf und untersucht die rhetorischen Mittel, die Sallust einsetzt. Dieser Abschnitt bildet die Grundlage für die didaktischen Überlegungen im Folgekapitel.
4. Didaktische Aufarbeitung der Textstelle Sall. Cat. 14, 1–6: Dieses Kapitel befasst sich mit den didaktischen Implikationen der Textstelle. Es untersucht die Einbettung Sallusts in den Lehrplan des Landes Nordrhein-Westfalen und entwickelt didaktische Überlegungen zur Behandlung der Textstelle im Unterricht. Es beinhaltet die Konzeption einer konkreten Unterrichtseinheit sowie einer umfassenderen Unterrichtsreihe, welche die Schüler aktiv mit der Thematik auseinandersetzen lässt. Dabei wird der Fokus auf eine lernförderliche und motivierende Unterrichtsgestaltung gelegt.
Schlüsselwörter
Sallust, Catilinarische Verschwörung, Römische Geschichtsschreibung, Sprache und Stil, Fachdidaktik, Lateinunterricht, Unterrichtsplanung, Zeilenkommentar, Kernlehrplan NRW, politische Rhetorik.
Sallust, Catilinarische Verschwörung: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit analysiert die Eignung der Textstelle Sallust, Cat. 14,1-6 für den Lateinunterricht. Sie untersucht die Textstelle fachwissenschaftlich und fachdidaktisch, um ihre Lernförderlichkeit zu bewerten.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Analyse von Sallusts Werk und Stil, eine detaillierte fachwissenschaftliche Kommentierung der Textstelle Sallust, Cat. 14,1-6 und didaktische Überlegungen zur Einbettung in den Unterricht. Es werden Sallusts Leben und Werk, sein Sprachstil, die Quellen und Vorbilder sowie die Überlieferungsgeschichte betrachtet. Die Arbeit beinhaltet außerdem die Konzeption einer Unterrichtseinheit und -reihe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Sallust: Der Autor und sein Werk, Zeilenkommentar zu Sall. Cat. 14,1–6, Didaktische Aufarbeitung der Textstelle Sall. Cat. 14, 1–6 und Fazit Chancen und Probleme. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Analyse.
Wie wird die Textstelle Sallust, Cat. 14,1-6 analysiert?
Das Kapitel 3 bietet eine detaillierte fachwissenschaftliche Analyse, inklusive Übersetzung, Einordnung in den Werkkontext, Inhaltsbeschreibung und kommentierter Interpretation. Sprachliche Besonderheiten und rhetorische Mittel werden untersucht.
Welche didaktischen Überlegungen werden angestellt?
Kapitel 4 befasst sich mit der Einbettung Sallusts in den Lehrplan von Nordrhein-Westfalen. Es werden didaktische Überlegungen zur Behandlung der Textstelle im Unterricht entwickelt, inklusive der Konzeption einer konkreten Unterrichtseinheit und einer umfassenderen Unterrichtsreihe mit Fokus auf lernförderliche und motivierende Gestaltung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sallust, Catilinarische Verschwörung, Römische Geschichtsschreibung, Sprache und Stil, Fachdidaktik, Lateinunterricht, Unterrichtsplanung, Zeilenkommentar, Kernlehrplan NRW, politische Rhetorik.
Welches ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die fachwissenschaftliche und fachdidaktische Analyse der Textstelle Sallust, Cat. 14,1-6, um deren Eignung und Lernförderlichkeit für den Lateinunterricht zu bewerten.
Wie wird der Gegenwartsbezug hergestellt?
Der Gegenwartsbezug wird durch Vergleiche mit aktuellen politischen Figuren angedeutet, um die Relevanz des Werkes für die Schüler hervorzuheben.
Was ist die Bedeutung von Sallusts Stil für den Lateinunterricht?
Sallusts prägnanter und kurzer Stil wird als didaktisch wertvoll betrachtet, im Gegensatz zum ausschweifenden Stil Ciceros.
Welche Herausforderungen werden bei der Behandlung der Textstelle im Unterricht betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Chancen und Herausforderungen, die mit der Behandlung der Textstelle im Unterricht verbunden sind.
- Arbeit zitieren
- Henning Isenberg (Autor:in), 2018, "Ziemlich schlechte Freunde". Fachwissenschaftliche Analyse der Textstelle Sallust, Cat. 14,1–6, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/444949