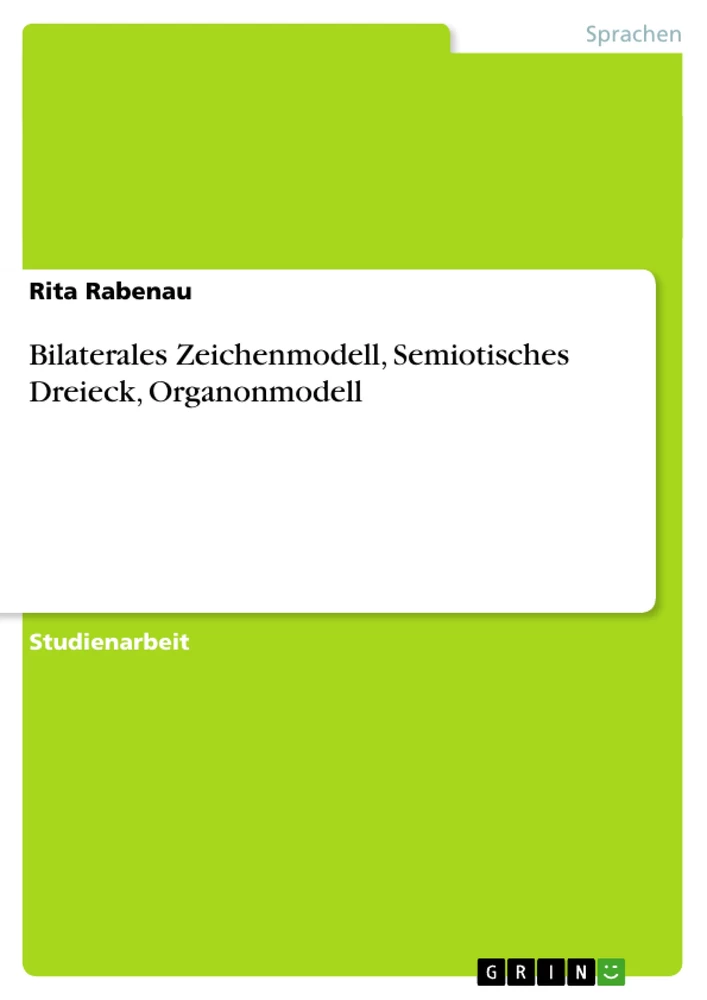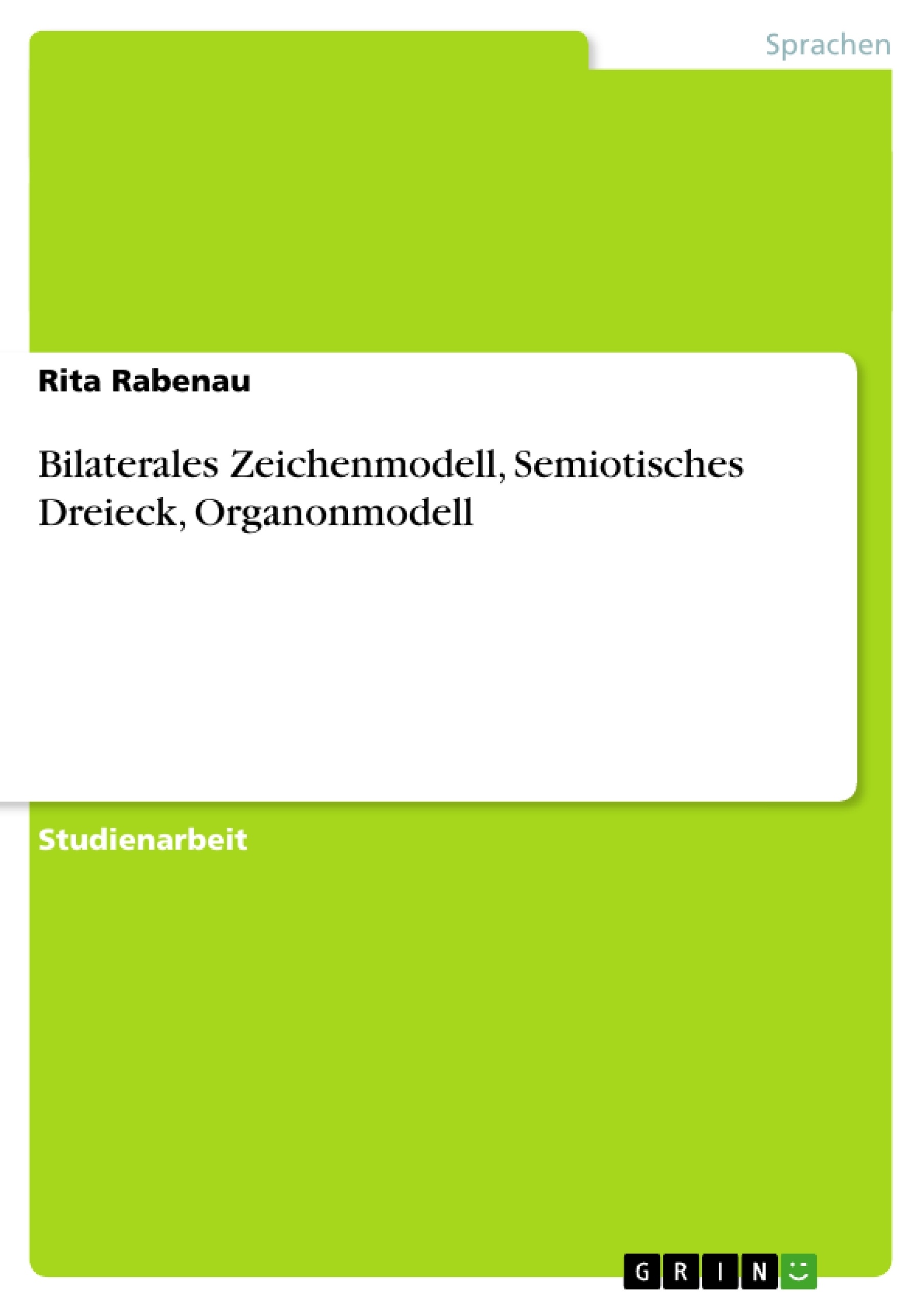Anhand dieser Arbeit soll eine Beschreibung einiger Zeichenmodelle der Sprachwissenschaft erfolgen. Hierzu gehören das bilaterale Zeichenmodell von Ferdinand de Saussure, das semiotische Dreieck, auch semantisches Dreieck genannt von Charles William Morris und das Organonmodell von Karl Bühler. Das Konzept von Ferdinand de Saussures gilt in der Sprachwissenschaft sozusagen als der Prototyp eines bilateralen Zeichenmodells. Schon vor de Saussure, zum Beispiel Ch. S. Peirce, und nach ihm wurden zahlreiche Modelle zur Darstellung des Sprachzeichens entwickelt, die weitere, für die Linguistik wichtige Merkmale und Relationen der Struktur und des gesellschaftlichen Gebrauchs von Zeichen herausgearbeitet haben. Einen sehr interessanten Entwurf hat der Wissenschaftler Charles W. Morris veröffentlicht. Er entwickelte ein trilaterales Zeichenmodell (semiotisches Dreieck), das das bezeichnete Objekt als weiteren Faktor in die Darstellung von Sprachzeichen mit einbezieht. Nicht zu vergessen ist aber auch das von dem Sprachpsychologen Karl Bühler entwickelte Organonmodell. In kritischer Auseinandersetzung mit einer naiv-kausalistischen Interpretation von Sprache entwickelte Bühler das Organonmodell über den platonischen Ansatz hinaus. Dieses entwickelte Modell zeigt Sprache als ein komplexes Phänomen auf, und versucht die Vermittlerfunktion, welche die Sprache in sich trägt, darzustellen. Nach einer ausführlichen Beschreibung der oben genannten Zeichenmodelle, erfolgt ein Vergleich, der verschiedenen Modelle untereinander. Hierbei sollen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und kenntlich gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das bilaterale Zeichenmodell von Ferdinand de Saussure
- signifiant
- signifié
- Arbitrarität
- Konventionalität
- Langue
- Parole
- faculté de langage
- Synchronie
- Diachronie
- Syntagmatische Verfahrensweise
- Paradigmatische Verfahrensweise
- Das semiotische Dreieck nach Charles W. Morris
- Aktualität eines Zeichens
- Virtualität eines Zeichens
- Das Organonmodell von Karl Bühler
- Ausdrucksfunktion
- Darstellungsfunktion
- Appellfunktion
- Vergleich der einzelnen Zeichenmodelle
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt verschiedene Zeichenmodelle der Sprachwissenschaft, darunter das bilaterale Zeichenmodell von Ferdinand de Saussure, das semiotische Dreieck von Charles W. Morris und das Organonmodell von Karl Bühler. Ziel ist es, die einzelnen Modelle detailliert darzustellen und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede in einem Vergleich herauszuarbeiten.
- Das bilaterale Zeichenmodell von Saussure und seine zentralen Konzepte (Signifikant, Signifié, Arbitrarität, Konventionalität, Langue, Parole).
- Das semiotische Dreieck von Morris und seine Erweiterung des Zeichenbegriffs.
- Das Organonmodell von Bühler und seine Betrachtung der Sprachfunktion.
- Ein Vergleich der drei Modelle hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen.
- Die Darstellung der Sprache als komplexes Phänomen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die drei zu behandelnden Zeichenmodelle: das bilaterale Zeichenmodell von Ferdinand de Saussure, das semiotische Dreieck von Charles W. Morris und das Organonmodell von Karl Bühler. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt einen abschließenden Vergleich der Modelle an. Die Einleitung betont den Stellenwert von de Saussures Modell als Prototyp und hebt die Bedeutung weiterer Entwicklungen wie Morris' trilaterales Modell und Bühlers Organonmodell hervor, die zusätzliche Aspekte des Sprachzeichens berücksichtigen, wie die Vermittlerfunktion der Sprache.
Das bilaterale Zeichenmodell von Ferdinand de Saussure: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das bilaterale Zeichenmodell von Saussure, bestehend aus Signifikant (Lautbild) und Signifié (Vorstellungsinhalt). Es erläutert die zentrale These der Arbitrarität der Beziehung zwischen Signifikant und Signifié, also der Willkürlichkeit der Zuordnung zwischen Lautbild und Bedeutung. Gleichzeitig wird die Konventionalität hervorgehoben, die durch soziale Übereinkünfte die Stabilität des Systems sichert. Der Unterschied zwischen Langue (Sprachsystem) und Parole (Sprachgebrauch) wird erklärt, wobei die Abhängigkeit beider Elemente betont wird. Das Kapitel verdeutlicht Saussures Modell als Grundlage für die weitere Entwicklung sprachwissenschaftlicher Zeichenmodelle.
Schlüsselwörter
Bilaterales Zeichenmodell, Semiotisches Dreieck, Organonmodell, Ferdinand de Saussure, Charles W. Morris, Karl Bühler, Signifikant, Signifié, Arbitrarität, Konventionalität, Langue, Parole, Ausdrucksfunktion, Darstellungsfunktion, Appellfunktion, Sprachzeichen, Sprachwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zu "Zeichenmodelle der Sprachwissenschaft"
Was behandelt dieser Text?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Zeichenmodelle der Sprachwissenschaft. Im Fokus stehen das bilaterale Zeichenmodell von Ferdinand de Saussure, das semiotische Dreieck von Charles W. Morris und das Organonmodell von Karl Bühler. Der Text beinhaltet eine Einleitung, ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Zeichenmodelle werden im Detail erklärt?
Der Text beschreibt detailliert drei bedeutende Zeichenmodelle: Das bilaterale Zeichenmodell von Saussure (mit den Konzepten Signifikant, Signifié, Arbitrarität, Konventionalität, Langue und Parole), das semiotische Dreieck von Morris (inklusive Aktualität und Virtualität eines Zeichens) und das Organonmodell von Bühler (mit den Funktionen Ausdrucksfunktion, Darstellungsfunktion und Appellfunktion).
Was ist das Ziel des Textes?
Das Hauptziel besteht darin, die drei genannten Zeichenmodelle detailliert darzustellen und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede durch einen Vergleich herauszuarbeiten. Es soll die Komplexität des Sprachzeichens verdeutlicht und das Verständnis der verschiedenen Perspektiven auf Sprache gefördert werden.
Wie werden die Zeichenmodelle verglichen?
Der Text beinhaltet ein Kapitel, das explizit einen Vergleich der drei Zeichenmodelle vornimmt. Dieser Vergleich beleuchtet die Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle und zeigt auf, wie sie sich gegenseitig ergänzen oder unterscheiden.
Was sind die zentralen Konzepte im bilateralen Zeichenmodell von Saussure?
Die zentralen Konzepte im bilateralen Zeichenmodell von Saussure sind: Signifikant (Lautbild), Signifié (Vorstellungsinhalt), Arbitrarität (Willkürlichkeit der Beziehung zwischen Signifikant und Signifié), Konventionalität (soziale Übereinkünfte, die die Stabilität des Systems sichern), Langue (Sprachsystem) und Parole (Sprachgebrauch).
Welche Aspekte werden im semiotischen Dreieck von Morris berücksichtigt?
Das semiotische Dreieck von Morris erweitert den Zeichenbegriff und betrachtet die Beziehung zwischen Zeichen, Objekt und Interpret. Der Text hebt insbesondere die Aspekte der Aktualität und Virtualität eines Zeichens hervor.
Welche Funktionen der Sprache werden im Organonmodell von Bühler beschrieben?
Das Organonmodell von Bühler fokussiert auf die Funktionen der Sprache. Es unterscheidet zwischen der Ausdrucksfunktion (Sender), der Darstellungsfunktion (Gegenstand) und der Appellfunktion (Empfänger).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Bilaterales Zeichenmodell, Semiotisches Dreieck, Organonmodell, Ferdinand de Saussure, Charles W. Morris, Karl Bühler, Signifikant, Signifié, Arbitrarität, Konventionalität, Langue, Parole, Ausdrucksfunktion, Darstellungsfunktion, Appellfunktion, Sprachzeichen, Sprachwissenschaft.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an Leser, die sich mit den Grundlagen der Sprachwissenschaft und den verschiedenen Zeichenmodellen auseinandersetzen möchten. Er eignet sich besonders für akademische Zwecke, z.B. zur Vorbereitung auf Seminare oder zur vertiefenden Beschäftigung mit dem Thema.
- Quote paper
- Rita Rabenau (Author), 2004, Bilaterales Zeichenmodell, Semiotisches Dreieck, Organonmodell, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/44432