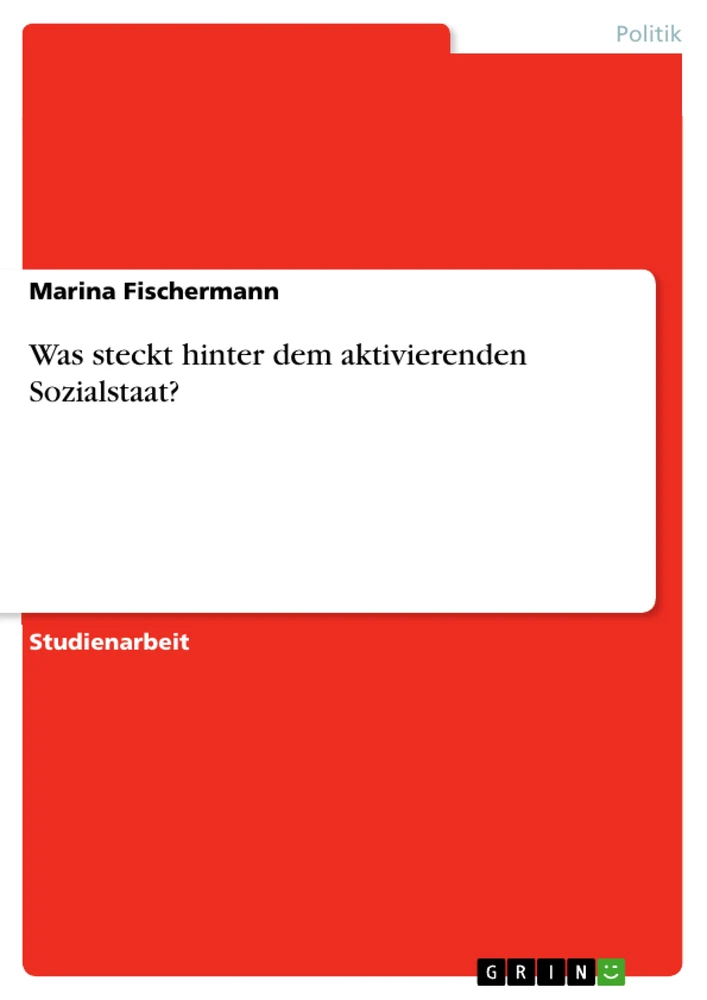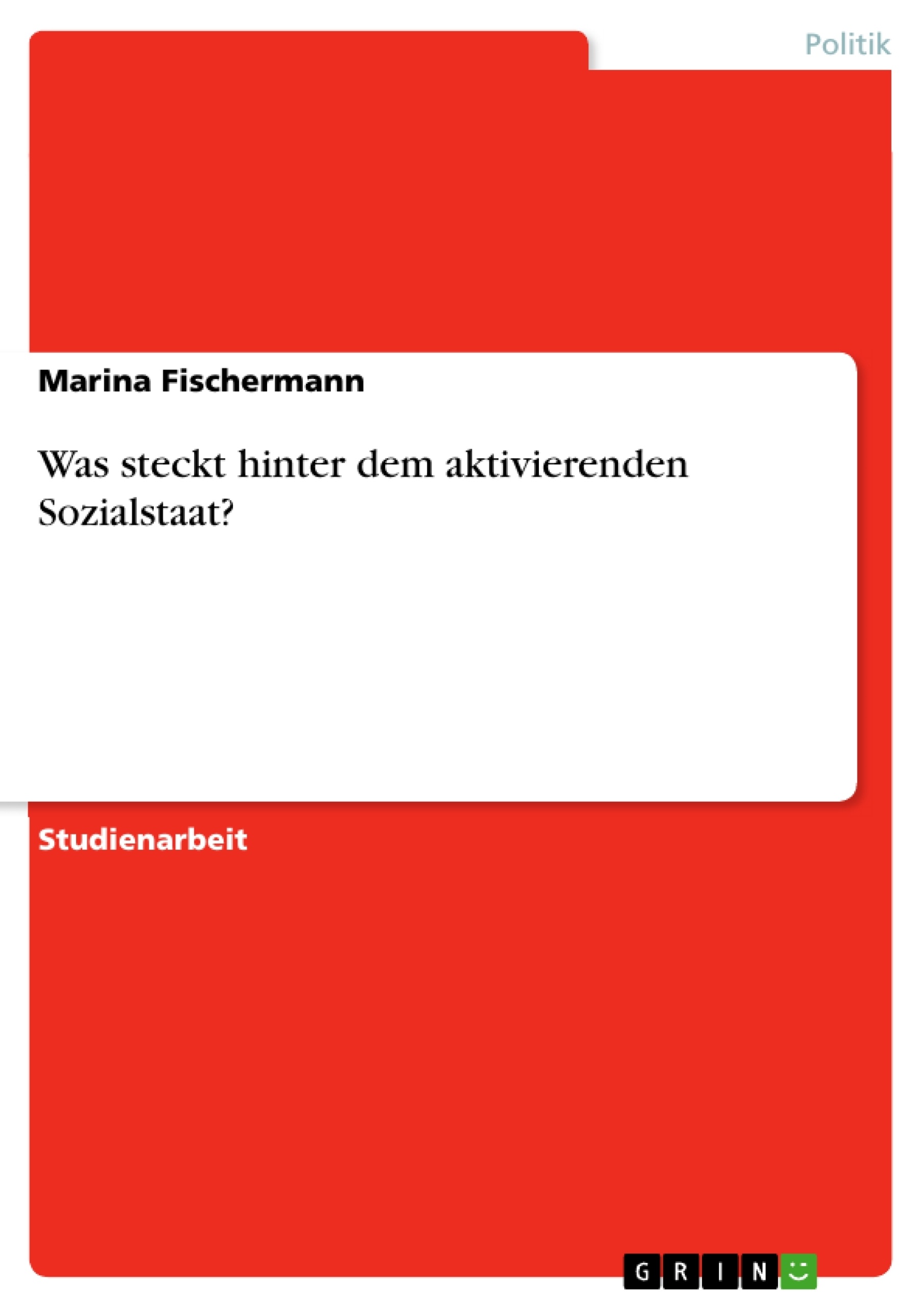Der Wechsel zum aktivierenden Sozialstaat, hat in den 90er Jahren für eine große Debatte gesorgt, dieser wurde unter dem Stichwort „Neue Mitte“ zum Wahlkampf Mittelpunkt der SPD. Noch heute wird der Zwangscharakter von Aktivitäten und Arbeit dieses Paradigmenwechsels in Frage gestellt. Im Folgenden geht es darum, was den aktivierenden Sozialstaat ausmacht, was die Intention dahinter ist und inwiefern er gesellschaftlich funktioniert und anerkannt ist. Dies ist das Leitbild des aktivierenden Sozialstaates. Fördern und fordern. Es bezeichnet die Forderung einer veränderten Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft, ohne die beiden Seiten näher zu qualifizieren. Der Unterschied zu den früheren Auffassungen wird zum einen deutlich an der stärkeren Betonung der eigenen Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten und zum anderen, an der Forderung nach einer anderen Gestaltung der Politik. Diese Politik soll zur Kooperation und Eigentätigkeit ermuntern. Das Konzept des aktivierenden Sozialstaates, wurde von Anfang an begleitet von einer ordnungspolitischen Strategie. Dies kann man besonders bei Menschen sehen, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Es zeigt sich im Umgang mit Obdachlosen, Kriminellen und Unangepassten. Diese Gruppen werden nicht als Menschen gesehen. Vielmehr werden diese Menschen als Teil der Gesellschaft betrachtet, die zwangsläufig Probleme bereiten.. Eine weitere Eigenschaft des aktivierenden Sozialstaates ist, dass persönliche Geschichten außen vor sind. Wer arbeiten kann und nicht aufgrund einer Behinderung arbeitsunfähig ist, soll bzw. muss auch arbeiten. Dazu kommt die Verpflichtung für Geldleistungen eine Gegenleistung zu erbringen. Bund und Kantone sowie private AnbieterInnen haben ein umfangreiches Programm entwickelt. Dieses Programm beinhaltet: Beratungen, Förderungsmaßnahmen und Kurse, Programme zur vorübergehenden Beschäftigung, Maßnahmen im Arbeitsmarkt, sowie spezifische Maßnahmen für bestimmte Gruppierungen, insbesondere für jugendliche Erwerbslose.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entstehung des aktivierenden Sozialstaates
- 2.1 Das Konzept
- 2.2 Die Hartz- Reform
- 2.3 Die Hartz- Kommission
- 3. Kritik und Kontroversen des aktivierenden Sozialstaates
- 3.1 Die Arbeitsmarktpolitik im aktivierenden Sozialstaat
- 3.2 Die Sozialstaatkonzeption
- 3.3 Zwischen Zwang und Freiheit
- 3.4 Die Zielsetzung
- 4. Das vierte Gesetz für Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
- 5. Soziale Arbeit im aktivierenden Sozialstaat
- 5.1 Der Wandel
- 5.2 Der Einfluss der Aktivierungspoltik
- 5.3 Soziale Arbeit im Dienst der Aktivierungspolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des aktivierenden Sozialstaates in Deutschland, wobei die Hartz-Reformen und die damit verbundene Kritik im Zentrum stehen. Es wird analysiert, wie sich der aktivierende Sozialstaat auf die Arbeitsmarktpolitik und die Sozialstaatkonzeption auswirkt und welche Folgen dies für die soziale Arbeit hat.
- Die Entstehung des aktivierenden Sozialstaates in Deutschland
- Die Hartz-Reformen und ihre Folgen für die Arbeitsmarktpolitik und die Sozialstaatkonzeption
- Die Kritik an der Aktivierungspolitik und die Debatte um Zwang und Freiheit
- Die Rolle der sozialen Arbeit im aktivierenden Sozialstaat
- Die gesellschaftlichen Auswirkungen des aktivierenden Sozialstaates
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema des aktivierenden Sozialstaates ein und skizziert die zentralen Fragen, die im Text behandelt werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Wandel in der Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft, der Forderung nach Eigenverantwortung und der Kritik am Zwangscharakter von Aktivierungsmaßnahmen.
2. Die Entstehung des aktivierenden Sozialstaates
Dieses Kapitel beleuchtet die Ursprünge des aktivierenden Sozialstaates im Kontext des Wahlkampfs der SPD in den 1990er Jahren. Es wird erläutert, wie das Konzept der „Neuen Mitte“ mit dem Ziel einer „neuen Balance“ zwischen individuellen Rechten und Pflichten entstanden ist. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Regulierung von Subsystemen und der Forderung nach mehr Eigeninitiative der Bürger.
2.1 Das Konzept
Das Konzept des aktivierenden Sozialstaates wird hier im Detail erläutert, wobei die Betonung auf der Übernahme von Selbstverantwortung durch den Bürger und der Entlastung des Staates in finanzieller Hinsicht liegt. Der Zusammenhang zur Agenda-Politik der rot-grünen Bundesregierung und der Hartz-Gesetzgebung wird aufgezeigt.
2.2 Die Hartz- Reform
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Hartz-Reform und ihrer Einführung als gesetzliche Bestimmung im Sozialgesetzbuch. Die Reform stellt das bisherige Sicherungssystem der Sozialversicherung und Existenzsicherung in Frage und setzt einen neuen Fokus auf Aktivierung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
2.3 Die Hartz- Kommission
Die Hartz-Kommission und ihre Entstehung werden vorgestellt. Die Ziele der Reform und die sozialpolitischen Bedingungen, die zu ihrer Einführung führten, werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Aktivierender Sozialstaat, Hartz-Reform, Arbeitsmarktpolitik, Sozialstaatkonzeption, Eigenverantwortung, Förderung und Fordern, Selbstverantwortung, Soziale Arbeit, Agenda Politik, Hartz-Gesetze, SGB 2, Arbeitslosengeld, Kritik, Kontroversen, Zwang, Freiheit, Gesellschaftliche Gestaltungskraft, Individuelle Rechte und Pflichten, Subsysteme, Neuen Mitte, Balancing, Regulierung, Förderungsmaßnahmen, Kurse, Einarbeitungszuschüsse, Praktika.
- Arbeit zitieren
- Marina Fischermann (Autor:in), 2017, Was steckt hinter dem aktivierenden Sozialstaat?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/442997