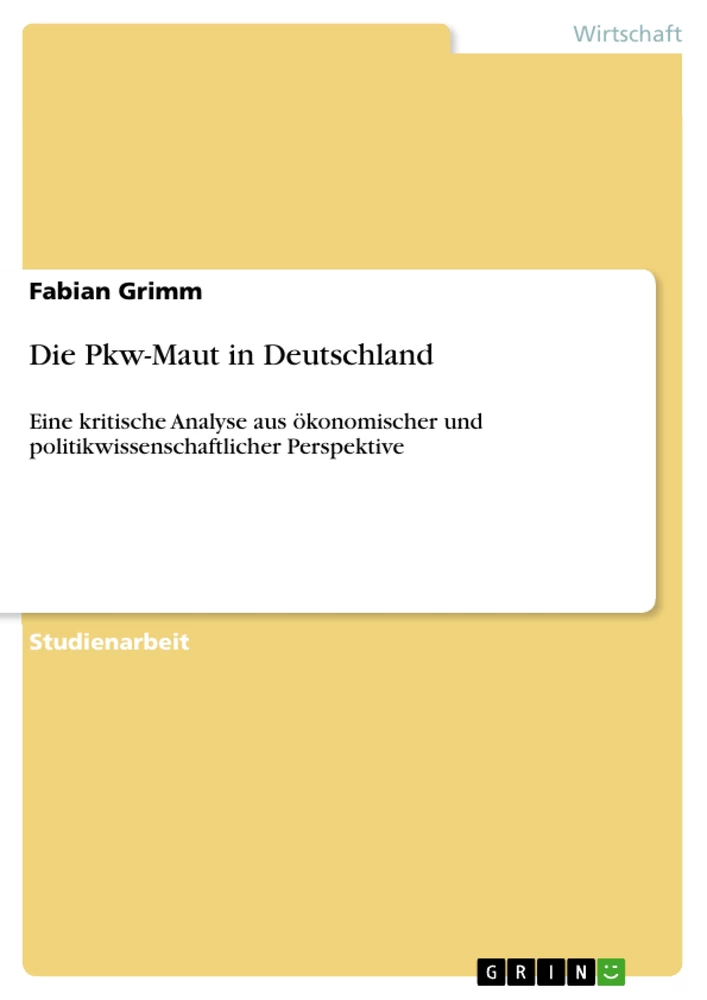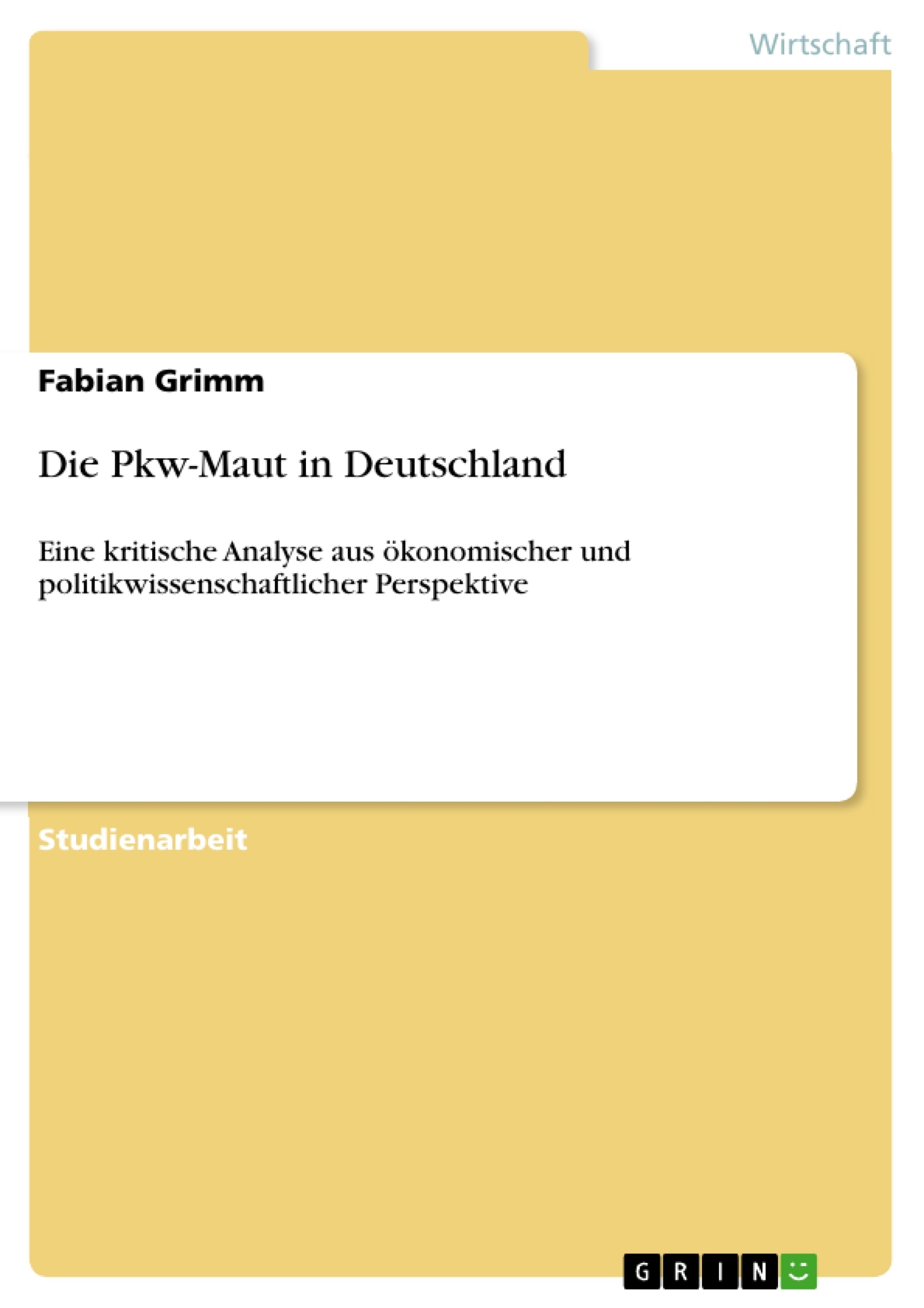Bereits seit 1990 wird die Maut in Deutschland immer wieder in den politischen Diskurs eingebracht und dabei kontrovers diskutiert. Für Befürworter stellt sie die optimale Lösung der Finanzierungsprobleme im Verkehrssektor dar, Kritiker warnen vor den exorbitanten Verwaltungskosten, durch die sich eine Straßennutzungsgebühr nicht amortisiere.
Entgegen diesen Bedenken wurde die Maut in Deutschland 2013 in den Koalitionsvertrag der neuen Regierung aus SPD und CDU/CSU aufgenommen. Im Laufe des Jahres 2014 sollte ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden, das Halter von nicht in Deutschland zugelassenen PKW an den Kosten für die Instandhaltung des Autobahnnetzes beteiligt, ohne deutsche Autofahrer dabei mehr zu belasten. Diese Frist konnte jedoch nicht eingehalten werden. Verkehrsminister Alexander Dobrindt zeigte sich im Juni 2014 dennoch optimistisch, dass eine Pkw-Maut in Deutschland bald eingeführt werde. Es gebe zwei Dinge bei denen er sich absolut sicher sei: Das Deutschland ins WM-Finale einziehen und die Maut zum 01.01.2016 scharf gestellt werde. Doch bis heute wurde noch immer keine entsprechende Straßennutzungsgebühr „scharf gestellt“. Der erste Gesetzesentwurf wurde durch eine Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof verhindert, da die deutsche Maut Ausländer diskriminiere (vgl. Europäische Kommission 2016). Einem erneuten Gesetzesentwurf stimmten nach dem Bundestag zwar auch die EU-Kommission und der Bundesrat im Mai 2017 zu, doch nun plant Österreich eine Klage gegen das deutsche Gesetz vor dem Europäischen Gerichtshof. Der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried sieht das Problem der Diskriminierung noch immer nicht als behoben an. Die Implementierung einer Maut in Deutschland konnte also nicht so schnell und unkompliziert durchgeführt werden, wie es der Koalitionsvertrag von 2013 vorsieht. Im Gegenteil ist sie sowohl aus politischer als auch ökonomischer Perspektive nach wie vor äußerst umstritten. Deshalb und aufgrund der hohen Aktualität des Themas werde ich mich in dieser Hausarbeit kritisch mit dem aktuellen Gesetzesentwurf zur Maut in Deutschland auseinandersetzen. Zunächst werden theoretische Modelle einer Maut aus politikwissenschaftlicher und ökonomischer Perspektive beleuchtet. Anschließend wird dann der aktuell im Raum stehende Gesetzesvorschlag anhand dieser Modelle untersucht und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Straßenübernutzung als gesellschaftliches Problem
- 2.1. Das Kausalmodell einer Policy am Beispiel der Maut
- 2.2. Die Maut aus ökonomischer Perspektive
- 3. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer Maut vom 20.02.2017
- 3.1. Eine ökonomische Perspektive auf den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer Maut
- 3.2. Eine politikwissenschaftliche Perspektive auf den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer Maut
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert kritisch den aktuellen Gesetzesentwurf zur Pkw-Maut in Deutschland aus ökonomischer und politikwissenschaftlicher Perspektive. Die Arbeit untersucht die Debatte um die Maut, beleuchtet die damit verbundenen gesellschaftlichen Probleme und bewertet den Gesetzesentwurf anhand theoretischer Modelle.
- Die ökonomischen Aspekte der Pkw-Maut und ihre Auswirkungen auf den Verkehrssektor.
- Die politikwissenschaftliche Analyse des Maut-Gesetzes und der politischen Prozesse.
- Die Bewertung des Gesetzesentwurfs im Hinblick auf seine Effektivität und Gerechtigkeit.
- Die Herausforderungen bei der Implementierung einer Pkw-Maut in Deutschland.
- Der Vergleich verschiedener theoretischer Modelle zur Erklärung der Maut-Debatte.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Pkw-Maut in Deutschland ein und beleuchtet die lange und kontroverse Geschichte der Debatte. Sie hebt die politischen und ökonomischen Kontroversen hervor und begründet die Notwendigkeit einer kritischen Analyse des aktuellen Gesetzesentwurfs. Die Einleitung stellt die Struktur der Arbeit vor und kündigt die bevorstehende Untersuchung theoretischer Modelle und die anschließende Bewertung des aktuellen Gesetzesvorschlags an.
2. Straßenübernutzung als gesellschaftliches Problem: Dieses Kapitel definiert Straßenübernutzung als gesellschaftliches Problem und untersucht verschiedene Ansätze aus politikwissenschaftlicher und volkswirtschaftlicher Perspektive. Es werden "public policies" als Lösungsansätze vorgestellt und die unterschiedlichen methodischen Zugänge beider Disziplinen verglichen. Der Fokus liegt auf der komplementären Natur der beiden Perspektiven und dem daraus resultierenden Erkenntnisgewinn durch ihre Kombination.
Schlüsselwörter
Pkw-Maut, Deutschland, ökonomische Analyse, politikwissenschaftliche Perspektive, Gesetzesentwurf, Straßenübernutzung, gesellschaftliches Problem, public policies, externe Effekte, EU-Kommission, Diskriminierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Ökonomische und Politikwissenschaftliche Analyse des Pkw-Maut-Gesetzesentwurfs
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert kritisch den Gesetzesentwurf zur Pkw-Maut in Deutschland aus ökonomischer und politikwissenschaftlicher Perspektive. Sie untersucht die Debatte um die Maut, die damit verbundenen gesellschaftlichen Probleme und bewertet den Gesetzesentwurf anhand theoretischer Modelle.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den ökonomischen Aspekten der Pkw-Maut und ihren Auswirkungen auf den Verkehrssektor, der politikwissenschaftlichen Analyse des Maut-Gesetzes und der politischen Prozesse, der Bewertung des Gesetzesentwurfs hinsichtlich Effektivität und Gerechtigkeit, den Herausforderungen bei der Implementierung und dem Vergleich verschiedener theoretischer Modelle zur Erklärung der Maut-Debatte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Straßenübernutzung als gesellschaftliches Problem (inklusive ökonomischer und politikwissenschaftlicher Perspektiven und der Analyse von "public policies"), ein Kapitel zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer Maut (mit ökonomischer und politikwissenschaftlicher Betrachtung), und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein, stellt die Struktur vor und begründet die Notwendigkeit einer kritischen Analyse. Das Kapitel zur Straßenübernutzung definiert das Problem und untersucht verschiedene Lösungsansätze. Das Kapitel zum Gesetzesentwurf analysiert diesen aus verschiedenen Perspektiven. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Pkw-Maut, Deutschland, ökonomische Analyse, politikwissenschaftliche Perspektive, Gesetzesentwurf, Straßenübernutzung, gesellschaftliches Problem, public policies, externe Effekte, EU-Kommission, Diskriminierung.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit kombiniert ökonomische und politikwissenschaftliche Perspektiven, um ein umfassenderes Verständnis des Themas zu ermöglichen. Es werden theoretische Modelle herangezogen, um die Maut-Debatte zu analysieren und den Gesetzesentwurf zu bewerten. Die Arbeit vergleicht die methodischen Zugänge beider Disziplinen und hebt die komplementäre Natur ihrer Perspektiven hervor.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, eine kritische Analyse des Gesetzesentwurfs zur Pkw-Maut zu liefern und die damit verbundenen ökonomischen und politikwissenschaftlichen Aspekte umfassend zu beleuchten. Sie möchte die Debatte um die Maut besser verstehen und die Effektivität und Gerechtigkeit des Gesetzesentwurfs bewerten.
- Arbeit zitieren
- Fabian Grimm (Autor:in), 2017, Die Pkw-Maut in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/442384