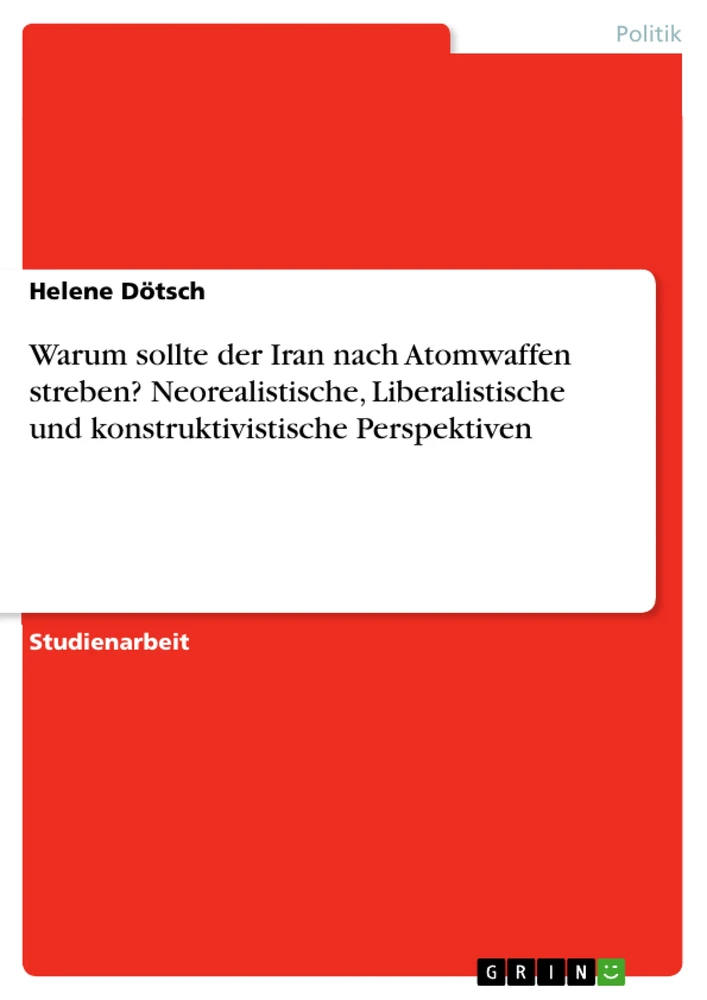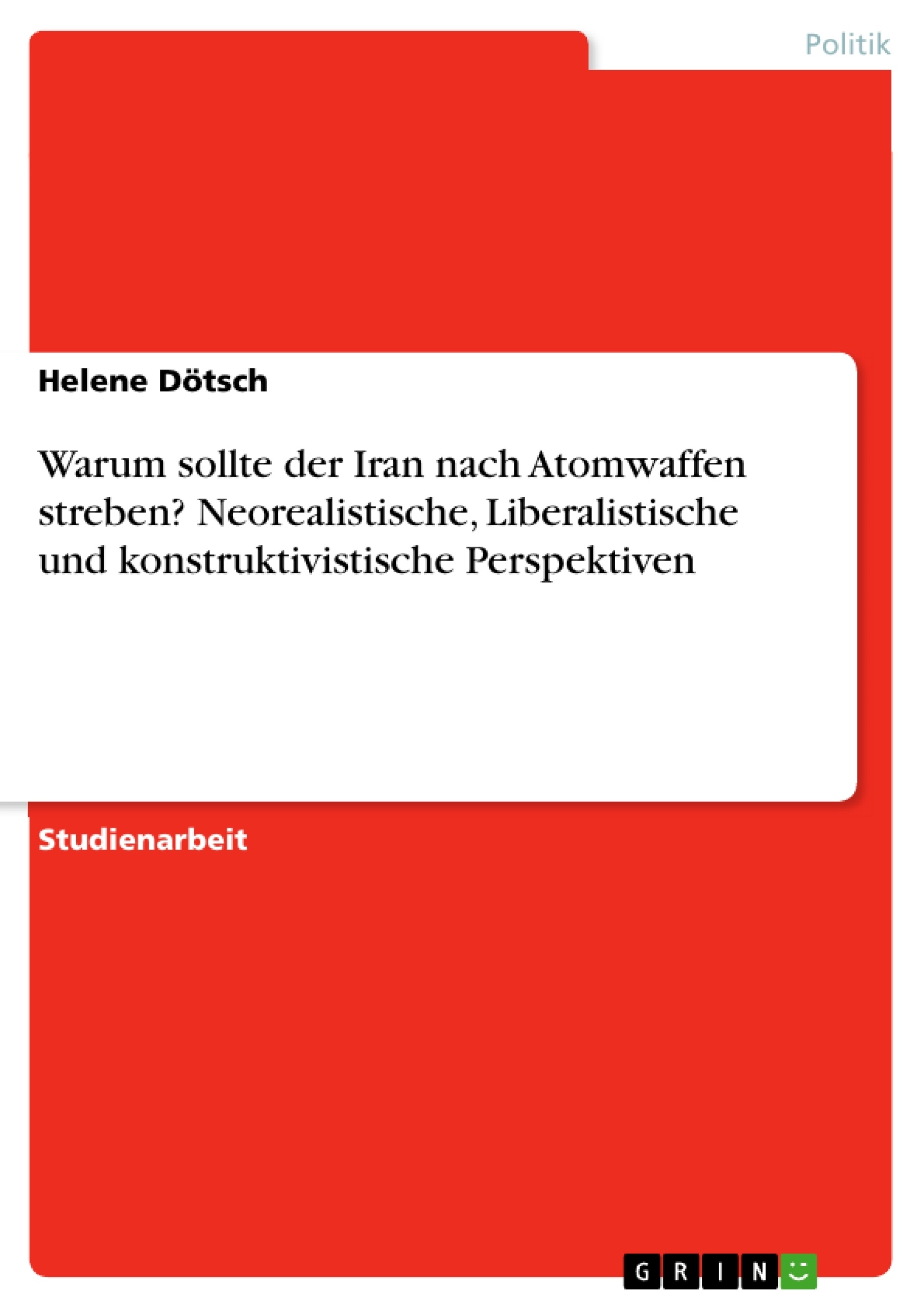Warum sollte der Iran nach Atomwaffen streben und wie kam es zur Einigung über den Konflikt? Um diese Krise zu untersuchen werden drei verschiedene Ansätze der Theorien der internationalen Beziehungen betrachtet. Dabei wird der Neorealismus von Kenneth Waltz, der Interdependenzansatz von Robert O. Keohane und Joseph Nye sowie die konstruktivistische Theorie Alexander Wendts auf die außenpolitische Strategie des Irans in Bezug auf das Streben nach einer Nuklearwaffe angewandt. Die einzelnen Ansätze werden unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert und in einem abschließenden Resümee soll deren Erklärungskraft miteinander verglichen werden. „Iran seeks constructive engagement with other countries based on mutual respect and common interest“ Mit dieser Aussage wandte sich der derzeitige Präsident des Irans Hassan Rouhani 2013 an die Weltöffentlichkeit. Er spricht dabei über das Atomabkommen zwischen dem Iran und den Großmächten Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und nicht zuletzt den Vereinigten Staaten. Der Nukleardeal ist ein Meilenstein in der Beilegung des seit 13 Jahren andauernden Konfliktes um das iranische Nuklearprogramm. Teheran wurde mehr als ein Jahrzehnt lang unterstellt, nach Atomwaffen zu streben, was seit den Erfahrungen der zwei Weltkriege und dem Kalten Krieg mithilfe des Nonprofilerationsvertrages eingedämmt werden sollte.
Die Literatur in den Theorien der internationalen Beziehungen ist vielschichtig und umfangreich. Zu den großen Strängen der internationalen Beziehungen gehören der Realismus, der Liberalismus und der Konstruktivismus. Die neorealistische Strömung wird durch das Hauptwerk des Wissenschaftlers Kenneth Waltz „Theory of international politics“ (1979) angeführt. Das Werk ist eine gelungene Einführung zur Orientierung und zum Erlangen von Basiswissen zum Neorealismus. Die Theorie der Interdependenz wird hauptsächlich in dem Werk „Power and Interdependence“ (1977) von Robert O. Keohane und Joseph Nye entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literaturbericht
- Neorealismus nach Kenneth Waltz
- Interdependenzansatz nach Keohane und Nye
- Die komplexe Interdependenz
- Konstruktivismus nach Alexander Wendt
- Die Identität
- Die internationale Struktur
- Das iranische Atomprogramm
- Neorealismus: Die regionale Ordnung als Bedrohung für das Überleben Teherans?
- Das Nuklearabkommen aus neorealistischer Perspektive
- Der Interdependenz-Ansatz: Sanktionen als Konsequenz asymmetrischer Verwundbarkeitsverteilung?
- Sensibilitätsanalyse und Vulnerabilitätsanalyse des Irans
- Interessenkonflikt zwischen ökonomischen Kräften und militärischer Macht? - Die komplexe Interdependenz
- Iran- Ein Schurkenstaat? Eine konstruktivistische Analyse der iranischen Identität
- Rollen- und Typenidentität der islamischen Republik
- Vom Schurkenstaat zum anerkannten Verhandlungspartner?
- Zwischen den Perspektiven
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, warum der Iran nach Atomwaffen streben könnte und wie es zum Atomabkommen kam. Dafür werden drei Theorien der internationalen Beziehungen herangezogen: der Neorealismus, der Interdependenzansatz und der Konstruktivismus. Die einzelnen Ansätze werden auf die iranische Außenpolitik im Bezug auf das Atomprogramm angewendet und im Hinblick auf ihre Erklärungskraft verglichen.
- Analyse des iranischen Atomprogramms unter verschiedenen theoretischen Perspektiven
- Anwendung des Neorealismus, des Interdependenzansatzes und des Konstruktivismus auf den iranischen Fall
- Bewertung der Erklärungskraft der verschiedenen Theorien
- Untersuchung der Rolle von Sanktionen und der asymmetrischen Verwundbarkeitsverteilung
- Konstruktivistische Betrachtung der iranischen Identität und deren Einfluss auf die Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des iranischen Atomprogramms und des Atomabkommens ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für das iranische Streben nach Atomwaffen und nach dem Weg zur Einigung. Der Fokus liegt auf der Anwendung dreier Theorien der internationalen Beziehungen – Neorealismus, Interdependenz und Konstruktivismus – zur Analyse des Konflikts.
Literaturbericht: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über relevante Literatur zu den Theorien der internationalen Beziehungen (Realismus, Liberalismus, Konstruktivismus) und zum iranischen Atomprogramm. Er nennt wichtige Werke und Autoren, die für die Analyse des Themas relevant sind und liefert einen Einblick in den Forschungsstand.
Neorealismus nach Kenneth Waltz: Dieses Kapitel beschreibt den neorealistischen Ansatz von Kenneth Waltz und seine Anwendung auf das iranische Atomprogramm. Es analysiert das internationale System als anarchisch und betont die Rolle von Macht und Überlebensstreben der Staaten. Die Theorie wird verwendet, um die regionale Ordnung als potenzielle Bedrohung für den Iran zu interpretieren und das Nuklearabkommen aus dieser Perspektive zu beleuchten. Das Kapitel diskutiert Waltzs Kernargumente und wie sie sich auf das iranische Streben nach Atomwaffen auswirken könnten.
Interdependenzansatz nach Keohane und Nye: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Interdependenzansatz von Keohane und Nye, der die komplexen Verflechtungen zwischen Staaten betont und die Rolle von Sanktionen als Konsequenz einer asymmetrischen Verwundbarkeitsverteilung analysiert. Es wird untersucht, wie der Iran durch Sanktionen beeinflusst wurde und ob ein Interessenkonflikt zwischen ökonomischen Kräften und militärischer Macht bestand. Der Schwerpunkt liegt auf der Anwendung des Konzepts der komplexen Interdependenz auf den iranischen Fall.
Konstruktivismus nach Alexander Wendt: Dieses Kapitel behandelt den konstruktivistischen Ansatz von Alexander Wendt, der die Rolle von Ideen, Identitäten und Normen in den internationalen Beziehungen hervorhebt. Es wird analysiert, wie die konstruierte Identität des Irans als „Schurkenstaat“ seine Außenpolitik beeinflusst hat und ob sich diese Identität im Laufe der Zeit verändern könnte. Die Rolle von Rollen- und Typenidentität im Kontext des iranischen Atomprogramms steht im Mittelpunkt der Analyse.
Schlüsselwörter
Iran, Atomprogramm, Nuklearabkommen, Neorealismus, Interdependenz, Konstruktivismus, Sanktionen, nationale Identität, regionale Sicherheit, Machtpolitik, internationale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse des iranischen Atomprogramms
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gründe für das iranische Streben nach Atomwaffen und den Weg zum Atomabkommen. Sie untersucht, wie drei Theorien der internationalen Beziehungen – Neorealismus, Interdependenzansatz und Konstruktivismus – das iranische Atomprogramm erklären können.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit wendet den Neorealismus (Kenneth Waltz), den Interdependenzansatz (Keohane und Nye) und den Konstruktivismus (Alexander Wendt) auf das iranische Atomprogramm an. Jeder Ansatz wird separat erläutert und seine Erklärungskraft im Hinblick auf den iranischen Fall bewertet.
Wie wird der Neorealismus angewendet?
Der Neorealismus betrachtet das internationale System als anarchisch und betont die Bedeutung von Macht und Überlebensstreben. Die Arbeit untersucht, wie die regionale Ordnung als potenzielle Bedrohung für den Iran interpretiert werden kann und wie das Nuklearabkommen aus neorealistischer Perspektive zu bewerten ist.
Wie wird der Interdependenzansatz angewendet?
Der Interdependenzansatz betont die komplexen Verflechtungen zwischen Staaten. Die Arbeit analysiert die Rolle von Sanktionen als Konsequenz einer asymmetrischen Verwundbarkeitsverteilung und untersucht einen möglichen Interessenkonflikt zwischen ökonomischen Kräften und militärischer Macht im Iran.
Wie wird der Konstruktivismus angewendet?
Der Konstruktivismus betont die Rolle von Ideen, Identitäten und Normen. Die Arbeit analysiert, wie die konstruierte Identität des Irans als „Schurkenstaat“ seine Außenpolitik beeinflusst hat und ob diese Identität sich im Laufe der Zeit verändern könnte. Die Rolle von Rollen- und Typenidentität wird im Kontext des Atomprogramms untersucht.
Welche Aspekte des iranischen Atomprogramms werden untersucht?
Die Arbeit analysiert das iranische Atomprogramm unter verschiedenen theoretischen Perspektiven, untersucht die Rolle von Sanktionen und der asymmetrischen Verwundbarkeitsverteilung, und betrachtet konstruktivistisch die iranische Identität und deren Einfluss auf die Außenpolitik.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, einen Literaturbericht, Kapitel zum Neorealismus, Interdependenzansatz und Konstruktivismus (jeweils mit Bezug zum iranischen Atomprogramm), einen Abschnitt zum Vergleich der Perspektiven, und ein Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Iran, Atomprogramm, Nuklearabkommen, Neorealismus, Interdependenz, Konstruktivismus, Sanktionen, nationale Identität, regionale Sicherheit, Machtpolitik, internationale Beziehungen.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Warum strebt der Iran nach Atomwaffen, und wie kam es zum Atomabkommen?
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Arbeit bietet für jedes Kapitel eine kurze Zusammenfassung, die die behandelten Themen und den Schwerpunkt der Analyse erläutert. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels und die angewandte Methodik.
- Quote paper
- Helene Dötsch (Author), 2016, Warum sollte der Iran nach Atomwaffen streben? Neorealistische, Liberalistische und konstruktivistische Perspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/441187