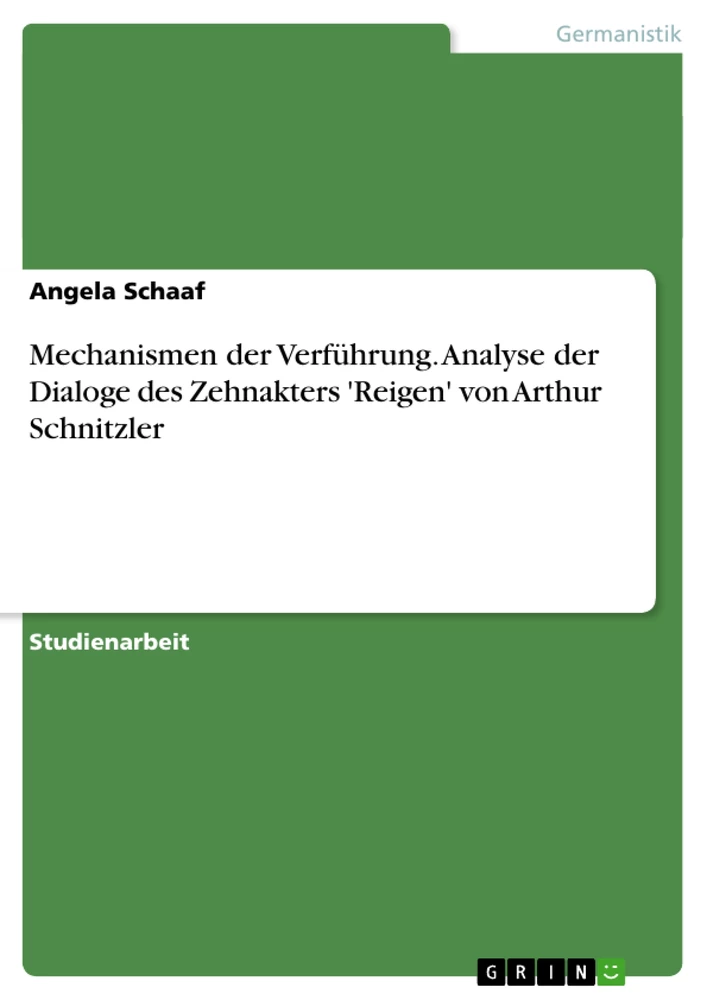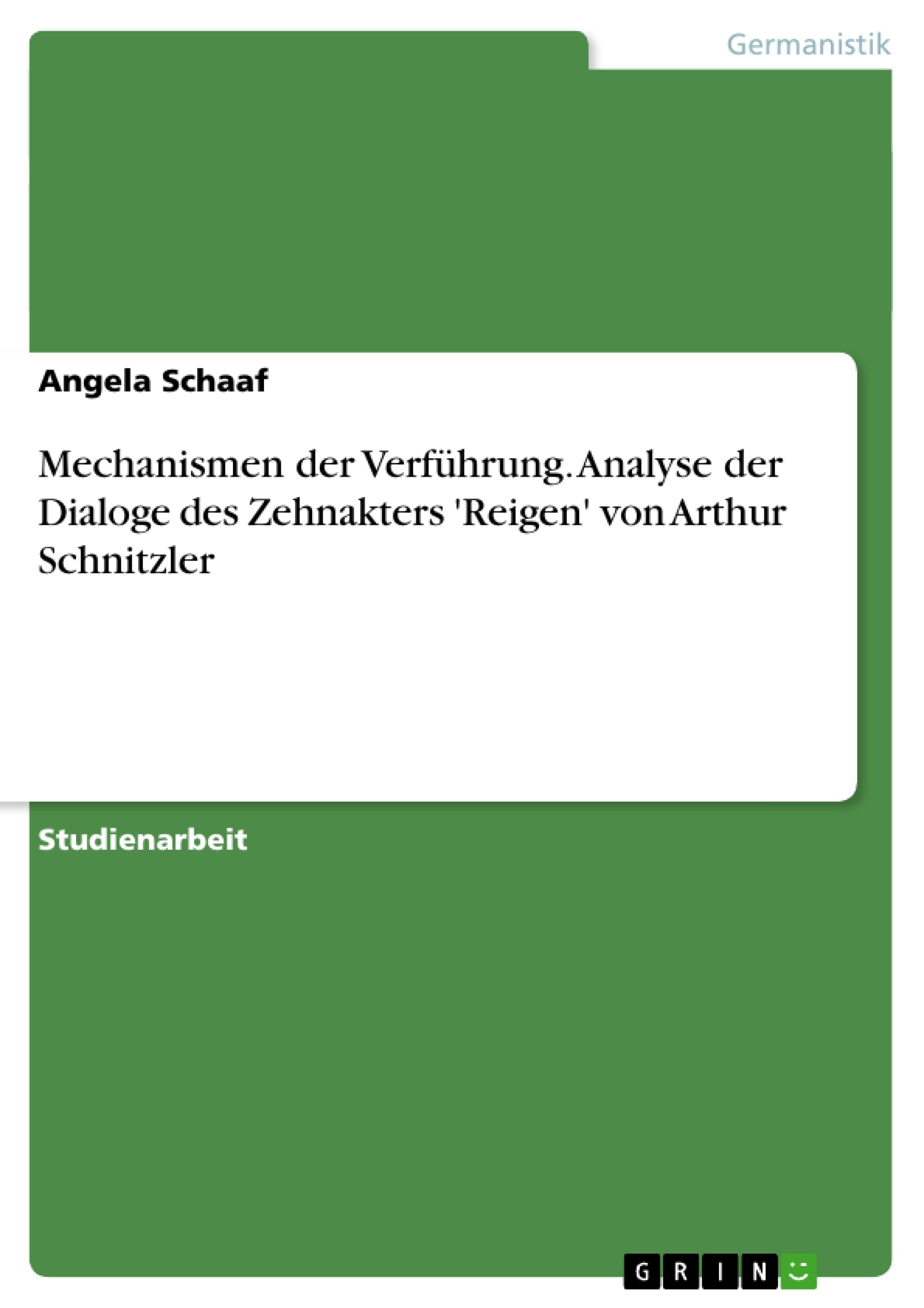Mit dem Machtantritt Kaiser Franz Josephs I. im Jahre 1848 beginnt in Wien, seit 1867 Hauptstadt des neu gegründeten Österreichisch-Ungarischen Reiches, eine Phase der Modernisierung und Liberalisierung. Vor allem die Zeit um die Jahrhundertwende - das Fin de Siècle - zeichnet sich aus durch Umbruch und Veränderung in nahezu allen Lebensbereichen, von denen die Industrialisierung wohl als eingreifendste Entwicklung bezeichnet werden kann. Sie löst einen Zuwanderungsstrom aus allen Teilen des Reiches in die Hauptstadt aus, welche sich innerhalb weniger Jahrzehnte von einer Halbmillionenstadt zur modernen Donaumetropole mit zwei Millionen Einwohnern im Jahr 1905 entwickelt. In positiver Hinsicht bewirkt jener Bevölkerungszuwachs eine ethnische, sprachliche und religiöse Vielfalt und damit einhergehende weltoffene Lebenseinstellung der Bürger Wiens. Negative Auswirkungen zeitigt allerdings das Problem der Unterbringung der neuen Einwohner: Bis an die Hänge des Wienerwaldes breitet sich bald ein gleichförmiges Raster vier- bis fünfgeschossiger Mietshausblöcke aus, in denen das Leben der Bewohner gekennzeichnet ist durch Armut, Beengtheit und mangelnde Hygiene. Doch nicht nur in ökonomischer Hinsicht ist das Fin de Siècle eine Zeit des Umbruchs. In der Architektur entstehen neben den weniger ansehnlichen Mietskasernen repräsentative Bauten an der neuen Ringstraße. In der Kunst spaltet sich eine Gruppe junger Künstler um Gustav Klimt vom traditionellen Kunstbetrieb ab und setzt als Wiener Secession neue Maßstäbe. Sigmund Freud entwickelt die Psychoanalyse und setzt „sich in seinen Texten radikal für gelockerte Sexual- und Partnerschaftsformen“ ein. Nahezu beispiellos scheint ebenso die literarische Schaffenskraft jener Zeit. Die Werke von Autoren wie Hugo von Hoffmannsthal, Richard Beer-Hofmann, Stefan Zweig und selbstverständlich Arthur Schnitzler legen bis heute anschaulich Zeugnis ab vom Geiste jener Auf- und Umbruchszeit. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine Gesellschaft im Umbruch: Wien zur Zeit des Fin de Siècle.
- Arthur Schnitzler - ein Kind seiner Zeit.
- Der Reigen.
- Rezeptionsgeschichte.
- Analyse der Dialoge.
- Die Dirne und der Soldat.
- Der Soldat und das Stubenmädchen.
- Das Stubenmädchen und der junge Herr.
- Der junge Herr und die junge Frau.
- Die junge Frau und der Ehemann.
- Der Ehemann und das süße Mädel.
- Das süße Mädel und der Dichter.
- Der Dichter und die Schauspielerin.
- Die Schauspielerin und der Graf.
- Der Graf und die Dirne.
- Ergebnisse.
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Analyse der Dialoge des Zehnakters "Reigen" von Arthur Schnitzler, wobei der Fokus auf den Mechanismen der Verführung liegt. Ziel ist es, die sprachlichen Mittel und Strategien aufzudecken, die die Figuren in ihren Dialogen einsetzen, um ihre Gesprächspartner zu verführen und zu manipulieren. Die Arbeit untersucht, wie Sprache im Kontext der sexuellen und sozialen Verhältnisse des Fin de Siècle eingesetzt wird, um Machtverhältnisse und soziale Normen zu reflektieren.
- Sprache als Werkzeug der Verführung
- Die Rolle der Dialoge in der Darstellung der Geschlechterrollen
- Die Bedeutung der sozialen Normen und Konventionen im Wiener Fin de Siècle
- Das Verhältnis von Sprache und Sexualität
- Arthur Schnitzlers Darstellung der gesellschaftlichen Doppelmoral
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüche in Wien zur Zeit des Fin de Siècle, wobei insbesondere die Auswirkungen der Industrialisierung und die Rolle der Frauen im Wandel stehen im Mittelpunkt.
Das Kapitel "Der Reigen" führt in die Rezeptionsgeschichte des Werkes ein und widmet sich der Analyse der Dialoge der einzelnen Figuren. Es werden die wichtigsten sprachlichen Mittel und Strategien der Verführung in den einzelnen Dialogen beleuchtet, wobei die Machtverhältnisse und sozialen Normen im Kontext der sexuellen Begegnungen der Figuren deutlich werden.
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, "Reigen", Fin de Siècle, Verführung, Dialoge, Sprache, Sexualität, Geschlechterrollen, gesellschaftliche Doppelmoral, Wien, Österreich, Kulturgeschichte.
- Quote paper
- Angela Schaaf (Author), 2003, Mechanismen der Verführung. Analyse der Dialoge des Zehnakters 'Reigen' von Arthur Schnitzler, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/44010