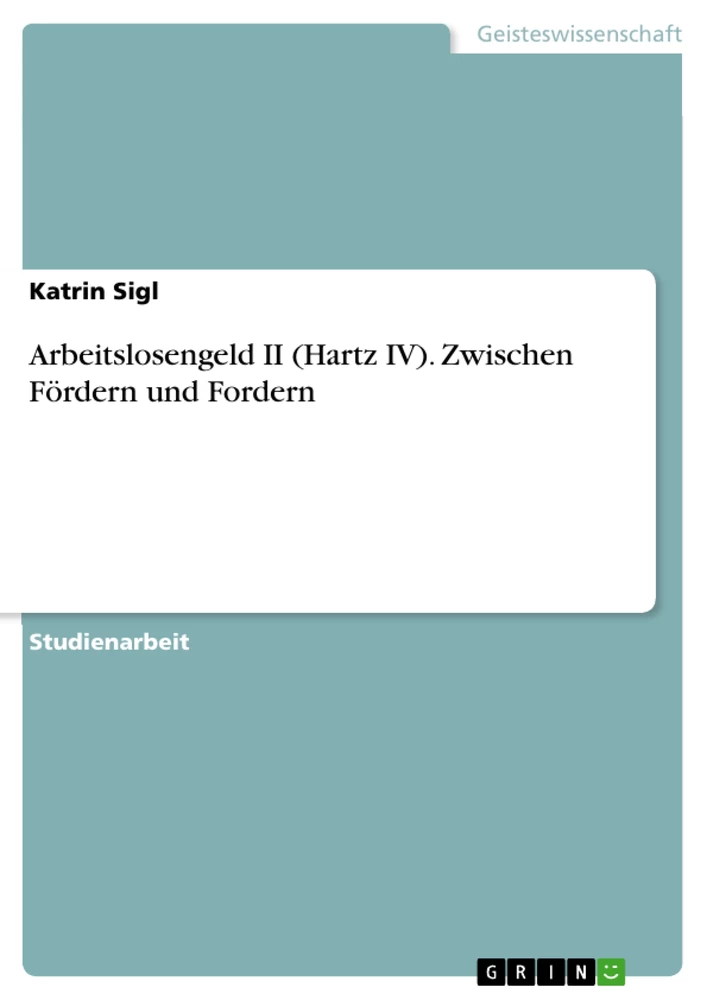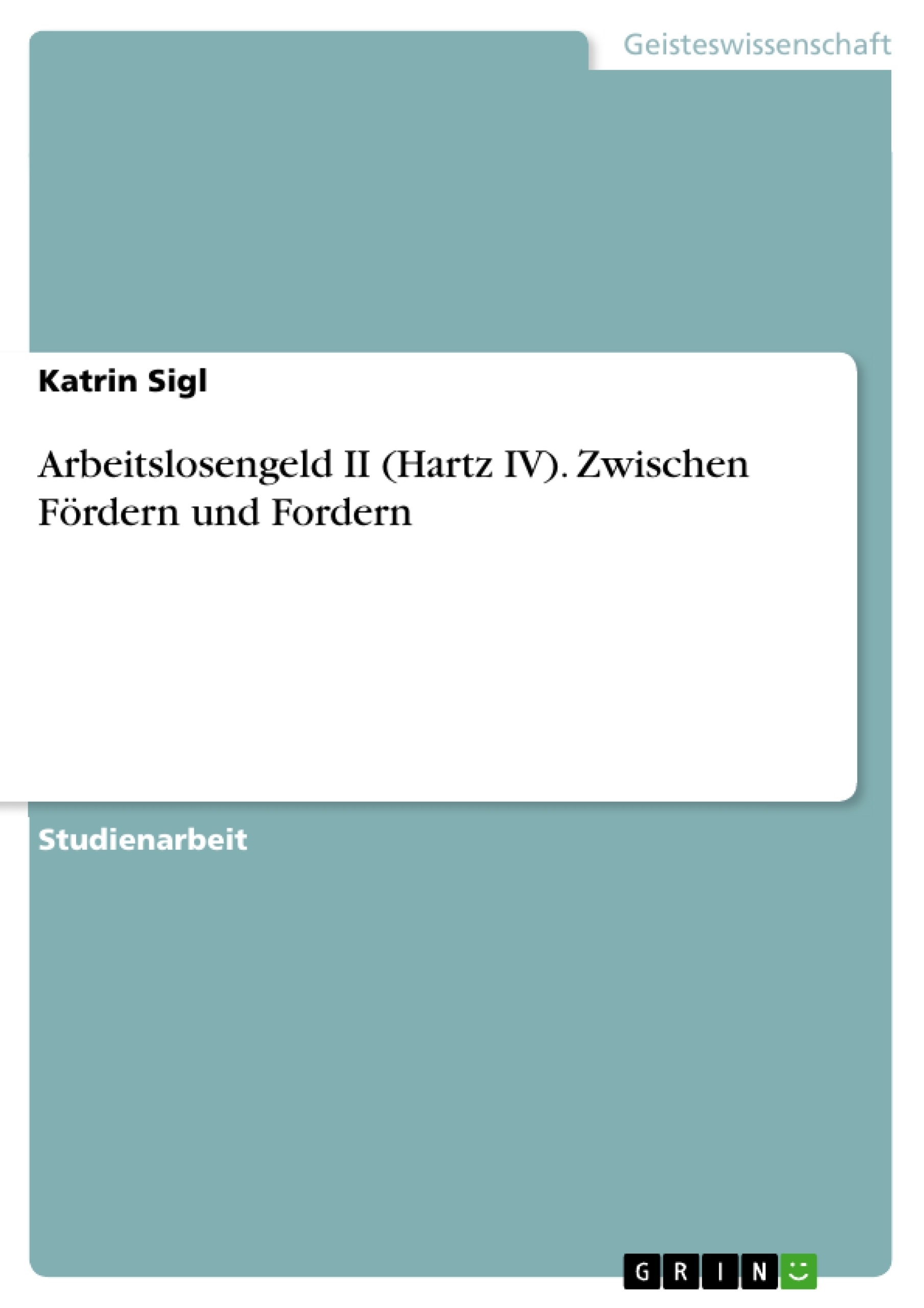Die zentrale Thematik dieser Arbeit ist, wie sich das Prinzip des Förderns und Forderns auf allen Ebenen des Arbeitslosengeldes II wiederfindet. Zunächst wird die Entstehung der jetzigen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik und dem damit einhergehenden Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik beschrieben. Kurz wird auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende als Existenzsicherung eingegangen. Danach folgen Ausführungen zum Prinzip des Förderns und Forderns und die damit zusammenhängende Problematik. Weiter wird auf die Förderungen und Maßnahmen im Rahmen des SGB II und SGB III eingegangen. Vor der Schlussbemerkung werden noch einige Aufgabenbereiche des Jobcenters benannt und die Anforderungen denen Jobcenter Angestellten gerecht werden müssen.
Deutschland ist ein Sozialstaat – dies ist im Grundgesetz durch Art. 20 Abs. 1 i. V. m. Art. 28 Abs. 1 GG verankert. Doch damit ein Staat sich als solcher bezeichnen kann benötigt es zur Textpassage im Gesetz auch deren Verwirklichung. „Aus dem Würdegebot und dem Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes folgt, dass jeder in Würde leben können muss – mit und ohne Arbeit. Teilzuhaben am Leben der Gesellschaft ist ein menschliches Grundbedürfnis und deshalb auch ein Grundrecht.“ (Segbers 2009) Ein Sozialstaat soll für eine soziale Gerechtigkeit sorgen und seine Bürger und Bürgerinnen sozial absichern. Dass Deutschland diesbezüglich bereits viel leistet ist nicht in Frage gestellt. Es gibt verschiedene, in der Regel verpflichtende, Versicherung welche bei Arbeitslosigkeit, bei Unfall, bei Arbeitsunfähigkeit, bei Krankheit, bei Pflegebedürftigkeit einspringen und im Alter eine Rente zahlen. Weiter bietet die soziale Gesetzgebung finanzielle Transferleistungen die der Staat aus eigener Kasse finanziert, wie beispielsweise Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, Sozialhilfe, etc. Auch dazu gehört das Arbeitslosengeld II (ALG II), besser bekannt als Hartz IV, jedoch offiziell als Grundsicherung für Arbeitssuchende bezeichnet.
Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB II erhalten Leistungen, erwerbsfähige Personen welche das 15. Lebensjahr vollendet und die gesetzlich festgelegte Altersgrenze noch nicht erreicht haben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und hilfebedürftig sind. Als erwerbsfähig gilt wer mindestens 3 Stunden am Tag arbeiten kann (vgl. § 8 SGB II) und als hilfebedürftig der seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Einkommen oder Vermögen finanzieren kann. (vgl. § 9 SGB II)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung des Arbeitslosengeldes II
- Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik
- Grundsicherung für Arbeitssuchende als Existenzsicherung
- Prinzip des Förderns und Forderns
- Problematik der Aktivierung
- Maßnahmen und Förderungen
- Aufgabenbereich und Anforderungen an die Angestellten
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Prinzip des Förderns und Forderns im Kontext des Arbeitslosengeldes II (ALG II). Sie analysiert die Entstehung der aktuellen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik und den damit verbundenen Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik. Dabei wird insbesondere auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende als Existenzsicherung eingegangen. Darüber hinaus untersucht die Arbeit die Implementierung des Prinzips des Förderns und Forderns, die damit verbundenen Problematiken sowie die im Rahmen des SGB II und SGB III angebotenen Förderungen und Maßnahmen. Schließlich werden die Aufgabenbereiche des Jobcenters und die Anforderungen an dessen Angestellte beleuchtet.
- Entstehung des Arbeitslosengeldes II und der Hartz-Reformen
- Der Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik vom aktiven zum aktivierenden Sozialstaat
- Das Prinzip des Förderns und Forderns im Kontext von ALG II
- Problematiken der Aktivierung von Arbeitslosen
- Aufgabenbereiche und Anforderungen an Jobcenter-Angestellte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den deutschen Sozialstaat und dessen Bedeutung im Grundgesetz vor. Sie erklärt, warum ein Sozialstaat für die soziale Absicherung seiner Bürgerinnen und Bürger sorgen muss und wie das Arbeitslosengeld II (ALG II), besser bekannt als Hartz IV, in diesem Kontext einzuordnen ist.
Entstehung des Arbeitslosengeldes II
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Arbeitslosengeldes II und die damit verbundenen Reformen im Arbeitsmarkt. Es erklärt den Vermittlungsskandal und die verschiedenen Sozialsysteme, die vor der Einführung von Hartz IV existierten. Außerdem werden Debatten über den Umbau des Sozialstaates, die Aktivierung von Arbeitslosen und die Schaffung eines Grundeinkommens thematisiert. Die Kapitel beschreibt die beiden Kommissionen, die sich mit der Neuausrichtung und Zusammenlegung von Arbeits- und Sozialhilfe befassten, sowie die Einführung der Agenda 2010 und die Umsetzung des Sozialgesetzbuches II (Hartz IV).
Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik
Dieses Kapitel beschreibt den Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik vom aktiven zum aktivierenden Sozialstaat. Es erläutert die Unterschiede zwischen den beiden Modellen und beleuchtet das Prinzip des Förderns und Forderns, das mit Hartz IV einhergeht. Der Abschnitt beleuchtet die Kritik am aktivierenden Sozialstaat und den Anspruch auf ein Leben in Würde und Selbstbestimmung.
Grundsicherung für Arbeitssuchende als Existenzsicherung
Dieses Kapitel beschreibt die Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) und deren Ziel, Leistungsberechtigten ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Es erklärt die passiven Leistungen, die Armutsfestigkeit und das Existenzminimum, sowie dessen Bedeutung für ein menschenwürdiges Leben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Arbeitslosengeld II (ALG II), Hartz IV, Sozialstaat, aktivierender Sozialstaat, Prinzip des Förderns und Forderns, Grundsicherung für Arbeitssuchende, Existenzsicherung, Aktivierung, Jobcenter, Sozialpolitik, Arbeitsmarkt, Sozialgesetzbuch II (SGB II).
- Quote paper
- Katrin Sigl (Author), 2018, Arbeitslosengeld II (Hartz IV). Zwischen Fördern und Fordern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/439460