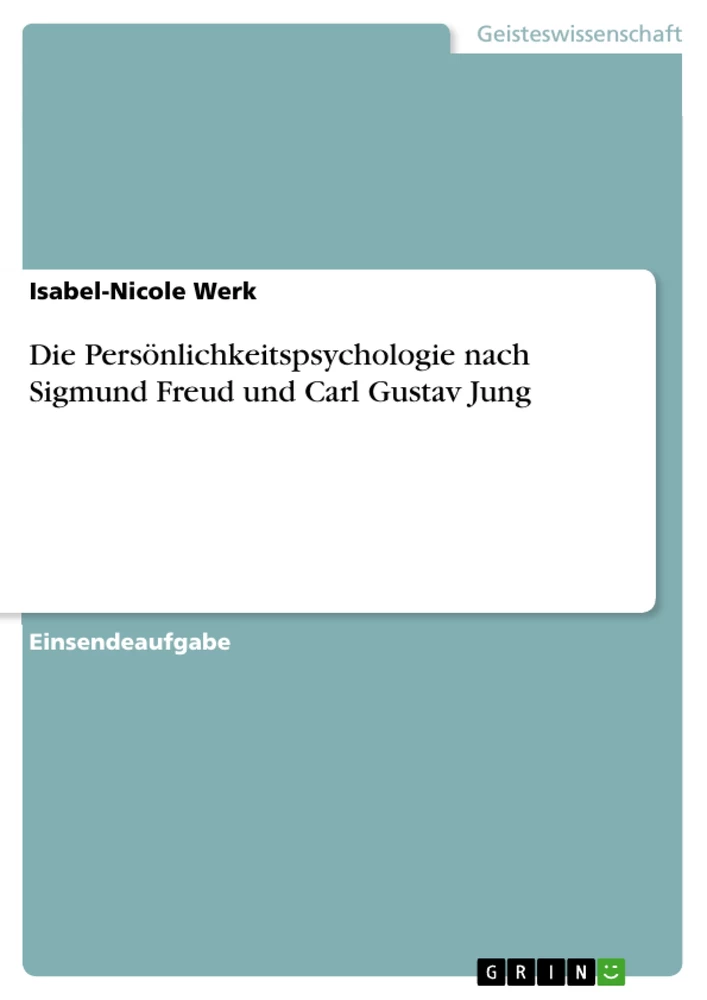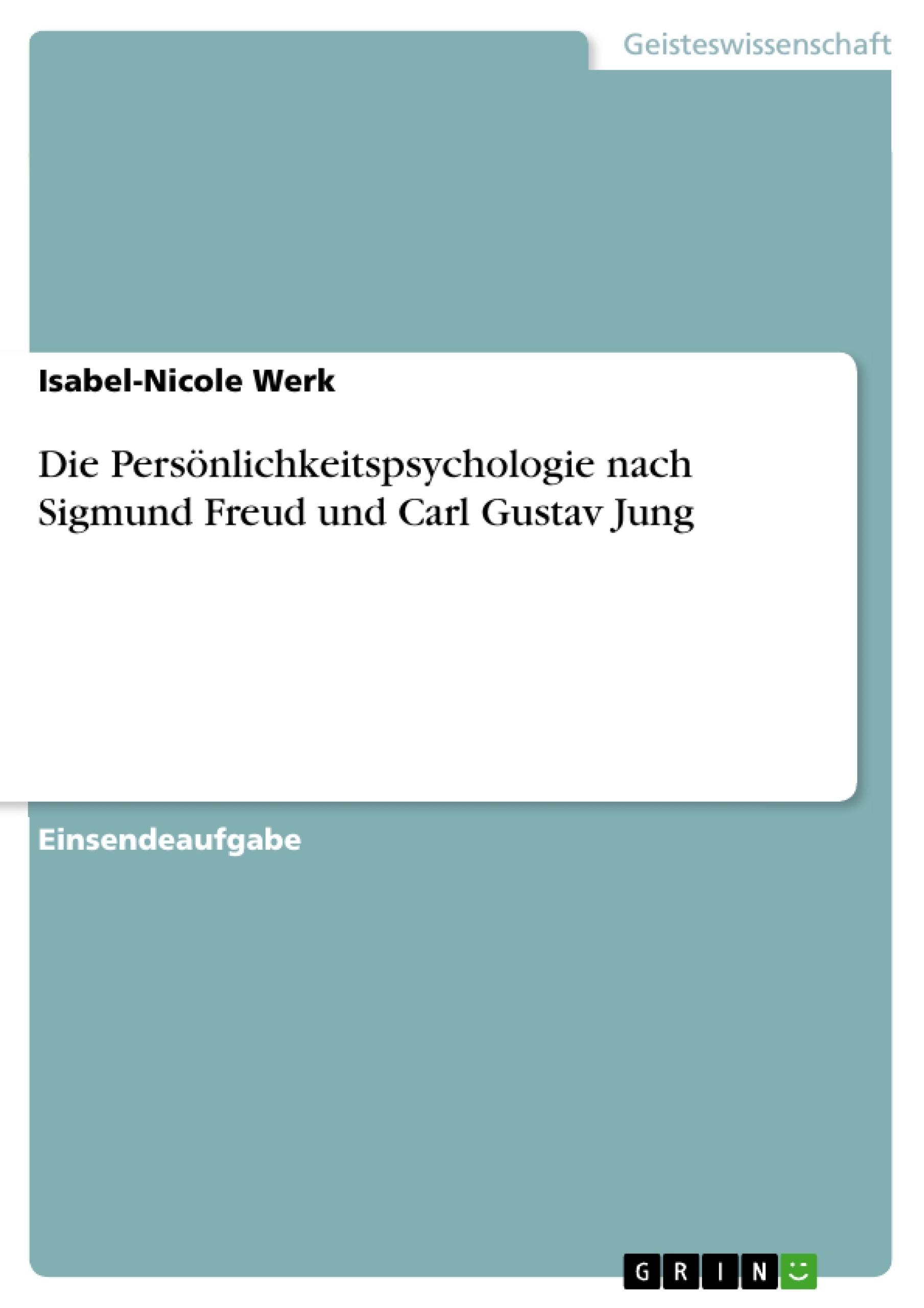Carl Gustav Jung distanzierte sich von seinem "Fachkollegen" Sigmund Freud, nachdem Jung sein Buch "Wandlungen und Symbole der Libido" veröffentlicht, in dem er Freuds Ansichten der Libido kritisiert. Vorfälle wie diese wirken insofern auf Jung, als dass er anfängt, sich zum Schutz vor der äußeren Welt, auf seine innere Welt zu konzentrieren. Jung hat daher schon in seiner unglücklichen tristen Kindheit das Gefühl, zwei Persönlichkeiten innezuhaben.
Die erste Persönlichkeit ist seine nach außen orientierte, objektive, oder auch "extravertierte" Persönlichkeit, die für seine Umgebung und die in seinem Umfeld befindlichen Personen sichtbar und beeinflussbar ist und mit ihnen kommuniziert. Die zweite Persönlichkeit ist die nach innen gerichtete, subjektive, oder auch "introvertierte" Persönlichkeit, in der er sich mit seiner inneren Wirklichkeit befasst und sich als machtvoll, philosophisch und mit Gott verbunden fühlt.
Diese Empfindung könnte laut Atwood und Tomkins darauf hindeuten, dass diese zwei Persönlichkeiten ihn dazu antreiben, sich als Psychiater ausbilden zu lassen. So veröffentlicht Jung 1921 sein Modell der "Psychologischen Typen", die auf seinen selbst wahrgenommenen gegensätzlichen Bewusstseinsinhalten des extravertierten und introvertierten Haupttypen basieren ("Jungsche Typenlehre"). Er geht darin davon aus, dass jeder Mensch eine Mischung dieser beiden "Grundeinstellungstypen" sei und dass der Typ, der bei einem Menschen überwiegt, seine Persönlichkeit ausmacht. Zusätzlich zu diesen Grundtypen, führt Jung noch vier Orientierungs- bzw. Bewusstseinsfunktionen ein, welche sich als zwei Gegensatzpaare wie folgt gegenüberstellen lassen: Denken und Fühlen, und Empfinden und Intuition. So entstehen nach der Jungschen Typenlehre durch die jeweiligen Kombinationsmöglichkeiten der zwei Haupttypen (Extraversion und Introversion) und der vier Bewusstseinsfunktionen (Denken, Fühlen, Empfinden, Intuition), 16 unterschiedliche Persönlichkeitstypen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Teilaufgabe C1
- 1.1 Jungsche Typenlehre
- 1.2 Das Unbewusste
- 1.2.1 C. G. Jung
- 1.2.2 Sigmund Freud
- 1.2.3 Fazit
- 1.3 Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI®)
- 2. Teilaufgabe C2
- 2.1 Soziale Unterstützung
- 2.2 Soziale Unterstützung und Gesundheit
- 2.3 Soziale Unterstützung - ein Persönlichkeitsmerkmal?
- 2.4 Soziale Unterstützung in einer Partnerschaft
- 3. Teilaufgabe C3
- 3.1 Stress
- 3.2 Transaktionales Stressmodell
- 3.2.1 Coping
- 3.2.2 Ressourcen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Persönlichkeitspsychologie. Ziel ist es, ausgewählte Konzepte und Theorien zu erläutern und deren Relevanz für das Verständnis von Persönlichkeit und sozialem Verhalten aufzuzeigen.
- Jungsche Typologie und das Unbewusste
- Der Einfluss sozialer Unterstützung auf die Gesundheit
- Das transaktionale Stressmodell und Copingmechanismen
- Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und sozialer Unterstützung
- Anwendung des Myers-Briggs-Typenindikators
Zusammenfassung der Kapitel
1. Teilaufgabe C1: Diese Teilaufgabe befasst sich eingehend mit der Jungschen Typenlehre, dem Unbewussten und dem Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI®). Sie beleuchtet Jungs Leben und die prägenden Einflüsse, die seine Theorie formten, insbesondere seine Auseinandersetzung mit Sigmund Freud und die Entwicklung seines Konzepts von Introversion und Extraversion. Der Abschnitt über das Unbewusste analysiert Jungs Sichtweise und deren Unterschiede zu Freuds Ansätzen. Abschließend wird der MBTI® als ein Instrument zur praktischen Anwendung der Jungschen Typologie vorgestellt. Die Kapitel veranschaulichen, wie Jungs persönliche Erfahrungen seine Theorie beeinflussten und wie diese Theorie in der Praxis angewendet werden kann.
2. Teilaufgabe C2: Dieser Abschnitt untersucht den Einfluss sozialer Unterstützung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Es wird der Begriff der sozialen Unterstützung definiert und verschiedene Facetten beleuchtet. Die Zusammenhänge zwischen sozialer Unterstützung und Gesundheit werden detailliert analysiert, mit einem Fokus auf die Bedeutung von sozialen Beziehungen für die psychische und physische Gesundheit. Die Frage, ob soziale Unterstützung als Persönlichkeitsmerkmal betrachtet werden kann, wird diskutiert, wobei die Kapitel den Einfluss auf Partnerschaften beleuchten. Die Analyse ermöglicht ein vertieftes Verständnis der Bedeutung von sozialen Netzwerken für die persönliche Entwicklung und das allgemeine Wohlbefinden.
3. Teilaufgabe C3: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf dem Verständnis von Stress und dem transaktionalen Stressmodell. Es wird erklärt, wie Individuen mit Stressoren umgehen (Coping) und welche Ressourcen dabei eine entscheidende Rolle spielen. Die Analyse des transaktionalen Modells verdeutlicht die dynamische Interaktion zwischen Person und Umwelt im Umgang mit Stresssituationen. Durch die Betrachtung von Coping-Strategien und Ressourcen wird ein umfassendes Bild der Stressbewältigung gezeichnet, welches für das Verständnis von individuellen Reaktionen auf Stress essentiell ist. Der Abschnitt bietet detaillierte Einblicke in die Prozesse der Stressverarbeitung und zeigt die Bedeutung von persönlichen Ressourcen und Strategien für eine erfolgreiche Bewältigung herausfordernder Situationen.
Schlüsselwörter
Persönlichkeitspsychologie, Jungsche Typenlehre, Unbewusstes, Introversion, Extraversion, soziale Unterstützung, Gesundheit, Stress, transaktionales Stressmodell, Coping, Ressourcen, Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI®), Sigmund Freud.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Persönlichkeitspsychologie
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Aspekte der Persönlichkeitspsychologie. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselbegriffe. Die Schwerpunkte liegen auf der Jungschen Typenlehre, dem Einfluss sozialer Unterstützung auf die Gesundheit und dem transaktionalen Stressmodell.
Welche Teilaufgaben werden behandelt?
Das Dokument gliedert sich in drei Teilaufgaben (C1, C2, C3). Teilaufgabe C1 behandelt die Jungsche Typenlehre, das Unbewusste und den Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI®). Teilaufgabe C2 konzentriert sich auf soziale Unterstützung und deren Einfluss auf die Gesundheit. Teilaufgabe C3 befasst sich mit Stress und dem transaktionalen Stressmodell, inklusive Coping-Mechanismen und Ressourcen.
Was ist die Jungsche Typenlehre und wie wird sie im Dokument behandelt?
Die Jungsche Typenlehre ist ein zentrales Thema in Teilaufgabe C1. Das Dokument erläutert Jungs Konzept von Introversion und Extraversion, seine Auseinandersetzung mit Sigmund Freud und die Entwicklung seiner Theorie des Unbewussten. Der Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI®) wird als praktische Anwendung der Jungschen Typologie vorgestellt.
Welche Rolle spielt soziale Unterstützung im Dokument?
Teilaufgabe C2 untersucht den Einfluss sozialer Unterstützung auf Gesundheit und Wohlbefinden. Es werden die Definition, verschiedene Facetten und die Zusammenhänge zwischen sozialer Unterstützung und psychischer sowie physischer Gesundheit detailliert analysiert. Die Frage, ob soziale Unterstützung als Persönlichkeitsmerkmal betrachtet werden kann, wird ebenfalls diskutiert.
Was ist das transaktionale Stressmodell und wie wird es erklärt?
Teilaufgabe C3 konzentriert sich auf das transaktionale Stressmodell. Das Dokument erklärt, wie Individuen mit Stressoren umgehen (Coping) und welche Ressourcen dabei wichtig sind. Die dynamische Interaktion zwischen Person und Umwelt im Umgang mit Stresssituationen wird analysiert, inklusive einer Betrachtung von Coping-Strategien und Ressourcen.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören: Persönlichkeitspsychologie, Jungsche Typenlehre, Unbewusstes, Introversion, Extraversion, soziale Unterstützung, Gesundheit, Stress, transaktionales Stressmodell, Coping, Ressourcen, Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI®), Sigmund Freud.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, ausgewählte Konzepte und Theorien der Persönlichkeitspsychologie zu erläutern und deren Relevanz für das Verständnis von Persönlichkeit und sozialem Verhalten aufzuzeigen.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument eignet sich für Personen, die sich akademisch mit Persönlichkeitspsychologie befassen. Der detaillierte Überblick und die klaren Zusammenfassungen machen es zu einer wertvollen Ressource für Studierende und Wissenschaftler.
- Quote paper
- Isabel-Nicole Werk (Author), 2017, Die Persönlichkeitspsychologie nach Sigmund Freud und Carl Gustav Jung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/437738