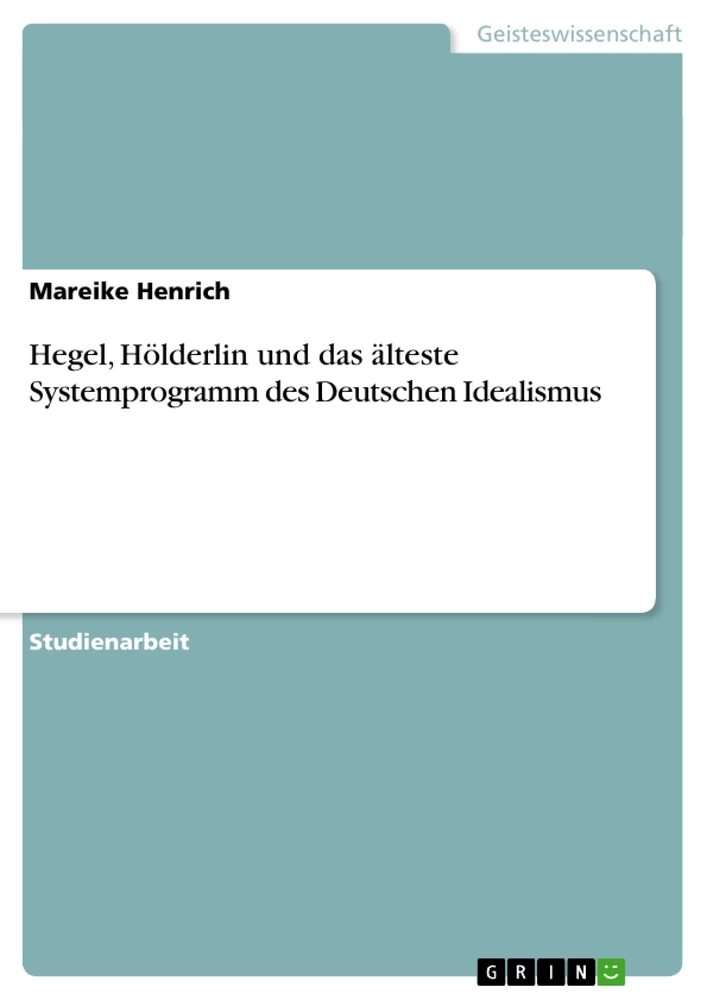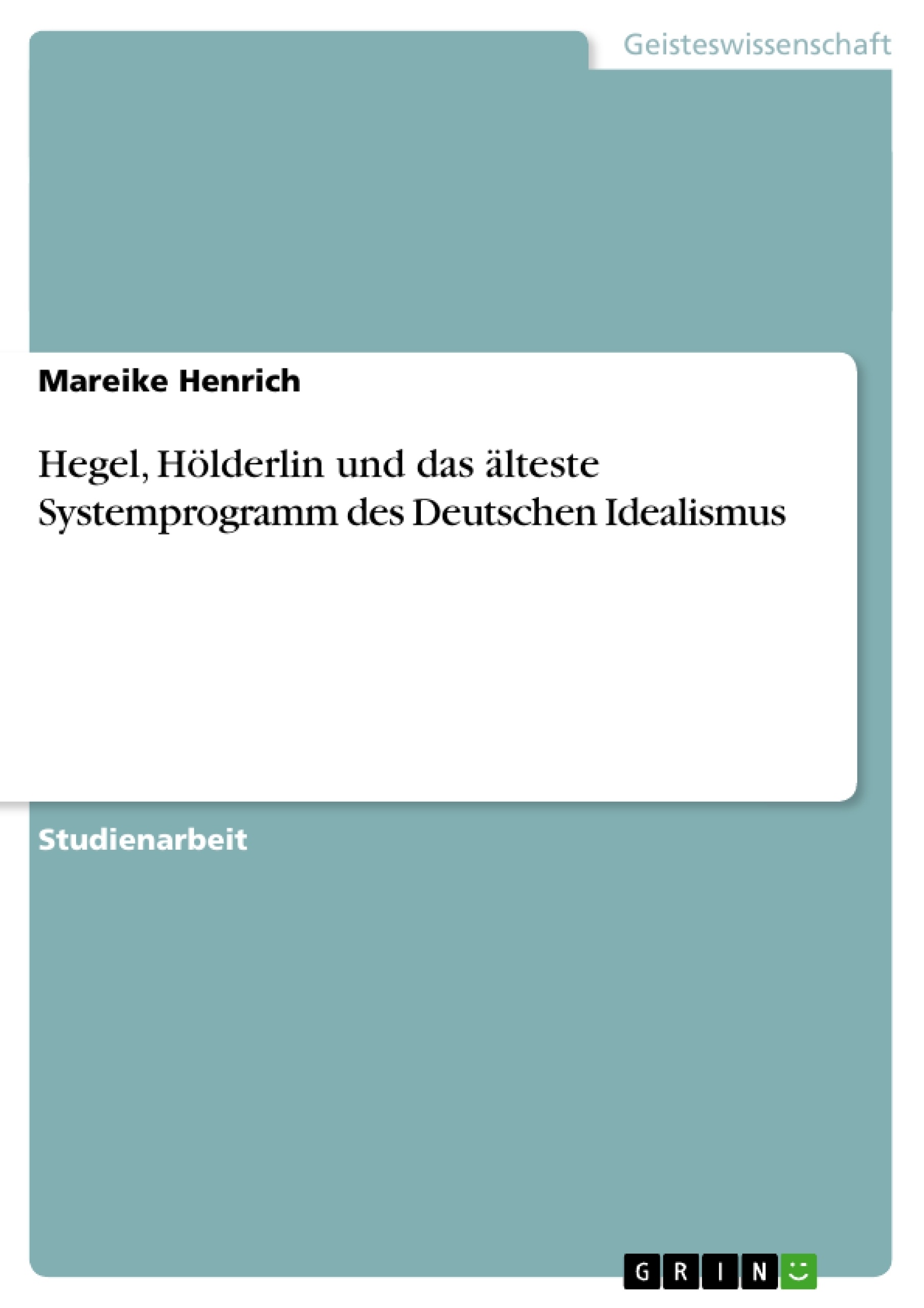"Dein Bild, Geliebter, tritt vor mich, / und der entfloh’nen Tage Lust; doch bald weicht sie / des Wiedersehens süssern Hoffnungen" - diese Zeilen finden sich in einem Gedicht, das Hegel im August 1796 in Bern niederschreibt. Es trägt den Titel "Eleusis" - und es ist Hölderlin gewidmet, dem Freund aus der Tübinger Studienzeit. Das Gedicht entsteht in Erwartung einer erneuten Begegnung mit Hölderlin in Frankfurt, wo Hegel im Januar 1797 eine Stelle als Hauslehrer antreten wird; es zeugt von der Hoffnung auf eine Erneuerung des "Bundes", in dem sich Hegel und Hölderlin in Tübingen verbrüdert sahen.
Tatsächlich wird die Begegnung mit Hölderlin in Frankfurt für Hegel mehr bedeuten als die Aufnahme einer alten Freundschaft. Der gedankliche Austausch mit dem Dichter, die Berührung mit dessen vereinigungsphilosophischen Ansätzen, wird Hegels eigenes Philosophieren in entscheidender Weise beeinflussen und ihm - unter anderem - den Anstoß zur endgültigen Überwindung seines Berner Kantianismus geben.
Das Gedicht "Eleusis", in dem sich Hegels Kritik an der Philosophie Kants bereits andeutet, lässt sich, wie Christoph Jamme schreibt, "gleichsam als Ouverture" des "gemeinsamen Frankfurter 'Symphilosophierens'" der beiden Freunde betrachten.
Es ist unmöglich, in einer Seminararbeit alle Facetten, alle Aspekte und alle Auswirkungen dieses 'Symphilosophierens' auf das jeweilige Gesamtwerk der beiden Denker aufzuzeigen. Im Folgenden soll deshalb versucht werden, die Grundgedanken der Hölderlinschen Vereinigungsphilosophie und Hegels Aufnahme dieser Denkmotive unter Bezugnahme auf einen wesentlichen Text, unter Bezugnahme auf "Das Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus", herauszuarbeiten. Eine Betrachtung des "Systemprogramms" ist in diesem Zusammenhang vor allem deshalb sinnvoll, weil in der zweiten Hälfte des von Hegel niedergeschriebenen Textes deutlich Hölderlins Einfluss erkennbar wird. Die zweite Texthälfte könne, so Jamme, gelesen werden "als Widerspiegelung von Hegels Begegnung mit Hölderlin, aufgrund derer er die Prinzipien seiner Philosophie entscheidend weiterentwickelte".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Überlieferung, Inhalt, Verfasserfrage
- Zur Überlieferung
- Zum inhaltlichen Aufbau des ,Systemprogramms'
- Schelling, Hegel, Hölderlin? Die Verfasserfrage
- Hölderlins Vereinigungsphilosophie und der Mittelteil des ältesten Systemprogramms
- Liebe und Schönheit. Hölderlins Vereinigungsphilosophie
- Gedankliche Begegnung im ,Systemprogramm‘
- Differenzen zwischen Hegel und Hölderlin
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Hölderlins Vereinigungsphilosophie auf Hegels frühes Denken, insbesondere im Kontext des „Ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus“. Sie analysiert die Überlieferung und den inhaltlichen Aufbau des Systemprogramms, beleuchtet die Verfasserfrage und vergleicht die philosophischen Positionen Hegels und Hölderlins. Der Fokus liegt auf der Rezeption von Hölderlins Ideen durch Hegel und deren Auswirkungen auf die Entwicklung seiner Philosophie.
- Das „Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“: Überlieferung, Inhalt und Verfasserfrage
- Hölderlins Vereinigungsphilosophie und ihre zentralen Elemente
- Hegels Rezeption von Hölderlins Ideen im „Systemprogramm“
- Vergleich der philosophischen Positionen Hegels und Hölderlins
- Die Bedeutung des „Systemprogramms“ für die Entwicklung von Hegels Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Entstehung des Gedichts "Eleusis" von Hegel und dessen Widmung an Hölderlin. Sie betont die Bedeutung des gedanklichen Austauschs zwischen Hegel und Hölderlin in Frankfurt und den Einfluss dieser Begegnung auf Hegels Philosophie, insbesondere die Überwindung seines Berner Kantianismus. Das "Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus" wird als zentraler Text für die Analyse der gegenseitigen Beeinflussung vorgestellt, wobei der Fokus auf dem zweiten Teil liegt, in dem Hölderlins Einfluss besonders deutlich wird. Die Arbeit gliedert sich in die Betrachtung der Überlieferung, des inhaltlichen Aufbaus und der Verfasserfrage des Systemprogramms, die Analyse der Vereinigungsphilosophie Hölderlins und deren Rezeption bei Hegel, sowie einen Vergleich der jeweiligen Positionen.
Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Überlieferung, Inhalt, Verfasserfrage: Dieses Kapitel behandelt die Überlieferung des „Ältesten Systemprogramms“, beginnend mit dem Erwerb des Manuskripts durch die Preußische Staatsbibliothek bis hin zur Klärung der Überlieferungsgeschichte durch Dieter Henrich. Es beschreibt den inhaltlichen Aufbau, der eine Metaphysik beinhaltet, die nach Kant in die Moral fällt und die Unvollständigkeit von Kants Trennung von theoretischer und praktischer Vernunft aufzeigt. Das Kapitel skizziert den Aufbau des „Systemprogramms“, das Denkmotive aus der Zeit um 1796/97 zusammenfasst und einen Übergang im Denken Hegels dokumentiert. Der Autor versucht, Kants Philosophie zu überwindung, indem er die Welt und das Ich als aus demselben Urgrund (dem Nichts) entspringend darstellt. Das Kapitel endet mit der Frage nach der Beschaffenheit der Welt für ein moralisches Wesen.
Hölderlins Vereinigungsphilosophie und der Mittelteil des ältesten Systemprogramms: Dieses Kapitel befasst sich mit Hölderlins Vereinigungsphilosophie, speziell mit den Begriffen Liebe und Schönheit als zentrale Elemente. Es analysiert den Einfluss dieser Philosophie auf den Mittelteil des „Systemprogramms“, in dem ästhetische Überlegungen des Autors dargelegt werden. Der Fokus liegt auf der gedanklichen Begegnung zwischen Hegel und Hölderlin, die sich in den im Systemprogramm formulierten Gedanken widerspiegelt. Die Zusammenfassung vertieft die Verbindung zwischen Hölderlins Philosophie und Hegels Rezeption im Kontext des Systemprogramms, ohne jedoch explizit den Inhalt des Mittelteils wiederzugeben, sondern dessen Bedeutung für die Gesamtaussage hervorzuheben.
Schlüsselwörter
Hegel, Hölderlin, Ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus, Vereinigungsphilosophie, Kantianismus, Metaphysik, Ästhetik, Moral, Ideen, Absolutes, Philosophiegeschichte, Einfluss, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen zum ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Hölderlins Vereinigungsphilosophie auf Hegels frühes Denken, insbesondere im Kontext des „Ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus“. Sie analysiert die Überlieferung und den inhaltlichen Aufbau des Systemprogramms, beleuchtet die Verfasserfrage und vergleicht die philosophischen Positionen Hegels und Hölderlins. Der Fokus liegt auf der Rezeption von Hölderlins Ideen durch Hegel und deren Auswirkungen auf die Entwicklung seiner Philosophie.
Welche Themen werden im „Ältesten Systemprogramm“ behandelt?
Das „Älteste Systemprogramm“ behandelt eine Metaphysik, die nach Kant in die Moral fällt und die Unvollständigkeit von Kants Trennung von theoretischer und praktischer Vernunft aufzeigt. Es umfasst Denkmotive aus der Zeit um 1796/97 und dokumentiert einen Übergang im Denken Hegels, der versucht, Kants Philosophie zu überwinden, indem er Welt und Ich als aus demselben Urgrund (dem Nichts) entspringend darstellt. Es beinhaltet auch ästhetische Überlegungen, die den Einfluss von Hölderlins Vereinigungsphilosophie zeigen.
Wer ist der Verfasser des „Ältesten Systemprogramms“?
Die Verfasserfrage wird in der Arbeit diskutiert. Die Analyse beleuchtet die verschiedenen Perspektiven und Überlegungen zur Autorschaft, ohne eine definitive Antwort zu geben. Die Arbeit geht der Frage nach, inwieweit Schelling, Hegel und Hölderlin an der Entstehung beteiligt waren.
Welche Rolle spielt Hölderlins Vereinigungsphilosophie?
Hölderlins Vereinigungsphilosophie, insbesondere die Konzepte von Liebe und Schönheit, spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit analysiert, wie Hegels Rezeption dieser Ideen im Mittelteil des „Systemprogramms“ zum Ausdruck kommt und wie sie Hegels Denken beeinflusst hat. Der Vergleich der philosophischen Positionen Hegels und Hölderlins zeigt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Entstehung des Gedichts "Eleusis" und den gedanklichen Austausch zwischen Hegel und Hölderlin in Frankfurt beleuchtet. Es folgen Kapitel zur Überlieferung, zum inhaltlichen Aufbau und zur Verfasserfrage des „Systemprogramms“, zur Analyse von Hölderlins Vereinigungsphilosophie und ihrer Rezeption bei Hegel, sowie ein Vergleich der philosophischen Positionen beider Denker. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hegel, Hölderlin, Ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus, Vereinigungsphilosophie, Kantianismus, Metaphysik, Ästhetik, Moral, Ideen, Absolutes, Philosophiegeschichte, Einfluss, Rezeption.
Welche Bedeutung hat das „Älteste Systemprogramm“ für Hegels Philosophie?
Das „Älteste Systemprogramm“ wird als zentraler Text für die Analyse der gegenseitigen Beeinflussung zwischen Hegel und Hölderlin dargestellt. Es zeigt einen wichtigen Übergang in Hegels Denken, die Überwindung seines Berner Kantianismus und den Einfluss von Hölderlins Ideen auf die Entwicklung seiner Philosophie.
- Quote paper
- Mareike Henrich (Author), 2002, Hegel, Hölderlin und das älteste Systemprogramm des Deutschen Idealismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/43770