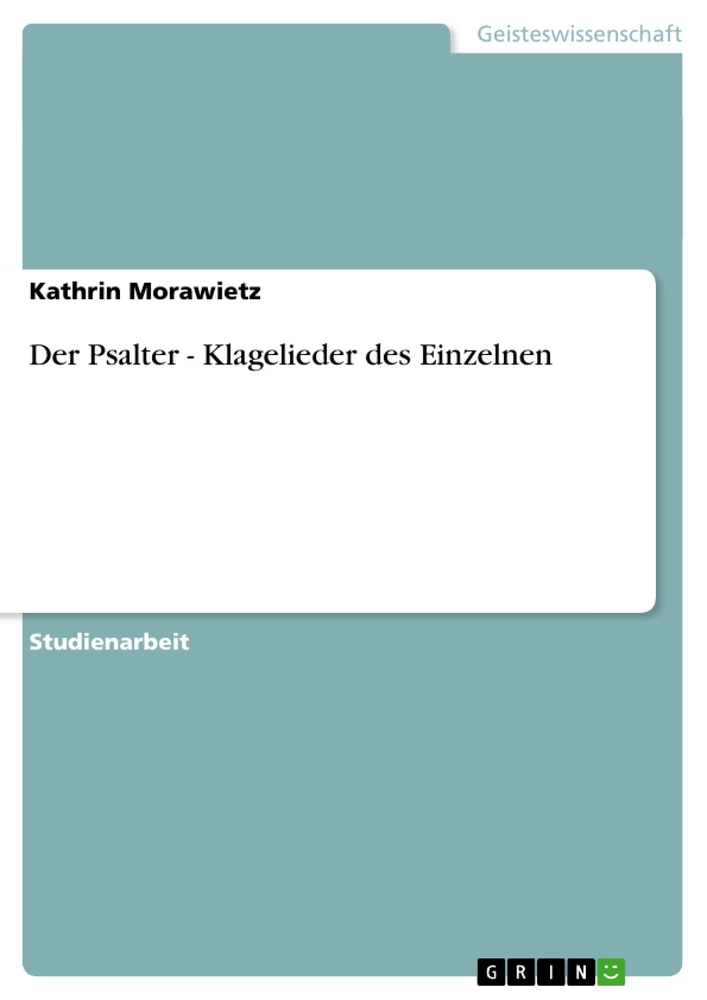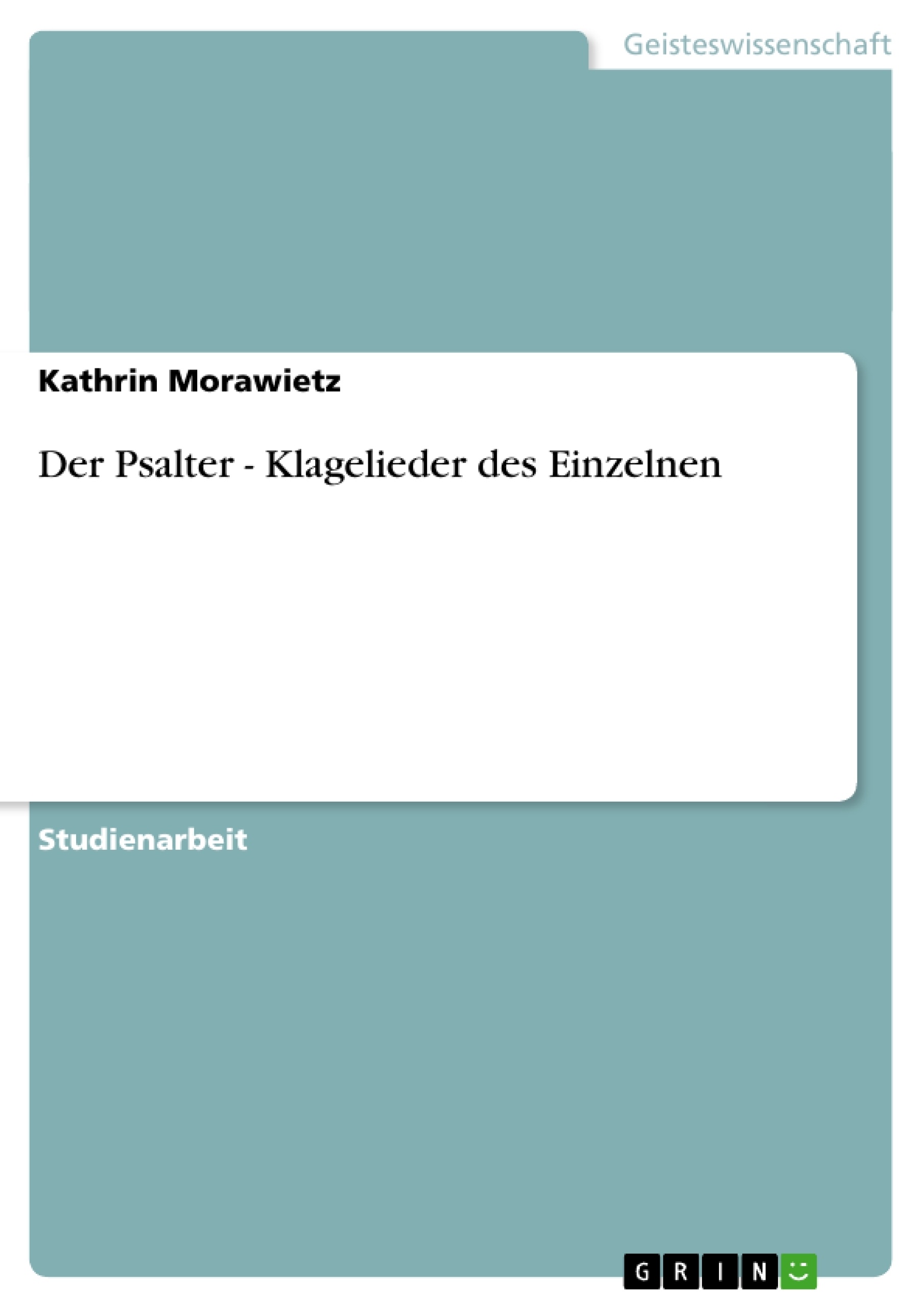Um die Situation der Psalmenbeter besser verstehen zu können, muss man sich zunächst mit dem historischen Kontext und dem alttestamentlichen Menschen- und Weltbild vertraut machen. Die biblischen Psalmen verdeutlichen Erfahrungen und Verhaltensweisen, die den Beter in Grenzsituation der menschlichen Existenz zeigen. Das Bild des Menschen unterliegt jedoch dem historischen Wandel und lässt sich nicht objektivieren. Dem Alten Testament liegt keine einheitliche Lehre vom Menschen zugrunde, das Fehlen eines einheitlichen Menschenbildes wird jedoch durch den Dialog des Menschen mit Gott und Gottes mit dem Menschen aufgewogen („Konfliktgespräche mit Gott“). Deshalb können die Psalmen auch als „Antwort Israels “ auf Jahwes Wirken in Israel verstanden werden. Der alttestamentliche Mensch ist angewiesen auf ein „unendliches, nicht endliches, jenseitiges Gegenüber“ und somit welt- und gottoffen.
Nach alttestamentlichem Verständ nis können Himmel, Ober- und Unterwelt nicht in strenger Abgrenzung zueinander gesehen werden, denn es liegt eine große Durchlässigkeit zwischen Ober- und Unterwelt vor (sieheAnlage).Das Fundament der Schöpfung besteht in der göttlichen Weisheit, die durch eine Torarolle mit zwei Armen dargestellt wird. Sie tragen die Säulen bzw. Grundfesten der Erde und sorgen somit für Weltstabilität. Der gehörnte Schlangen- bzw. Chaosdrache steht für das Unverfügbare in der Welt und kann Einfluss auf die Oberwelt nehmen. Er symbolisiert die ständige Bedrohung der Weltstabilität durch das Chaos, nach alttestamentlichem Verständnis durch die Urflut. Der Kerubenthron Jahwes mit den beiden geflügelten Seraphen stellt das Bollwerk gegen die Chaosfluten dar, während die Flügelsonne als Licht des Himmels die Herrlichkeit Gottes symbolisiert. Die alttestamentlichen Menschen mussten somit die Spannung zwischen Weltordnung und Unordnung bewältigen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung: Das alttestamentliche Menschen- und Weltbild
- Krankheit und Todesverständnis im alten Israel
- Woher kommt der Name Psalm?
- Entstehung und Funktion des Psalters
- Inhalt und Aufbau des Psalters
- Die „Davidisierung“ des Psalters
- Die Sprache der Psalmen - Stereometrie des Gedankenausdrucks
- Parallelismus membrorum
- Überlagerung der Bilder und Motive
- Metaphorisierung und Symbolisierung
- Die Vorteile der Psalmensprache
- Die Hauptgattungen des Psalters
- Die Klagelieder
- Die Klagelieder des Einzelnen
- Krankheits- und Unschuldspsalmen
- Aufbau der Klagelieder
- Beispielpsalm 13
- Der klagende Beter
- Bitte um Heilung
- Vertrauensbekenntnis und Lobgelübde
- Das Phänomen des „Stimmungsumschwungs“
- Fazit zu Psalm 13
- Beispielpsalm 88
- Form und Inhalt
- Die Figur des Beters in Psalm 88
- Die Wirkung des Mittelteils
- Fazit zu Psalm 88
- Beispielpsalm 130
- Form und Inhalt
- Fazit zu Psalm 130
- Beispielpsalm 140
- Form und Inhalt
- Fazit zu Psalm 140
- Beispielpsalm 6
- Form und Inhalt
- Fazit zu Psalm 6
- Beispielpsalm 22
- Form und Inhalt
- Erster Teil: Das Klagelied des Einzelnen
- Zweiter Teil: Das Danklied
- Fazit zu Psalm 22
- Form und Inhalt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Klagelieder des Einzelnen im Psalter. Das Ziel ist es, das Verständnis dieser Psalmen im Kontext des alttestamentlichen Menschen- und Weltbildes zu beleuchten und deren Entstehung, Funktion und sprachliche Besonderheiten zu analysieren. Ausgewählte Psalmen werden exemplarisch untersucht, um die typischen Merkmale und den Aufbau der Klagelieder zu verdeutlichen.
- Das alttestamentliche Menschen- und Weltbild
- Krankheit und Tod im alten Israel
- Die sprachlichen Besonderheiten der Psalmen
- Aufbau und Struktur der Klagelieder
- Exemplarische Analyse ausgewählter Klagepsalmen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik ein und beschreibt den Fokus auf die Klagelieder des Einzelnen im Psalter, die ein Leben voller Feindschaft, Krankheit und Gewalt beschreiben, in dem die Betenden Gott selbst als Feind anklagen. Die Arbeit wird den Psalter im Allgemeinen und die Klagelieder im Speziellen behandeln, anhand von Beispielpsalmen.
Einleitung: Das alttestamentliche Menschen- und Weltbild: Die Einleitung betont die Notwendigkeit, das alttestamentliche Menschen- und Weltbild zu verstehen, um die Situation der Psalmenbeter zu erfassen. Sie beschreibt die Erfahrungen und Verhaltensweisen der Betenden in Grenzsituationen und unterstreicht die fehlende einheitliche Lehre vom Menschen im Alten Testament. Der Dialog mit Gott und Gottes Wirken in Israel werden als zentrale Aspekte hervorgehoben. Es wird ein Bild eines weltoffenen Menschen präsentiert, der sich in einer Spannung zwischen Weltordnung und Chaos befindet, das durch eine bildliche Darstellung von Himmel, Ober- und Unterwelt verdeutlicht wird.
Krankheit und Todesverständnis im alten Israel: Dieses Kapitel beleuchtet das Verständnis von Krankheit und Tod im alten Israel. Krankheit wurde oft als göttliche Strafe für Sünden interpretiert, während der Tod eine Distanz zu Gott bedeutete. Die Durchlässigkeit zwischen Leben und Tod im Alten Orient wird hervorgehoben, wobei eine schwere Krankheit zu sozialer Ausgrenzung führen konnte.
Woher kommt der Name Psalm?: Dieses Kapitel klärt die Herkunft des Begriffs „Psalm“ und erläutert die hebräische Bezeichnung „sefer tehillim“. Obwohl der Psalter viele Klagelieder enthält, wird er als Lobpreis Gottes Israels verstanden, da auch die Klagepsalmen letztendlich einen Bezug zum Lob Gottes beinhalten.
Entstehung und Funktion des Psalters: (Hier würde eine Zusammenfassung über die Entstehung und Funktion des Psalters stehen. Da der Text diese Information nicht enthält, kann hier nur ein Platzhalter eingefügt werden.)
Inhalt und Aufbau des Psalters: (Hier würde eine Zusammenfassung über den Inhalt und Aufbau des Psalters stehen. Da der Text diese Information nicht enthält, kann hier nur ein Platzhalter eingefügt werden.)
Die „Davidisierung“ des Psalters: (Hier würde eine Zusammenfassung über die „Davidisierung“ des Psalters stehen. Da der Text diese Information nicht enthält, kann hier nur ein Platzhalter eingefügt werden.)
Die Sprache der Psalmen - Stereometrie des Gedankenausdrucks: Dieses Kapitel analysiert die sprachlichen Besonderheiten der Psalmen, insbesondere den Parallelismus membrorum, die Überlagerung von Bildern und Motiven, Metaphorisierung und Symbolisierung. Die Vorteile dieser sprachlichen Mittel für die Wirkung der Psalmen werden diskutiert.
Die Hauptgattungen des Psalters: (Hier würde eine Zusammenfassung über die Hauptgattungen des Psalters stehen. Da der Text diese Information nicht enthält, kann hier nur ein Platzhalter eingefügt werden.)
Die Klagelieder: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Klagelieder, mit besonderem Fokus auf die Klagelieder des Einzelnen, Krankheits- und Unschuldspsalmen sowie deren Aufbau.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Klagelieder im Psalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Klagelieder des Einzelnen im Psalter. Sie untersucht deren Verständnis im Kontext des alttestamentlichen Menschen- und Weltbildes und beleuchtet Entstehung, Funktion und sprachliche Besonderheiten dieser Psalmen. Ausgewählte Psalmen dienen als exemplarische Fallstudien zur Veranschaulichung typischer Merkmale und des Aufbaus der Klagelieder.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: das alttestamentliche Menschen- und Weltbild, Krankheit und Tod im alten Israel, die sprachlichen Besonderheiten der Psalmen (Parallelismus membrorum, Metaphorisierung etc.), Aufbau und Struktur der Klagelieder sowie exemplarische Analysen ausgewählter Klagepsalmen (z.B. Psalm 13, 88, 130, 140, 6, 22).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst ein Vorwort, eine Einleitung zum alttestamentlichen Menschen- und Weltbild, Kapitel zu Krankheit und Todesverständnis im alten Israel, zur Herkunft des Namens "Psalm", zur Entstehung und Funktion des Psalters, zum Inhalt und Aufbau des Psalters, zur "Davidisierung" des Psalters, zur Sprache der Psalmen, zu den Hauptgattungen des Psalters, und ausführliche Analysen zu ausgewählten Beispielpsalmen. Zusätzlich werden Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel präsentiert.
Welche Psalmen werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert exemplarisch die Psalmen 13, 88, 130, 140, 6 und 22. Die Analysen umfassen Form, Inhalt und die Interpretation der jeweiligen Klage. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Aufbau und den sprachlichen Besonderheiten dieser Psalmen.
Wie wird das alttestamentliche Weltbild in die Analyse einbezogen?
Das alttestamentliche Weltbild bildet den Kontext für das Verständnis der Klagelieder. Die Arbeit untersucht, wie die Erfahrungen und Verhaltensweisen der Betenden in Grenzsituationen (Krankheit, Leid, Gewalt) im Kontext des damaligen Verständnisses von Gott, Weltordnung und Chaos zu interpretieren sind. Die fehlende einheitliche Lehre vom Menschen im Alten Testament wird dabei berücksichtigt.
Welche Rolle spielt die Sprache der Psalmen in der Analyse?
Die Analyse der Sprache der Psalmen ist zentral. Es wird der Parallelismus membrorum, die Überlagerung von Bildern und Motiven, sowie die Metaphorisierung und Symbolisierung untersucht. Die Arbeit beleuchtet, wie diese sprachlichen Mittel die Wirkung der Klagelieder verstärken.
Was ist die Bedeutung der Klagelieder im Psalter?
Die Klagelieder im Psalter zeigen das Leben voller Feindschaft, Krankheit und Gewalt. Die Betenden beklagen sich bei Gott, sie klagen sogar Gott selbst an. Die Arbeit zeigt, wie diese Klage letztendlich doch einen Bezug zum Lob Gottes beinhaltet, denn der Psalter als Ganzes wird als Lobpreis Gottes Israels verstanden.
Welche Aspekte des Aufbaus der Klagelieder werden behandelt?
Die Analyse der Klagelieder umfasst Aspekte wie den Aufbau der einzelnen Klagepsalmen, die typischen Elemente der Klage (Anrufung Gottes, Beschreibung des Leids, Bitte um Hilfe, Vertrauensbekenntnis etc.), und den Vergleich verschiedener Psalmtypen.
- Quote paper
- Kathrin Morawietz (Author), 2003, Der Psalter - Klagelieder des Einzelnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/43554