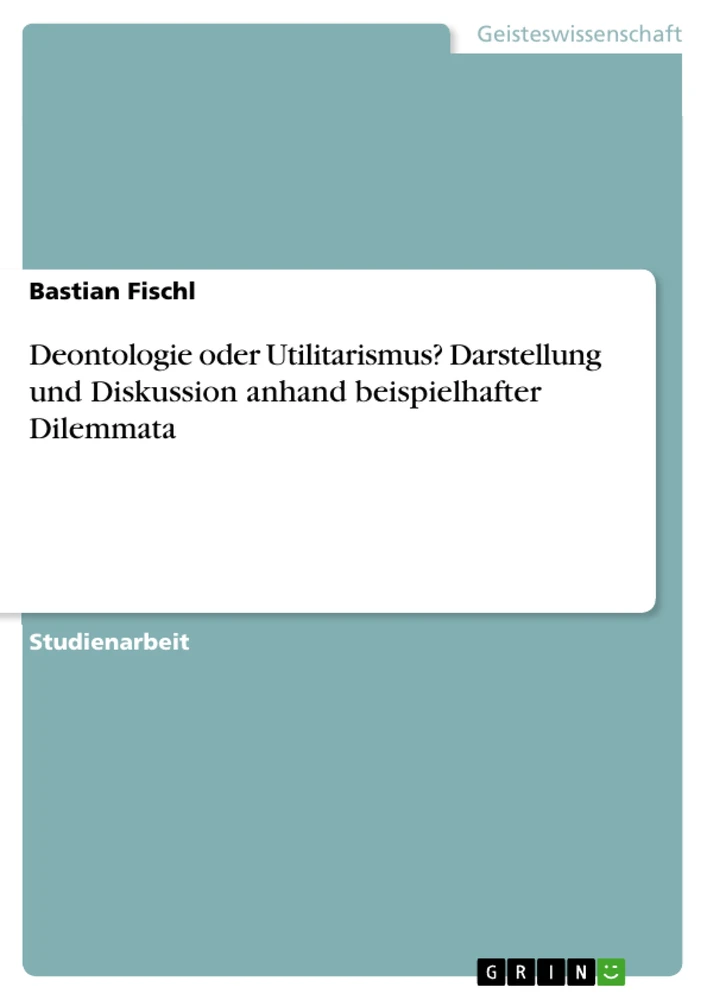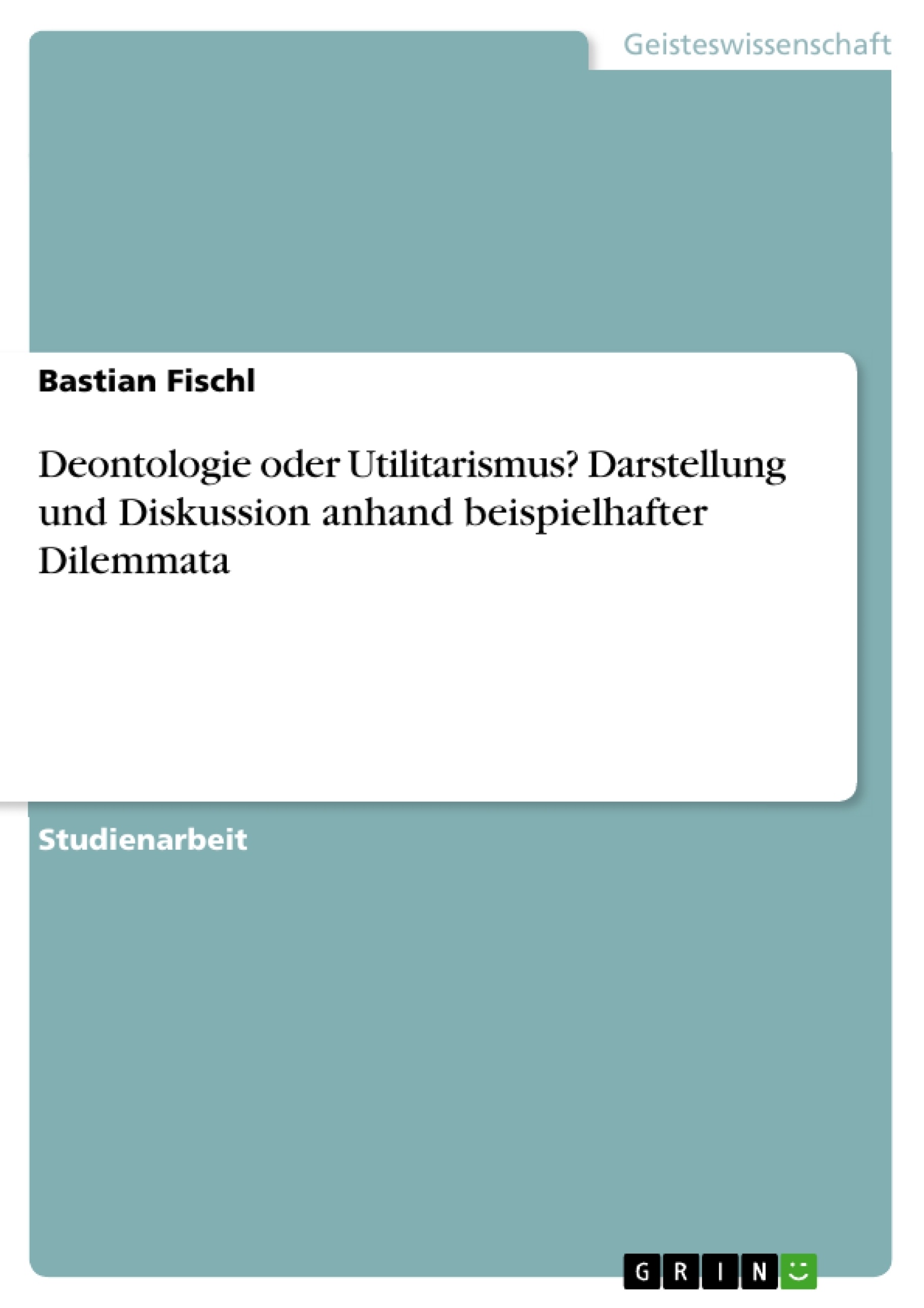Was ist Europa? Sicherlich gehört dazu eine gemeinsame europäische Geschichte. Darunter wichtige gesellschaftliche Entwicklungen, politische Ereignisse und kulturelle Leistungen. All jenes formte über die Zeit ein europäisches Bewusstsein, eine Identität ein diffuses jedoch für jeden spürbares Gefühl der Verbundenheit und Gebundenheit. Was viele jedoch zunächst vergessen sind Gedanken. Gedanken gedacht von wichtigen Denkern, die unser Verständnis von uns selbst und der Welt in der wir uns bewegen prägten und nach wie vor prägen.
Unter diesem Aspekt sind insonderheit die Werte nach denen wir uns als Europäer orientieren zentral für ein europäisches Bewusstsein. Was ist uns wichtig? Wie verhalten wir uns? Wie gehen wir mit uns und mit den anderen um? Was ist der Mensch? Es stellt sich also ganz konkret die Frage nach den grundsätzlichen ethischen Paradigmen, die einem gemeinsamen Europa zugrundeliegend können.
In der folgenden Arbeit sollen daher zwei einflussreiche und miteinander in vielerlei Hinsicht konkurrierende ethische Theorien untersucht werden – die Deontologie nach Kant und der klassische Utilitarismus nach Bentham und Mill. Im Anschluss erfolgt der Versuch einer beispielhaften Anwendung auf ethische Dilemmata aus Politik und Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deontologie
- Deontologie nach Kant
- Der gute Wille
- Kategorischer Imperativ
- Kategorischer Imperativ im Detail - die Pflicht
- Kategorischer Imperativ im Detail - Allgemeingültigkeit und Folgen
- Utilitarismus
- Nützlichkeit und Glück
- Gemeinwohl, Bilanz und Tendenz
- Die gute Handlung und die Folgen
- Ethische Dilemmata
- Schluss und persönliches Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit zwei einflussreichen ethischen Theorien: der Deontologie nach Kant und dem klassischen Utilitarismus nach Bentham und Mill. Ziel ist es, die wesentlichen Aspekte beider Ansätze darzustellen und diese anhand von beispielhaften Dilemmata unserer Zeit zu diskutieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Grundlagen beider Theorien, ihrer Unterschiede sowie ihrer Auswirkungen auf unser Verständnis von Menschenwürde. Des Weiteren wird untersucht, wie die Theorien in der Praxis angewandt werden können, um sensible gesellschaftliche und politische Probleme zu beleuchten.
- Grundlagen der Deontologie und des Utilitarismus
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Ansätze
- Anwendung der Theorien auf ethische Dilemmata
- Auswirkungen der Theorien auf das Verständnis von Menschenwürde
- Praktische Relevanz der Theorien für gesellschaftliche und politische Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der ethischen Paradigmen im Kontext eines gemeinsamen Europas ein. Dabei werden zentrale Fragen nach den Werten, die für Europäer relevant sind, und nach den grundlegenden ethischen Prinzipien aufgeworfen, die einem gemeinsamen Europa zugrunde liegen können. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Vernunft und dem freien Willen in Bezug auf die ethische Entscheidungsfindung.
Das Kapitel über die Deontologie konzentriert sich auf die Philosophie Immanuel Kants. Es werden die zentralen Aspekte der kantschen Ethik erläutert, insbesondere die Rolle der Vernunft, des guten Willens und des kategorischen Imperativs. Die Bedeutung der Pflichterfüllung und der Allgemeingültigkeit von moralischen Prinzipien wird hervorgehoben.
Im Kapitel zum Utilitarismus werden die grundlegenden Konzepte der Nützlichkeit und des Glücks erläutert. Es wird dargestellt, wie sich die Folgen von Handlungen auf das Gemeinwohl auswirken und wie die Bilanz von Glück und Leid als Grundlage für ethische Entscheidungen dienen kann.
Schlüsselwörter
Deontologie, Utilitarismus, Kant, Bentham, Mill, Vernunft, freier Wille, kategorischer Imperativ, Nützlichkeit, Glück, Gemeinwohl, Menschenwürde, ethische Dilemmata, Europa, Gesellschaft, Politik.
- Arbeit zitieren
- Bastian Fischl (Autor:in), 2018, Deontologie oder Utilitarismus? Darstellung und Diskussion anhand beispielhafter Dilemmata, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/434439