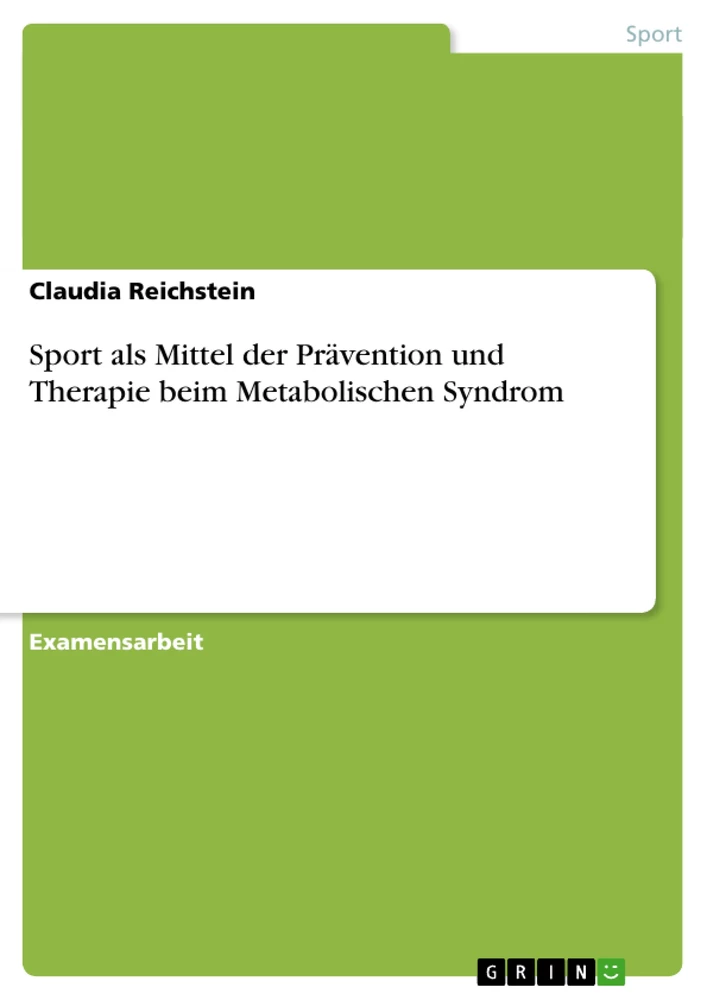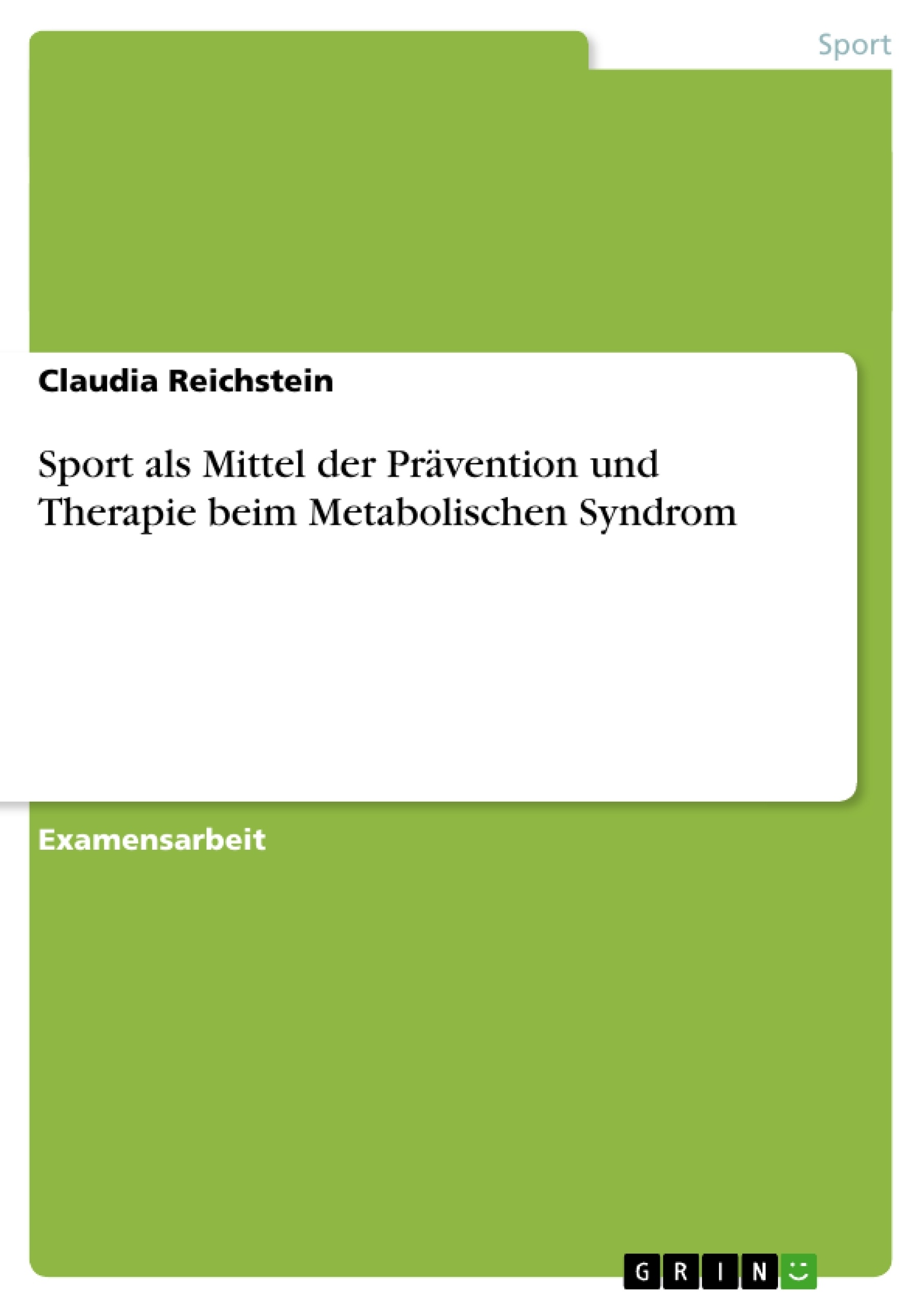Eine dramatische Zunahme von kardiovaskulären Risikofaktoren ist seit dem Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen (vgl. Wirth 2004b, A1745). Eine Erklärung können weder genetische Einflüsse noch Umweltfaktoren bieten. Sie ist primär auf den veränderten Lebensstil der Bevölkerung und sekundär auf die gestiegene Lebenserwartung zurückzuführen (vgl. Wirth 2004b, A1747). Rauchen, fett- und zuckerreiche Ernährung, Alkohol, Bewegungsmangel und Stress sind charakteristisch für unsere
Wohlstandsgesellschaft. In jüngster Zeit wurde ein kardiovaskuläres Risiko-Cluster identifiziert: das Metabolische Syndrom. Dieses Wohlstandssyndrom wird auch als ´the Deadly Quartet` bezeichnet (vgl. Hanefeld 1996, 15). Der beängstigende Name birgt bereits die mögliche Folge in sich. Das Cluster ist aufgrund seiner atherosklerotischen Komplikationen mit einer hohen Mortalität verknüpft (vgl. Wirth 2003, 24). Der Prävention und Therapie dieses Störungskomplexes kommt aus diesem Grund eine besonders herausragende Bedeutung zu. Die Ursachen des Syndroms sind in den riskanten Lebensweisen unserer Überflussgesellschaft, aber auch in mangelnden gesundheitsförderlichen Ressourcen zu suchen.
Präventive und therapeutische Interventionen richten sich mitunter auf den Abbau des Bewegungsmangels wie auch auf die Stärkung von Ressourcen beim Sport treiben. Dass Bewegung irgendwie gesund hält, scheint jedem ganz natürlich. Umfragen zu den mit Sport verbundenen Zielen und Wünschen, ergaben auch zahlreiche Nennungen für den Bereich -Die Gesundheit stärken- (vgl. Pudel & Westenhöfer 1998, 198; Lange 1994, 283). Währenddessen zeigt sich in der sportwissenschaftlichen Diskussion deutliche Kritik. Aussprüche, wie „Der oft synonyme Gebrauch von Sport und Gesundheit ist rational nicht begründet. [...] Wer sind die ‛Priester’, die diesen Glauben verbreiten?“ (Ulmer 1991, 86) oder „Sofern sich damit der Glaube verbindet, Sport sei eo ipso gesund, [...] liegt dem eine recht naive Vorstellung zugrunde.“ (Balz 1992, 258) sind nicht die Ausnahme. Ob Sport tatsächlich das ‘Non-Plus-Ultra’ der Prävention und Therapie dieses Syndroms darstellt, soll in dieser Arbeit herausgefunden werden. Neben den physischen Beeinflussungen werden auch psychosoziale Wirkungen des Sports untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Prävention
- 2.1 Das Risiko-Faktoren-Modell
- 2.2 Gesundheitsförderung
- 2.3 Salutogenese
- 3 Das Metabolische Syndrom
- 3.1 Präventionskonzepte
- 3.1.1 Die mit dem Metabolischen Syndrom assoziierten Störungen
- 3.1.2 Gestörter Kohlenhydratstoffwechsel als Aspekt des Metabolischen Syndroms
- 3.1.3 Dyslipoproteinämie als Aspekt des Metabolischen Syndroms
- 3.1.4 Hypertonie als Aspekt des Metabolischen Syndroms
- 3.2 Das Metabolische Syndrom aus psychologisch-neuroendokrinologischer Perspektive
- 3.3 Folgen des Metabolischen Syndroms
- 3.4 Zwischenbilanz zur Ätiopathogenese und Epidemiologie
- 3.5 Therapie und Prävention des Metabolischen Syndroms
- 4 Sport in der Prävention und Therapie des Metabolischen Syndroms
- 4.1 Sport in der Therapie des Metabolischen Syndroms
- 4.2 Sport in der Prävention des Metabolischen Syndroms
- 4.3 Psychosoziale Auswirkungen körperlicher Aktivität in der Prävention
- 4.4 Anforderungen an den Gesundheitssport
- 4.5 Gesundheit für alle?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Sport als Mittel der Prävention und Therapie beim Metabolischen Syndrom. Ziel ist es, den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema darzustellen und die Wirksamkeit von Sportmaßnahmen im Kontext des Metabolischen Syndroms zu beleuchten. Dabei werden sowohl therapeutische als auch präventive Aspekte berücksichtigt.
- Das Metabolische Syndrom: Definition, assoziierte Störungen und Risikofaktoren
- Präventionskonzepte für das Metabolische Syndrom
- Die Rolle von Sport in der Therapie des Metabolischen Syndroms
- Der Einsatz von Sport in der Prävention des Metabolischen Syndroms
- Psychosoziale Auswirkungen körperlicher Aktivität im Zusammenhang mit dem Metabolischen Syndrom
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel des Lebensstils in westlichen Industrienationen hin zu mehr Sesshaftigkeit und ungesunder Ernährung, was zu einer Zunahme kardiovaskulärer Erkrankungen, insbesondere des Metabolischen Syndroms, geführt hat. Es wird die Bedeutung von Prävention und Therapie dieses Syndroms hervorgehoben und die kritische Auseinandersetzung mit der Rolle des Sports in diesem Kontext angekündigt. Die medizinische Weiterentwicklung und die Grenzen der rein medizinischen Behandlung werden diskutiert, und das Konzept der selbstbestimmten Gesundheitsvorsorge wird eingeführt. Die scheinbar einfache Verbindung von Sport und Gesundheit wird kritisch hinterfragt, wobei die Notwendigkeit einer fundierten wissenschaftlichen Untersuchung betont wird.
2 Prävention: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Prävention, indem es das Risiko-Faktoren-Modell, die Gesundheitsförderung und den salutogenetischen Ansatz vorstellt. Es werden die individuellen und gesellschaftlichen Faktoren beleuchtet, die das Entstehen des Metabolischen Syndroms beeinflussen und Maßnahmen zur Prävention dieses Syndroms skizziert. Hier werden vermutlich verschiedene Modelle zur Gesundheitsförderung und deren Eignung vorgestellt und diskutiert. Die Kapitel erläutert also die theoretischen Grundlagen der Prävention.
3 Das Metabolische Syndrom: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung des Metabolischen Syndroms. Es beschreibt die assoziierten Störungen wie Adipositas, gestörter Kohlenhydratstoffwechsel, Dyslipoproteinämie und Hypertonie. Für jede dieser Störungen werden Ätiopathogenese und Epidemiologie detailliert erläutert. Zusätzlich wird das Metabolische Syndrom aus psychologisch-neuroendokrinologischer Perspektive betrachtet, wobei psychosoziale Faktoren und deren Einfluss auf die Krankheitsentstehung diskutiert werden. Schließlich werden die Folgen des Metabolischen Syndroms, einschließlich Komplikationen, psychosozialer Auswirkungen und Kosten, behandelt.
4 Sport in der Prävention und Therapie des Metabolischen Syndroms: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es untersucht die Rolle von Sport sowohl in der Therapie als auch in der Prävention des Metabolischen Syndroms. Es wird detailliert auf den Einfluss von Sport auf Übergewicht, den gestörten Kohlenhydratstoffwechsel, Dyslipoproteinämie und Hypertonie eingegangen. Trainingsempfehlungen bezüglich Form, Intensität, Dauer und Frequenz werden gegeben, sowie geeignete Sportarten vorgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den psychosozialen Auswirkungen körperlicher Aktivität. Hier werden die Zusammenhänge zwischen sportlicher Aktivität, Stress, Wohlbefinden, Selbstkonzept und Kompetenzerwartung erläutert. Schließlich werden Anforderungen an den Gesundheitssport und die Bedeutung von Sinnzuschreibung, Konsequenz- und Kompetenzerwartungen sowie die Rolle des Übungsleiters diskutiert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Hausarbeit über Sport in der Prävention und Therapie des Metabolischen Syndroms
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Rolle von Sport in der Prävention und Therapie des Metabolischen Syndroms. Sie beleuchtet den aktuellen Forschungsstand und die Wirksamkeit von Sportmaßnahmen in diesem Kontext, sowohl therapeutisch als auch präventiv.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das Metabolische Syndrom (Definition, assoziierte Störungen, Risikofaktoren), Präventionskonzepte, die Rolle von Sport in Therapie und Prävention, und die psychosozialen Auswirkungen körperlicher Aktivität im Zusammenhang mit dem Metabolischen Syndrom. Es werden verschiedene Modelle der Gesundheitsförderung und deren Eignung diskutiert, sowie Ätiopathogenese und Epidemiologie der assoziierten Störungen detailliert erläutert.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus vier Kapiteln: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Prävention (inkl. Risiko-Faktoren-Modell, Gesundheitsförderung und Salutogenese), ein Kapitel zum Metabolischen Syndrom (inkl. assoziierter Störungen, psychologisch-neuroendokrinologischer Perspektive und Folgen), und ein Kapitel zu Sport in Prävention und Therapie des Metabolischen Syndroms (inkl. Trainingsempfehlungen und psychosozialer Auswirkungen).
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beschreibt den Wandel des Lebensstils in westlichen Industrienationen, die Zunahme des Metabolischen Syndroms, die Bedeutung von Prävention und Therapie, und die kritische Auseinandersetzung mit der Rolle des Sports. Die medizinische Weiterentwicklung, Grenzen der rein medizinischen Behandlung und das Konzept der selbstbestimmten Gesundheitsvorsorge werden ebenfalls diskutiert.
Was sind die zentralen Aspekte des Kapitels "Prävention"?
Das Kapitel "Prävention" präsentiert das Risiko-Faktoren-Modell, Gesundheitsförderung und den salutogenetischen Ansatz. Es beleuchtet individuelle und gesellschaftliche Faktoren, die das Metabolische Syndrom beeinflussen, und skizziert Maßnahmen zur Prävention. Verschiedene Modelle zur Gesundheitsförderung werden vorgestellt und diskutiert.
Was wird im Kapitel "Das Metabolische Syndrom" erläutert?
Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung des Metabolischen Syndroms, beschreibt assoziierte Störungen (Adipositas, gestörter Kohlenhydratstoffwechsel, Dyslipoproteinämie, Hypertonie), deren Ätiopathogenese und Epidemiologie. Es betrachtet das Syndrom aus psychologisch-neuroendokrinologischer Perspektive und behandelt die Folgen des Metabolischen Syndroms.
Was ist der Kern der Hausarbeit (Kapitel 4)?
Kapitel 4 untersucht die Rolle von Sport in der Therapie und Prävention des Metabolischen Syndroms. Es detailliert den Einfluss von Sport auf Übergewicht und die assoziierten Störungen, gibt Trainingsempfehlungen und beleuchtet die psychosozialen Auswirkungen körperlicher Aktivität. Anforderungen an Gesundheitssport, Sinnzuschreibung, Konsequenz- und Kompetenzerwartungen sowie die Rolle des Übungsleiters werden diskutiert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, den aktuellen Forschungsstand zum Thema Sport in der Prävention und Therapie des Metabolischen Syndroms darzustellen und die Wirksamkeit von Sportmaßnahmen zu beleuchten. Sowohl therapeutische als auch präventive Aspekte werden berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter könnten sein: Metabolische Syndrom, Prävention, Therapie, Sport, körperliche Aktivität, Gesundheitsförderung, Salutogenese, Risikofaktoren, Adipositas, gestörter Kohlenhydratstoffwechsel, Dyslipoproteinämie, Hypertonie, psychosoziale Faktoren.
- Arbeit zitieren
- Claudia Reichstein (Autor:in), 2004, Sport als Mittel der Prävention und Therapie beim Metabolischen Syndrom, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/43440