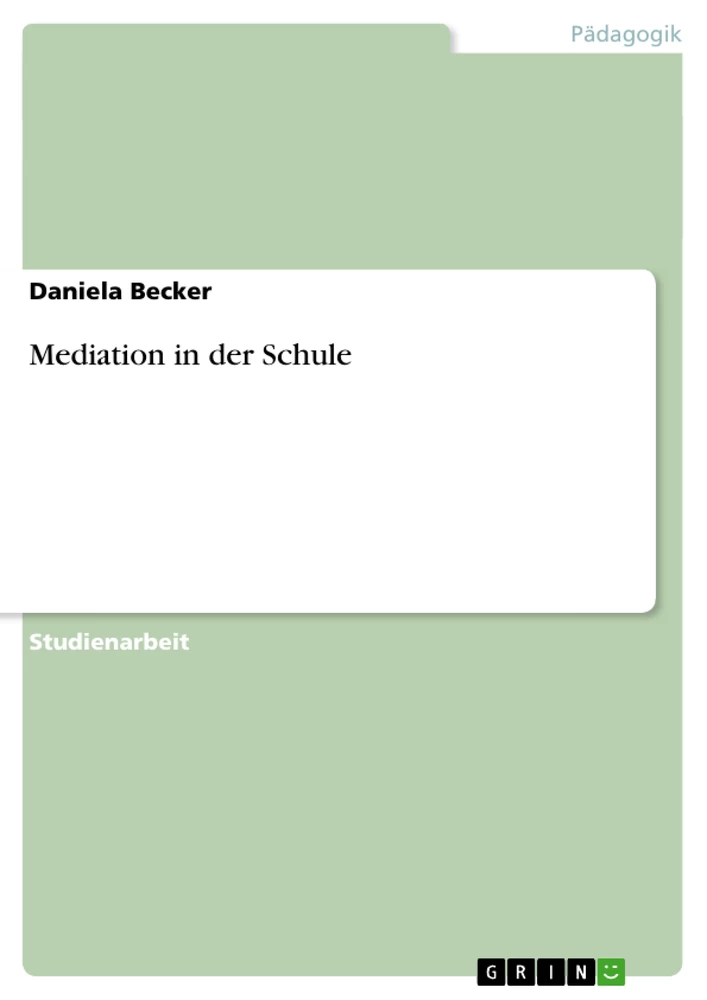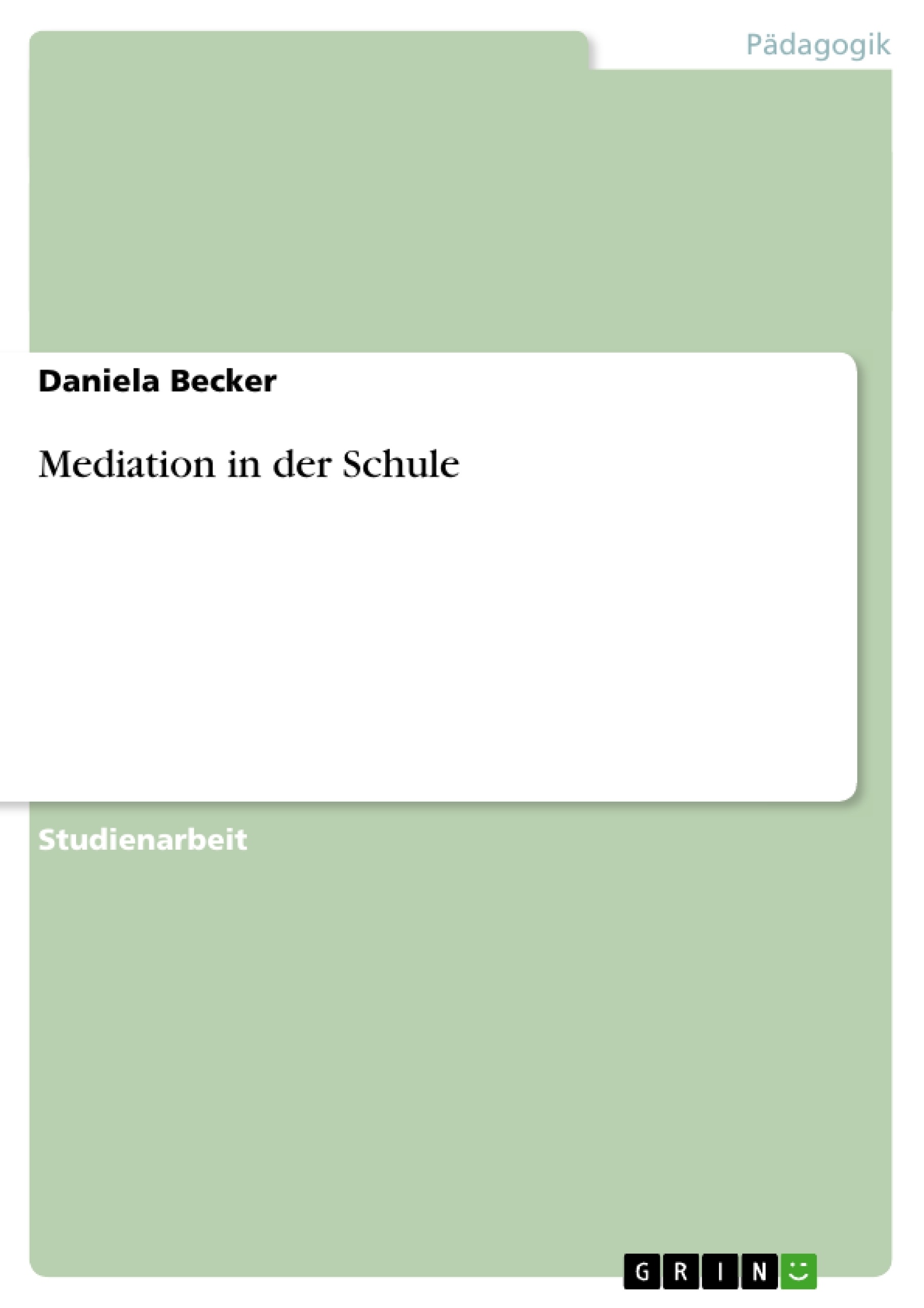Während meiner eigenen praktischen Tätigkeiten in der Schule erfuhr ich, dass Lehrkräfte Konflikte im Schulalltag als sehr anstrengend, belastend und beängstigend erleben.
Allerdings beinhalten Konflikte in der Schule oft auch spannende Momente. Man erfährt Neues über sich selbst, lernt eigene Grenzen kennen und kann verschiedene Methoden ausprobieren. Interessant sind die Reaktionen der beteiligten Schüler, Lehrer und Eltern am Konflikt. Es ist faszinierend zu sehen, wie Kinder eigenständig kreative Lösungen entwickeln – manchmal schneller und einfacher als Erwachsene.
Eine Möglichkeit, Konflikte in der Schule zu bewältigen, bietet die Mediation als ein spezielles Konfliktlösungsverfahren mithilfe unparteiischer Dritter.
Nach einer Betrachtung der seelischen Faktoren in sozialen Konflikten sowie gewaltfördernder Faktoren in der Schule zu Beginn der vorliegenden Arbeit sollen Hinweise zur praktischen Durchführung von Konfliktarbeit in der Schule dargestellt werden. In einem weiteren Teil der Arbeit werden Aspekte, welche eine Mediation im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Schaffung einer konstruktiven Konfliktkultur in der Schule ergänzen, skizziert. Schließlich sollen die verschiedenen Formen der Mediation in der Schule – Kinder und Jugendliche, Lehrer sowie Außenstehende als Mediatoren – betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Konflikte im Klassenzimmer
1.1. Seelische Faktoren in sozialen Konflikten
1.2. Gewaltfördernde Faktoren in der Schule
2. Mediation in der Schule
2.1 Soziale Prozesse in der Schule
2.2. Hinweise zur praktischen Durchführung von Konfliktarbeit
2.3. Mediation als Teil einer Gesamtstrategie zur Schaffung einer konstruktiven Konfliktkultur in der Schule
2.4. Formen der Mediation in der Schule
2.4.1. Kinder und Jugendliche als Mediatoren: Peer-mediators, Konfliktlotsen und Streitschlichter
2.4.2. Lehrer als Mediatoren
2.4.3. Mediation durch Außenstehende
3. Schlussbemerkung
4. Literatur
0. Einleitung
Während meiner eigenen praktischen Tätigkeiten in der Schule erfuhr ich, dass Lehrkräfte Konflikte im Schulalltag als sehr anstrengend, belastend und beängstigend erleben.
Allerdings beinhalten Konflikte in der Schule oft auch spannende Momente. Man erfährt Neues über sich selbst, lernt eigene Grenzen kennen und kann verschiedene Methoden ausprobieren. Interessant sind die Reaktionen der beteiligten Schüler, Lehrer und Eltern am Konflikt. Es ist faszinierend zu sehen, wie Kinder eigenständig kreative Lösungen entwickeln – manchmal schneller und einfacher als Erwachsene.
Eine Möglichkeit, Konflikte in der Schule zu bewältigen, bietet die Mediation als ein spezielles Konfliktlösungsverfahren mithilfe unparteiischer Dritter.[1]
Nach einer Betrachtung der seelischen Faktoren in sozialen Konflikten sowie gewaltfördernder Faktoren in der Schule zu Beginn der vorliegenden Arbeit sollen Hinweise zur praktischen Durchführung von Konfliktarbeit in der Schule dargestellt werden. In einem weiteren Teil der Arbeit werden Aspekte, welche eine Mediation im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Schaffung einer konstruktiven Konfliktkultur in der Schule ergänzen, skizziert. Schließlich sollen die verschiedenen Formen der Mediation in der Schule – Kinder und Jugendliche, Lehrer sowie Außenstehende als Mediatoren – betrachtet werden.
1. Konflikte im Klassenzimmer
Strukturbedingte Konflikte in der Schule entstehen Hagedorn zufolge durch die personale Größe, die bauliche Dimension sowie die Enge in der Schule. Dies führe zu mangelnden personellen Beziehungen, Unübersichtlichkeiten und scheinbarer Knappheit der Ressourcen. Darüberhinaus fördere der Druck, Schwächere auszusortieren, die Desintegration.[2]
Hurrelmann hat folgende Definition von Gewalt in der Schule entwickelt:
Das gesamte Spektrum von Tätigkeiten und Handlungen, die physische und psychische Schmerzen oder Verletzungen bei den im Bereich der Schule handelnden Personen zur Folge haben oder die auf die Beschädigung von Gegenständen im schulischen Raum gerichtet sind.[3]
Ein Konflikt kann, muss allerdings nicht mit Gewalt ausgetragen werden. Konflikte sollen nicht vermieden, sondern bewusst und konstruktiv geregelt werden.
Das Ziel der gewaltfreien Konfliktaustragung besteht darin, eine Lösung zu finden, bei der beide Parteien „gewinnen“: Statt gegeneinander zu kämpfen, gehen die Beteiligten gemeinsam gegen das Problem an und versuchen, sich zu einigen. Gewaltfreie Parteien suchen nach Lösungen, die es beiden Seiten ermöglichen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen.
Besonders wenn die Macht innerhalb der Beziehung ungerecht verteilt ist oder wenn eine Seite sich weigert, das Problem beziehungsweise ihren Anteil daran anzuerkennen, wird es aber nicht immer möglich sein, Lösungen zu finden, von denen beide Parteien profitieren.
Besonders konfliktär kann die Klassensituation sein, da es sich um eine unfreiwillige Gemeinschaft handelt: Im Gegensatz zu beispielsweise Freundschaftsbeziehungen suchen sich Schüler weder ihre Klassenkameraden noch ihre Lehrer aus, und auch der Lehrer hat sich häufig nicht gerade diese Klasse gewünscht. Trotzdem müssen alle über einen längeren Zeitraum hinweg miteinander auskommen. Konflikte ergeben sich daraus beinahe zwangsläufig.
1.1 Seelische Faktoren in sozialen Konflikten
Konflikte üben auf die meisten Menschen einen emotionalen Sog aus: Sie beeinträchtigen unsere kognitiven und emotionalen Fähigkeiten.
Die Beeinträchtigung von Willen, Empfindungen und Denken, deren wechselseitige Verstärkung und die Verstärkung in der Interaktion mit dem Konfliktgegner kann zur Eskalation führen.
Aus diesen Besonderheiten sozialer Konflikte folgt, daß ein neutraler Mediator für die Konfliktlösung besonders wichtig ist.[4]
1.2 Gewaltfördernde Faktoren in der Schule
Die unabhängige Regierungskommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt benennt folgende gewaltfördernde Faktoren an der Schule: ein gleichgültiges Verhältnis von Schülern und Lehrern, die Abschottung der Schule vom gesellschaftlichen Umfeld, die Frustration schulmüder und leistungsschwacher Schüler sowie der Vorrang von Wissensvermittlung gegenüber dem Erziehungsaspekt und der Vermittlung gesellschaftlicher Normen.[5]
[...]
[1] Zu den Charakteristika sowie den Wurzeln der Mediation vgl. Gebhardt (2000, 3-5), Dulabaum (1998), Walker (2001, 14-19), Besemer (1996, 14-24, 46-54).
[2] Hagedorn (1996, 6).
[3] Hurrelmann (1990, 365). Vgl. die Definition des sozialen Konflikts durch Friedrich Glasl in Glasl (1994, 14):
„Sozialer Konflikt ist eine Interaktion
- zwischen Aktoren (Individuen, Organisationen, Gruppen usw.)
- wobei wenigstens ein Aktor
- Unvereinbarkeiten
- im Denken/Vorstellen/Wahrnehmen
- und/oder Fühlen
- und/oder Wollen
- mit dem anderen Aktor (anderen Aktoren) in der Art erlebt
- daß im Realisieren eine Beeinträchtigung
durch einen anderen Aktor erfolgt.“
[4] Faller (1998, 13/14). Glasl (1994, 34f.)
[5] Faller (1998, 15f).
- Quote paper
- Daniela Becker (Author), 2004, Mediation in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/43079