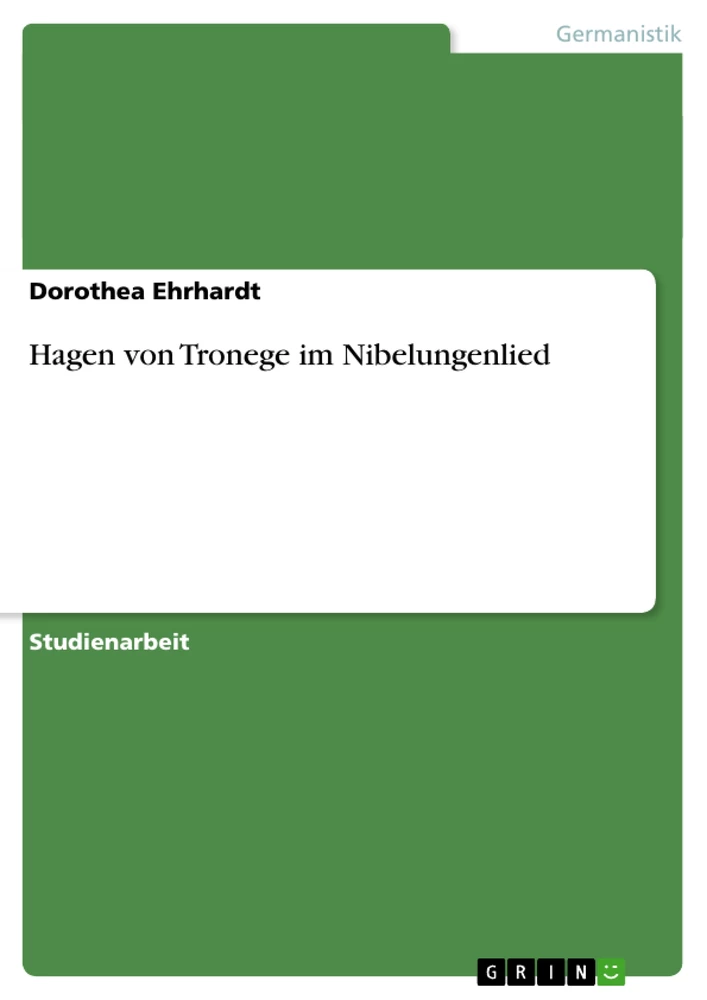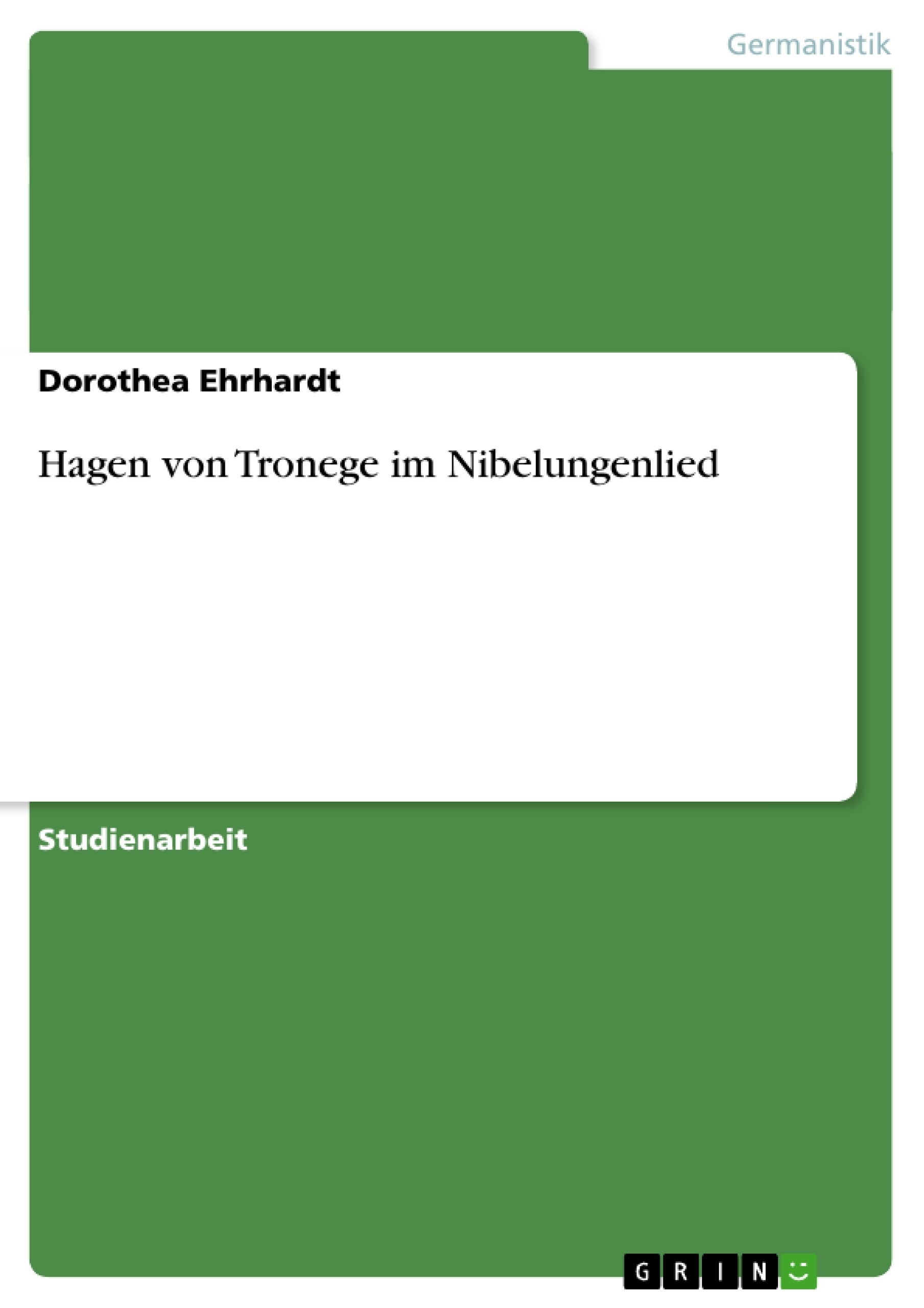„Gerade Hagen ist im Nibelungenlied eine Figur, welcher die Deutschen in der Rezeption sehr wechselhaft gegenüberstehen, denn der Nibelungenheld ist schon im Urtext selbst sehr widersprüchlich dargestellt.“ fasst Susanne Frembs die Problematik der Gestalt des Hagen von Tronege im Nibelungenlied sehr treffend zusammen.
Im Laufe der Rezeption und Analyse hat die Gestalt Hagens eine Vielzahl von Interpretationen und Bezeichnungen erfahren. Von der „Inkorporation des Nibelungenschicksals“, der „Getreue und Ungetreue zugleich“, „Verkörperung heroischen Handelns“ bis zu dem Helden „der trotz Warnungen wissend ins Verderben zieht, sein Schicksal selbst vorantreibt und nach tapferer Gegenwehr lachend einen grausamen Tod erträgt.“ reichen die Umschreibungen, die durchaus etwas von der Mischung aus Bewunderung und Schrecken, welche die Gestalt Hagens umgibt, anklingen lassen.
Vielgestaltig sind auch die Darstellungen die diese Gestalt im Laufe ihrer Geschichte erfahren hat. Vom verdammungswürdigen Schurken über den Antihelden bis hin zur zweiten positiven Hauptgestalt reicht dabei die Bandbreite. Ein großer Teil der Theorien und Analysen im Bezug auf die Figur Hagens stammen aus dem zwanzigsten Jahrhundert, was einige Autoren eine „Bedeutungsverschiebung von Siegfried zu Hagen“ nahe legen lässt.
All dies macht deutlich wie schwierig sich diese Figur des Nibelungenliedes für die Rezipienten deuten lies. Dies begründet sich insbesondere in der Widersprüchlichkeit der Darstellung die bereits den Basistext, das mittelhochdeutsche Nibelungenlied, durchzieht. Diese Ambivalenz ist so groß und auffallend, das einige Autoren, eine Doppelung der Hagengestalt sehen, die sich aus der Erzählstruktur des Textes erklären lässt.
Eine äußerst schwierig zu erklärende Gestalt also, deren gesamte Darstellung sich also nur sehr schwer analysieren lässt. Und gleichzeitig eine der reizvollsten Gestalten des Nibelungenliedes für eine Analyse, Verbergen doch gerade die Widersprüche und Lücken in der Darstellung viele interessante Interpretationsansätze.
Inhaltsverzeichnis
- Die Probleme der Hagendarstellung und Rezeption
- Der Name und seine möglichen Bedeutungen
- Der reale Hagen – der Versuch eines Wirklichkeitsbezugs
- Geographische Analyse
- Etymologische Analyse des Namens
- Der mythologische Hagen - Bezüge zu den Darstellungen in Sage und Legende
- Intertextuelle Bezüge zur Gestalt Hagen von Tronege
- Mythische Wurzeln der Gestalt Hagen von Tronege
- Das fehlende Zeitgefüge
- Die Darstellung Hagens im Text des Nibelungenlieds
- Auf ihn verwendete Begriffe und Umschreibungen
- Die Einführung der Hagengestalt in die Handlung
- Das Verhältnis von Sigfrid und Hagen
- Der Sigfridmord – mögliche Motive
- Die Gegner Hagen – Kriemhild
- Darstellung Hagens in der Nibelunge Nôt
- Schlussfolgerungen zur Gestalt Hagen von Tronege
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die komplexe Figur des Hagen von Tronege im Nibelungenlied. Ziel ist es, die widersprüchliche Darstellung Hagens zu analysieren und verschiedene Interpretationsansätze zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet historische, mythologische und intertextuelle Bezüge, um ein umfassenderes Verständnis der Figur zu erlangen.
- Die widersprüchliche Darstellung Hagens im Nibelungenlied und deren Rezeption
- Die etymologische und geographische Analyse des Namens "Hagen von Tronege"
- Intertextuelle Bezüge zu anderen Werken, insbesondere zum "Waltharius"
- Die Rolle Hagens im Handlungsverlauf des Nibelungenlieds und seine Beziehungen zu anderen Figuren
- Mögliche Motive für den Sigfridmord
Zusammenfassung der Kapitel
Die Probleme der Hagendarstellung und Rezeption: Das Kapitel beleuchtet die vielschichtigen und oft widersprüchlichen Interpretationen der Figur Hagen von Tronege im Laufe der Rezeptionsgeschichte. Es zeigt auf, wie die Darstellung Hagens im Nibelungenlied selbst bereits Ambivalenzen aufweist, die zu unterschiedlichen Lesarten geführt haben – von verdammungswürdigem Schurken bis hin zu einer positiv konnotierten Gestalt. Die große Bandbreite an Interpretationen wird auf die Widersprüchlichkeit der Darstellung im Urtext zurückgeführt und der Einfluss des 20. Jahrhunderts auf die Rezeption wird thematisiert.
Der Name und seine möglichen Bedeutungen: Dieses Kapitel untersucht den Namen "Hagen von Tronege" und dessen mögliche Bezüge zur Realität. Es werden verschiedene Ansätze zur Namensdeutung vorgestellt: die Suche nach historischen Vorbildern und die etymologische Analyse des Namens "Hagen". Die geographische Analyse des Namensbestandteils "Tronege" führt zu verschiedenen möglichen Orten, ohne jedoch eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. Die Unsicherheit lässt Raum für Interpretation und Spekulation.
Der reale Hagen – der Versuch eines Wirklichkeitsbezugs: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Versuchen, historische Vorbilder für die Figur des Hagen zu finden. Die geographische Analyse des Namensbestandteils "von Tronege" führt zu verschiedenen Orten in verschiedenen Ländern, ohne jedoch eindeutige Ergebnisse zu liefern. Die etymologische Analyse des Namens "Hagen" deutet auf Bedeutungen wie "Heckendorn" oder "Beschützer" hin, die zur Figur passen, aber keine definitive Aussage über die Intention des Autors zulassen.
Der mythologische Hagen - Bezüge zu den Darstellungen in Sage und Legende: Das Kapitel untersucht intertextuelle Bezüge zu anderen Werken, vor allem zum "Waltharius". Zitate aus dem "Waltharius" und dem Nibelungenlied werden verglichen, um mögliche Verbindungen zur Jugend Hagens und seinen Erfahrungen als Geisel der Hunnen aufzuzeigen. Dieser Vergleich soll helfen, die Figur Hagens besser zu verstehen und in einen größeren mythologischen Kontext einzuordnen.
Das fehlende Zeitgefüge: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text an dieser Stelle endet.)
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Hagen von Tronege, Figurenanalyse, Rezeption, Intertextualität, Waltharius, Namensdeutung, Etymologie, Geographie, Mythologie, Ambivalenz, Widersprüchlichkeit.
Häufig gestellte Fragen zum Nibelungenlied: Hagen von Tronege
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die komplexe Figur des Hagen von Tronege im Nibelungenlied. Sie untersucht die widersprüchliche Darstellung Hagens und beleuchtet verschiedene Interpretationsansätze aus historischer, mythologischer und intertextueller Perspektive.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der widersprüchlichen Darstellung Hagens und seiner Rezeption, der etymologischen und geographischen Analyse seines Namens, intertextuellen Bezügen (insbesondere zum „Waltharius“), Hagens Rolle im Handlungsverlauf und seinen Beziehungen zu anderen Figuren, sowie möglichen Motiven für den Sigfridmord.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu den Problemen der Hagendarstellung und -rezeption, der Namensdeutung (einschließlich realer und mythologischer Bezüge), der Rolle Hagens im Nibelungenlied (seine Beziehungen zu Siegfried und Kriemhild, der Sigfridmord), und Schlussfolgerungen zur Gestalt Hagens. Ein Kapitel zum fehlenden Zeitgefüge ist angedeutet, aber nicht im vorliegenden Auszug vollständig beschrieben.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse verwendet eine Kombination aus literaturwissenschaftlichen Methoden: Figurenanalyse, Rezeptionsforschung, Intertextualitätsanalyse, etymologische und geographische Namensforschung, sowie die Auseinandersetzung mit mythologischen Bezügen.
Welche Ergebnisse werden angestrebt?
Ziel ist ein umfassenderes Verständnis der Figur Hagen von Tronege durch die Berücksichtigung der vielschichtigen und oft widersprüchlichen Interpretationen im Laufe der Rezeptionsgeschichte. Die Arbeit zielt darauf ab, ein differenziertes Bild Hagens zu zeichnen und die Ambivalenzen seiner Darstellung aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Nibelungenlied, Hagen von Tronege, Figurenanalyse, Rezeption, Intertextualität, Waltharius, Namensdeutung, Etymologie, Geographie, Mythologie, Ambivalenz, Widersprüchlichkeit.
Gibt es einen Bezug zu realen historischen Personen?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeit historischer Vorbilder für die Figur des Hagen. Die geographische und etymologische Analyse des Namens „Hagen von Tronege“ liefert jedoch keine eindeutigen Ergebnisse, sodass die Frage nach einem realen Vorbild offen bleibt.
Welche Rolle spielt der „Waltharius“?
Der „Waltharius“ dient als intertextueller Bezugspunkt, um mögliche Verbindungen zur Jugend Hagens und seinen Erfahrungen als Geisel der Hunnen aufzuzeigen und die Figur Hagens in einen größeren mythologischen Kontext einzuordnen. Zitate aus beiden Werken werden verglichen.
Wie wird der Sigfridmord behandelt?
Der Sigfridmord wird als zentraler Handlungspunkt im Kontext der Beziehungen zwischen Hagen, Siegfried und Kriemhild analysiert. Die Arbeit untersucht mögliche Motive für den Mord.
Welche Ambivalenzen weist die Darstellung Hagens auf?
Die Darstellung Hagens im Nibelungenlied ist ambivalent und widersprüchlich. Er wird sowohl als verdammungswürdiger Schurke als auch als positiv konnotierte Gestalt interpretiert. Diese Ambivalenz ist ein zentrales Thema der Arbeit.
- Quote paper
- Dorothea Ehrhardt (Author), 2002, Hagen von Tronege im Nibelungenlied, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/43044