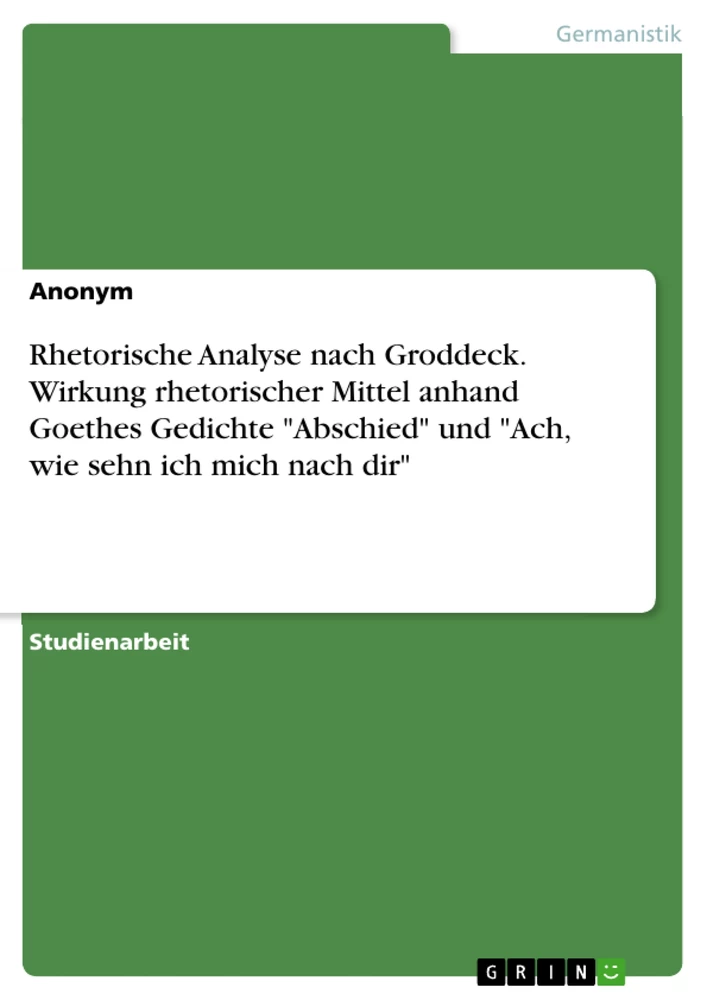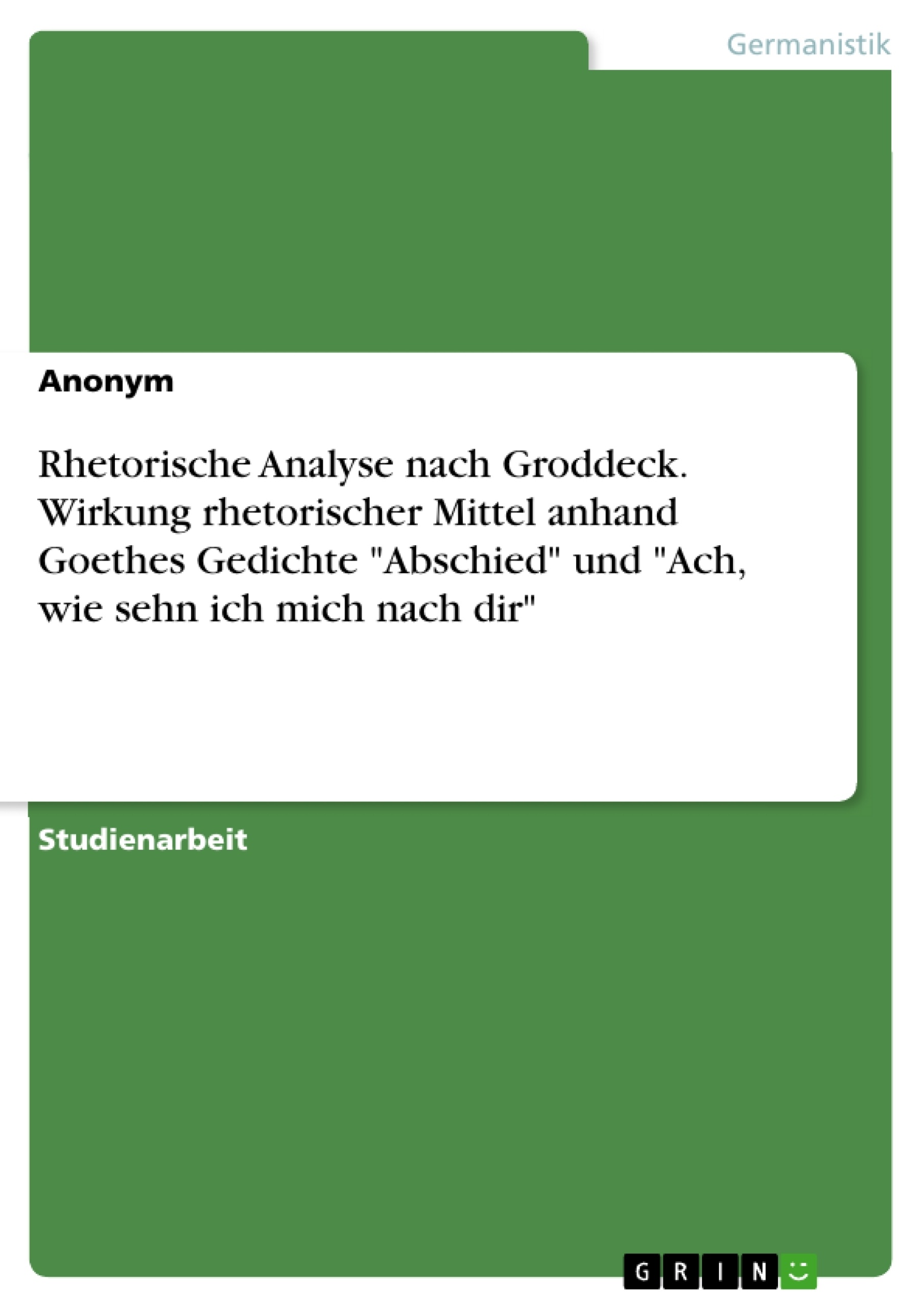Seit der Antike beschäftigen die Menschen sich mit der Sprache und wozu diese imstande ist. Dabei hat sich eine Höchstform herausgebildet, die Rhetorik. Sie wird auch Redekunst genannt, denn sie ermöglichte dem Redner, seine Überzeugungen oder Meinungen ansprechend darzulegen. Im Idealfall schaffte es der Redner, seine Zuhörer zu überzeugen beziehungsweise ihre Meinung zu beeinflussen. Hierbei entstanden schon zur damaligen Zeit zwei Ansichten bezüglich der Rhetorik. Von den einen wurde die Rhetorik als Kunstform angesehen und entsprechend vertreten. Von anderen wurde sie als bloßer Schmuck bezeichnet, die das eigentlich Gesagte hinter schönen Worten verstecke und damit die eigentliche Botschaft entwerte.
Diese gegensätzlichen Ansichten spalteten die Rhetorik zunehmend. Im Laufe der Zeit hatte dies zur Folge, dass sich eingehender mit der Sprache an sich beschäftigt wurde und was die Rhetorik ausmachte. Dabei kam zum Vorschein, dass es viele besondere sprachliche Mittel in der Rhetorik gab - auch rhetorische Mittel genannt. Einer der führenden Forscher der heutigen Zeit, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, ist Wolfram Groddeck. Neben der Beschreibung der einzelnen rhetorischen Stilmittel nahm er auch eine Einteilung in verschiedene Bereiche vor.
Des Weiteren behandelt er in seinem Werk „Reden über Rhetorik“, die Rhetorik als Schmuck und versucht dieses auf verschiedene Art und Weise dazulegen. Hierbei stellt sich die Frage, ob Rhetorik tatsächlich reiner Schmuck ist oder eine Kunstform. Auf den folgenden Seiten sollen daher einige wichtige Stilmittel nach Groddeck vorgestellt werden. Weiterhin soll anhand von zwei Texten demonstriert werden, welche Wirkung die rhetorischen Mittel im Einzelnen erzielen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Groddecks Ansichten über die rhetorischen Mittel
- Metonymie
- Metapher
- Hyperbaton
- Rhetorische Gedichtsanalyse
- Abschied
- „Ach, wie sehn ich mich nach dir“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Wolfram Groddecks Ansichten zur Rhetorik und deren Anwendung in Gedichten. Ziel ist es, wichtige rhetorische Stilmittel nach Groddeck zu präsentieren und deren Wirkung anhand von Beispieltexten zu demonstrieren. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob Rhetorik als bloßer Schmuck oder als Kunstform zu verstehen ist.
- Groddecks Definition und Klassifizierung rhetorischer Mittel
- Analyse der Metonymie, Metapher und des Hyperbatons nach Groddeck
- Anwendung rhetorischer Mittel in Gedichten
- Wirkung rhetorischer Mittel auf den Leser
- Rhetorik als Kunstform vs. bloßer Schmuck
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Rhetorik ein und stellt die gegensätzlichen Ansichten zur Rhetorik als Kunstform oder bloßer Schmuck dar. Sie benennt Wolfram Groddeck als wichtigen Forscher auf diesem Gebiet und kündigt die folgende Präsentation wichtiger rhetorischer Stilmittel sowie deren Analyse in Beispieltexten an. Der einleitende Abschnitt etabliert die zentrale Fragestellung der Arbeit: Ist Rhetorik reine Dekoration oder eine eigenständige Kunstform? Diese Frage wird als roter Faden durch die gesamte Arbeit gespannt und soll im Verlauf der Analyse beantwortet werden. Die Einleitung schafft einen klaren Rahmen für die folgenden Kapitel und bereitet den Leser auf die bevorstehende detaillierte Auseinandersetzung mit Groddecks Werk vor.
Groddecks Ansichten über die rhetorischen Mittel Metonymie, Metapher und Hyperbaton: Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit drei zentralen rhetorischen Mitteln nach Groddeck: Metonymie, Metapher und Hyperbaton. Es erklärt die etymologische Herkunft der Begriffe und beschreibt die jeweiligen Mechanismen der sprachlichen Figuren. Die Metonymie wird als Umbenennung definiert, bei der ein Begriff durch einen anderen in realem Zusammenhang ersetzt wird. Die Metapher wird als Übertragung aufgrund von Ähnlichkeiten beschrieben. Das Hyperbaton wird als Umstellung von Satzgliedern definiert, die eine poetische Spannung erzeugt. Für jedes Mittel werden prägnante Beispiele angeführt, um die Erklärungen zu veranschaulichen und ein besseres Verständnis zu fördern. Der Abschnitt vergleicht und kontrastiert die drei Figuren, um ihre jeweiligen Besonderheiten und Funktionen hervorzuheben und die differenzierte Herangehensweise Groddecks zu verdeutlichen.
Rhetorische Gedichtsanalyse (Abschied): Dieses Kapitel analysiert Goethes Sonett „Abschied“ hinsichtlich des Gebrauchs rhetorischer Mittel. Es wird die Verwendung von Hyperbeln und Metaphern im Gedicht erläutert und deren Funktion für die Darstellung von Liebe, Leid und Trennung analysiert. Die Analyse zeigt, wie die rhetorischen Figuren die Stimmung und das lyrische Ich des Gedichts prägen und die emotionale Wirkung verstärken. Die Analyse fokussiert auf die Textimmanenz, d.h. den Gebrauch von rhetorischen Mitteln innerhalb des Gedichts selbst, wobei die syntaktischen Strukturen und die semantische Bedeutung der stilistischen Mittel herausgestellt werden. Die ausgewählten Beispiele aus dem Gedicht veranschaulichen die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen rhetorischen Figuren und ihre Anwendung in einem konkreten literarischen Kontext.
Schlüsselwörter
Rhetorik, Wolfram Groddeck, Metonymie, Metapher, Hyperbaton, Stilmittel, Gedichtsanalyse, Goethe, „Abschied“, sprachliche Figuren, Redekunst, Kunstform, Schmuck.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse rhetorischer Mittel nach Groddeck
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Ansichten von Wolfram Groddeck zur Rhetorik und deren Anwendung in Gedichten. Im Fokus stehen die rhetorischen Stilmittel Metonymie, Metapher und Hyperbaton. Die Arbeit untersucht, ob Rhetorik als bloßer Schmuck oder als eigenständige Kunstform zu verstehen ist.
Welche rhetorischen Mittel werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei zentrale rhetorische Mittel nach Groddeck: Metonymie, Metapher und Hyperbaton. Die Arbeit erklärt diese Mittel detailliert, veranschaulicht sie mit Beispielen und analysiert ihre Wirkung in konkreten literarischen Texten.
Wie wird Groddecks Sicht auf Rhetorik dargestellt?
Die Arbeit präsentiert Groddecks Definition und Klassifizierung der ausgewählten rhetorischen Mittel. Sie erläutert die etymologischen Hintergründe der Begriffe und beschreibt die jeweiligen Mechanismen der sprachlichen Figuren. Der Vergleich und Kontrast der drei Figuren verdeutlicht Groddecks differenzierte Herangehensweise.
Welche Gedichte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Goethes Sonett „Abschied“ als Beispieltext. Die Analyse konzentriert sich auf den Gebrauch von Hyperbeln und Metaphern und deren Funktion für die Darstellung von Liebe, Leid und Trennung im Gedicht.
Wie wird die Gedichtsanalyse durchgeführt?
Die Gedichtsanalyse folgt einem textimmanenten Ansatz. Das bedeutet, dass die Analyse sich auf den Gebrauch der rhetorischen Mittel innerhalb des Gedichts selbst konzentriert, wobei die syntaktischen Strukturen und die semantische Bedeutung der stilistischen Mittel im Vordergrund stehen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Frage der Arbeit ist, ob Rhetorik als bloßer Schmuck oder als eigenständige Kunstform zu verstehen ist. Diese Frage wird im Laufe der Analyse anhand von Groddecks Ansichten und der Analyse von Beispieltexten beantwortet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Groddecks Ansichten zu Metonymie, Metapher und Hyperbaton, ein Kapitel zur rhetorischen Gedichtsanalyse (am Beispiel von Goethes „Abschied“) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rhetorik, Wolfram Groddeck, Metonymie, Metapher, Hyperbaton, Stilmittel, Gedichtsanalyse, Goethe, „Abschied“, sprachliche Figuren, Redekunst, Kunstform, Schmuck.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für Rhetorik, Literaturwissenschaft und die Analyse von Gedichten interessieren. Sie ist besonders relevant für Studenten und Wissenschaftler, die sich mit der Rhetoriktheorie und -analyse befassen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Rhetorische Analyse nach Groddeck. Wirkung rhetorischer Mittel anhand Goethes Gedichte "Abschied" und "Ach, wie sehn ich mich nach dir", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/429210