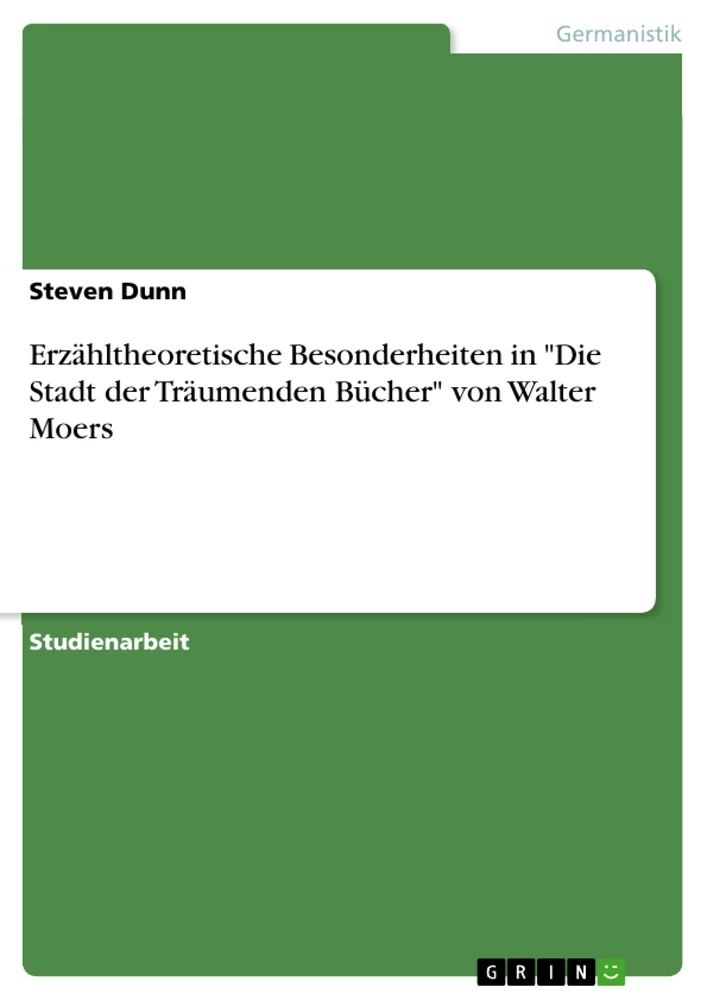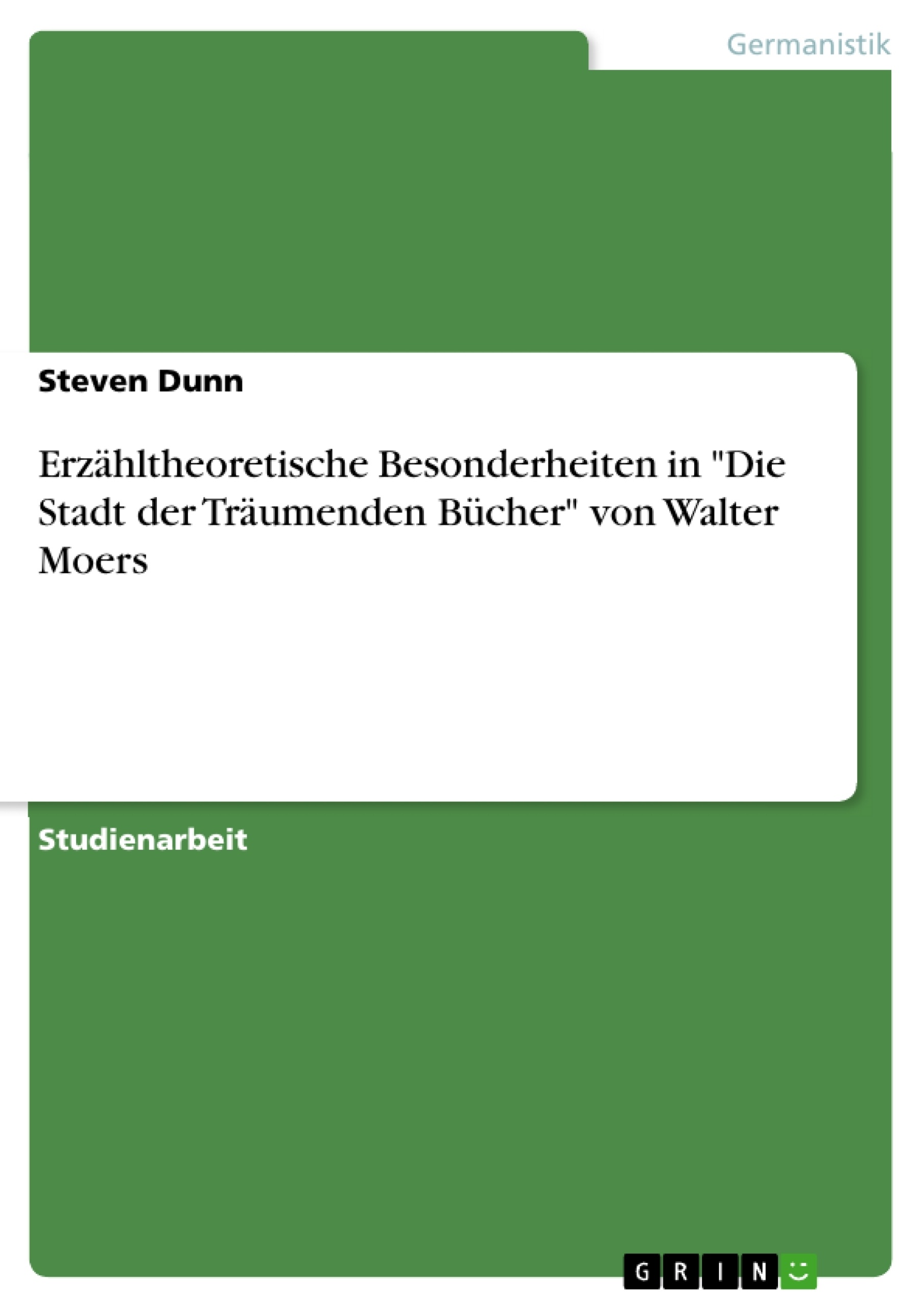Walter Moers hat in seinen bisher sechs Zamonien-Romanen, zu denen auch "Die Stadt der Träumenden Bücher" (2004) gehört, eine faszinierende fiktive Welt erschaffen, die sich durch einen besonderen Detailreichtum und außerordentliche Originalität auszeichnet. Dabei sind sie beim Lesepublikum beliebt und wurden von Literaturkritikern in der Presse sehr positiv bewertet. Trotz vielfältiger Verweise auf literarische Klassiker und einer großen Zahl formaler und stilistischer Gestaltungsmittel, hat sich die geisteswissenschaftliche Forschung bisher nur wenig mit Moers‘ Werk auseinandergesetzt.
Diese Arbeit versucht eine Analyse des Romans anhand ausgewählter erzähltheoretischer Kategorien bzw. solcher, die Auswirkungen auf die Erzählung haben. Dabei soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, welche Merkmale als charakteristisch für Die Stadt der Träumenden Bücher angesehen werden können. Der speziellen Erzähltechnik Moers‘ soll im Rahmen dieser Untersuchung Rechnung getragen werden, indem nicht ein spezifisches Merkmal herausgegriffen und alleinstehend analysiert und interpretiert wird, sondern der Versuch unternommen wird, gerade die Heterogenität wiederzugeben. Dabei kann aufgrund des begrenzten Umfangs freilich dennoch nur ein Ausschnitt der verwendeten Gestaltungsmittel betrachtet werden. Die untersuchten Aspekte sind dabei nicht ausschließlich narrative Elemente, sollen aber insbesondere hinsichtlich ihrer Wirkungen für die Narration analysiert und interpretiert werden.
Dazu wird in Abschnitt zwei die besondere Stellung des Autors analysiert, die einerseits durch eine Autor- bzw. Herausgeberfiktion, andererseits durch eine Abschwächung der Trennung von Autor und Erzähler gekennzeichnet ist. Im Anschluss wird ebendiese spezielle Rolle des Erzählers im übergeordneten Konzept der Stimme noch näher betrachtet. In Abschnitt drei wird der Frage nachgegangen, inwiefern der Roman Formen unzuverlässigen Erzählens beinhaltet und welche Auswirkungen dies für die Erzählung haben könnte. Abschnitt vier beschäftigt sich schließlich mit drei verschiedenen Charakteristika des Romans, von denen nur der dramatische Modus eine erzähltheoretische Analysekategorie darstellt, während die Namensgebung und die visuelle Gestaltung eher indirekt auf die Narration wirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Moers vs. Mythenmetz – Autorschaft und Stimme in Die Stadt der Träumenden Bücher
- Die Herausgeberfiktion - Moers als Übersetzer und Illustrator
- „Seid gegrüßt, meine waghalsigen Freunde\" – die Stimme
- Zwischen Erlebnisbericht und künstlerischer Freiheit – unzuverlässiges Erzählen in Die Stadt der Träumenden Bücher
- Weitere Besonderheiten in Die Stadt der Träumenden Bücher und ihre Wirkung
- „Da kann keiner aufhören zu lesen!\" – der dramatische Modus
- Buchhaim bis Schattenkönig – die Bedeutung der Namen
- Visuelle Gestaltung des Buches
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Walter Moers' Roman „Die Stadt der Träumenden Bücher“ unter erzähltheoretischen Gesichtspunkten. Ziel ist es, charakteristische Merkmale des Romans zu identifizieren und die besondere Erzähltechnik Moers' zu untersuchen, wobei die Heterogenität der Gestaltungsmittel im Vordergrund steht. Der begrenzte Umfang erlaubt jedoch nur die Betrachtung eines Ausschnitts.
- Die Rolle des Autors und die Herausgeberfiktion
- Die Stimme des Erzählers und deren Besonderheiten
- Unzuverlässiges Erzählen und dessen Auswirkungen
- Der dramatische Modus als erzähltheoretische Kategorie
- Die Bedeutung von Namen und die visuelle Gestaltung des Buches
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Roman „Die Stadt der Träumenden Bücher“ von Walter Moers im Kontext seiner Zamonien-Reihe. Sie hebt die bisherige Forschungslücke bezüglich geisteswissenschaftlicher Analysen von Moers' Werk hervor und skizziert den Ansatz der vorliegenden Arbeit: eine Analyse ausgewählter erzähltheoretischer Kategorien und deren Auswirkungen auf die Erzählung. Die Einleitung betont den Versuch, die Heterogenität der Gestaltungsmittel wiederzugeben und kündigt die Struktur der folgenden Abschnitte an.
Moers vs. Mythenmetz – Autorschaft und Stimme in Die Stadt der Träumenden Bücher: Dieses Kapitel analysiert die besondere Stellung des Autors, gekennzeichnet durch eine Herausgeberfiktion (Moers als Übersetzer und Illustrator) und eine Abschwächung der Trennung von Autor und Erzähler. Es wird gezeigt, wie Moers durch diese Konstruktion ein Spiel mit Fiktionalität und Realität inszeniert. Die Fußnoten des fiktiven Herausgebers Moers, die teils sehr ausschweifend sind und die Linearität der Narration aufheben, werden als wichtiges Element der Herausgeberfiktion diskutiert. Das Kapitel beleuchtet die Ambivalenz der Darstellung: Einerseits wird die fiktive Figur Mythenmetz scheinbar in der Realität verortet, andererseits wird die literarische Inszenierung durch den Namen und den Hinweis auf Zamonien deutlich gemacht. Die Arbeit mit Fußnoten, die die Aufmerksamkeit vom Haupttext weglenken und die Fiktionalität betonen, wird analysiert.
Schlüsselwörter
Walter Moers, Die Stadt der Träumenden Bücher, Erzähltheorie, Herausgeberfiktion, unzuverlässiges Erzählen, dramatischer Modus, Namensgebung, visuelle Gestaltung, Zamonien, Mythenmetz.
Häufig gestellte Fragen zu „Die Stadt der Träumenden Bücher“ - Eine erzähltheoretische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Walter Moers' Roman „Die Stadt der Träumenden Bücher“ unter erzähltheoretischen Gesichtspunkten. Sie untersucht charakteristische Merkmale des Romans und die besondere Erzähltechnik Moers', wobei die Heterogenität der Gestaltungsmittel im Vordergrund steht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Analyse konzentriert sich auf folgende Themen: die Rolle des Autors und die Herausgeberfiktion, die Stimme des Erzählers und deren Besonderheiten, unzuverlässiges Erzählen und dessen Auswirkungen, den dramatischen Modus als erzähltheoretische Kategorie, die Bedeutung von Namen und die visuelle Gestaltung des Buches.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Autorschaft und Stimme (Moers vs. Mythenmetz), ein Kapitel über unzuverlässiges Erzählen, ein Kapitel über weitere Besonderheiten (dramatischer Modus, Namensgebung, visuelle Gestaltung) und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Wie wird die Autorschaft in der Analyse betrachtet?
Die Analyse untersucht die besondere Stellung des Autors, gekennzeichnet durch eine Herausgeberfiktion (Moers als Übersetzer und Illustrator) und eine Abschwächung der Trennung von Autor und Erzähler. Es wird gezeigt, wie Moers durch diese Konstruktion ein Spiel mit Fiktionalität und Realität inszeniert. Die Rolle der Fußnoten des fiktiven Herausgebers wird dabei besonders hervorgehoben.
Welche Rolle spielt unzuverlässiges Erzählen?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen unzuverlässigen Erzählens in „Die Stadt der Träumenden Bücher“. Dieser Aspekt wird im Kontext der anderen analysierten erzähltheoretischen Kategorien betrachtet.
Welche weiteren Aspekte werden untersucht?
Neben Autorschaft und unzuverlässigem Erzählen werden auch der dramatische Modus, die Bedeutung von Namen (z.B. Buchhaim, Schattenkönig) und die visuelle Gestaltung des Buches als wichtige Elemente der Erzählstruktur analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Walter Moers, Die Stadt der Träumenden Bücher, Erzähltheorie, Herausgeberfiktion, unzuverlässiges Erzählen, dramatischer Modus, Namensgebung, visuelle Gestaltung, Zamonien, Mythenmetz.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit hebt eine bisherige Forschungslücke bezüglich geisteswissenschaftlicher Analysen von Moers' Werk hervor und bietet eine detaillierte Analyse ausgewählter erzähltheoretischer Kategorien und deren Auswirkungen auf die Erzählung.
- Arbeit zitieren
- Steven Dunn (Autor:in), 2016, Erzähltheoretische Besonderheiten in "Die Stadt der Träumenden Bücher" von Walter Moers, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/423856