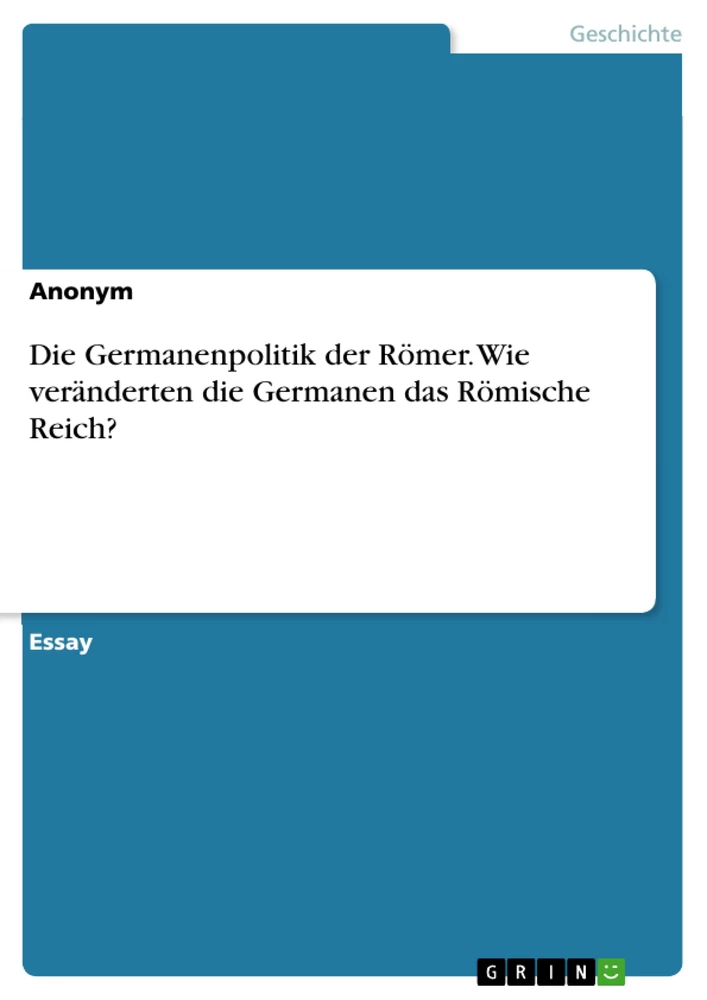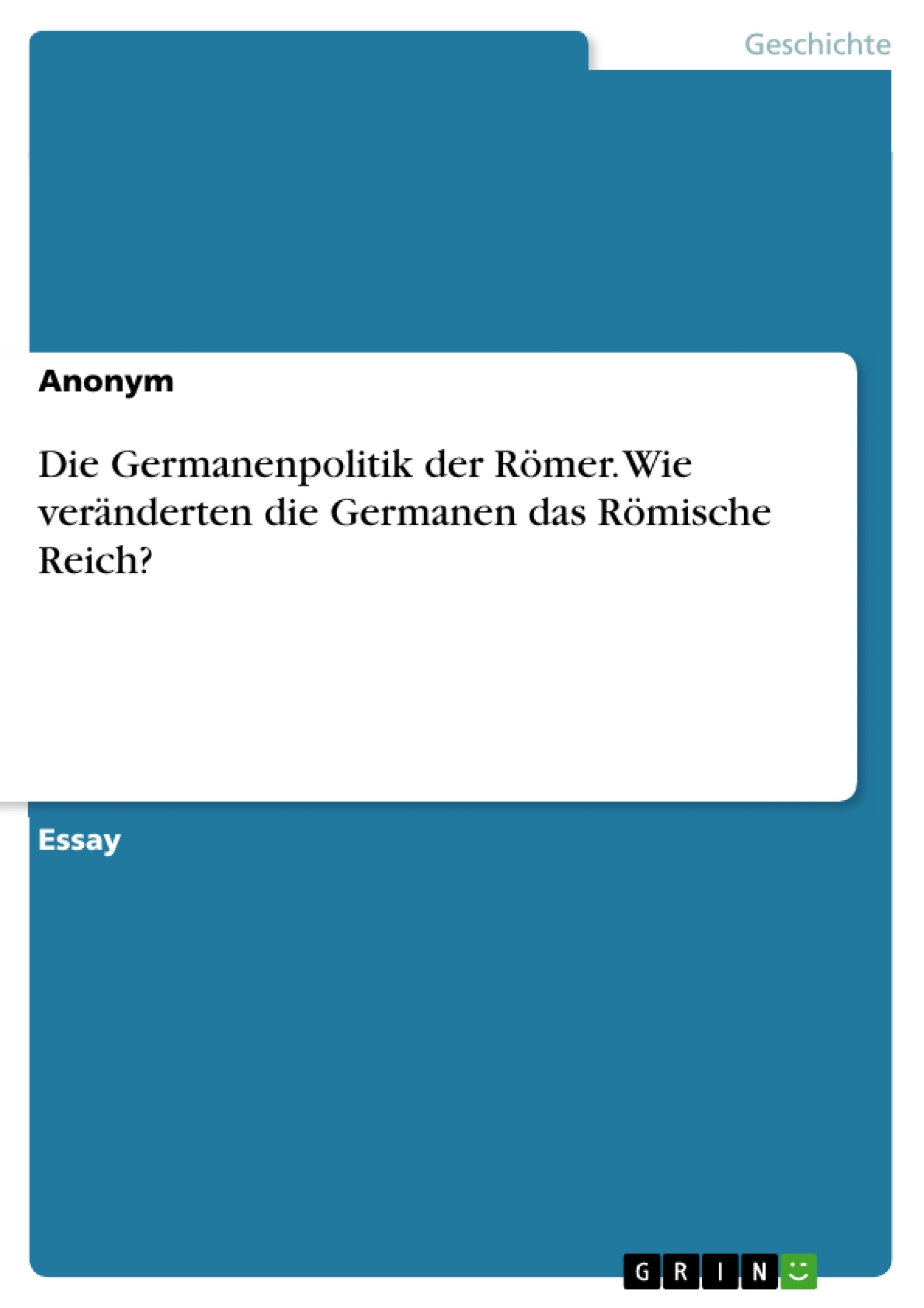„Einst waren die Römer die stärksten, jetzt sind sie ohne Kraft; die alten Römer wurden gefürchtet, wir leben in Furcht; ihnen zahlten die Barbarenvölker Steuern, wir sind Steuerzahler für die Barbaren“ (6,98).
Dieses Zitat stammt aus Priester Salvians von Marseille Schrift, um 440 erschienen, „Vom Walten Gottes“. Es erläutert die Ansicht des Priesters, der zur Zeit des sich andeutenden „Untergangs“ des Römischen Reiches gelebt hat.
Er legt in diesem Ausschnitt seine Sicht auf die Situation der damaligen Zeit dar. Doch wie konnte es soweit kommen, dass die Römer, die einst die Stärksten waren, nun ohne Kraft seien?
Mit den Barbarenvölkern sind germanische Stämme gemeint, inwiefern haben diese zum Untergang des Römischen Reiches beigetragen?
Wie sind die Römer mit diesen Barbaren umgegangen?
Diese Fragen werde ich im Folgenden anhand von Klaus Rosens Werk „die Völkerwanderung“ beantworten. Dabei werde ich zunächst auf die Germanenpolitik der Römer bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts, im nächsten Teil werde ich dann auf die Germanenpolitik nach der Mitte des vierten Jahrhunderts eingehen und werde schließlich das Wesentliche in einem Fazit zusammenfassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie sah die Germanenpolitik bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts aus?
- Die Etablierung der Germanen im Römischen Reich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Germanenpolitik des Römischen Reiches und deren Einfluss auf den Untergang des Reiches. Sie analysiert die römischen Strategien im Umgang mit germanischen Stämmen und die allmähliche Integration dieser Stämme in das römische System. Die Arbeit beleuchtet die Ursachen des Machtverlustes Roms und die Rolle der Germanen in diesem Prozess.
- Römische Strategien im Umgang mit germanischen Stämmen (Diplomatie, militärische Aktionen, Integration)
- Die Rolle germanischer Söldner im römischen Heer
- Die Schwäche der römischen Herrschaft im 4. Jahrhundert
- Die Etablierung von Germanen in hohen Ämtern des Römischen Reiches
- Der Einfluss der Germanen auf die politische und militärische Situation des Römischen Reiches
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Beitrag der Germanen zum Untergang des Römischen Reiches und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich auf Klaus Rosens Werk "Die Völkerwanderung" stützt. Sie zitiert ein aussagekräftiges Zitat von Salvian von Marseille, das den dramatischen Machtwechsel zwischen Römern und Germanen verdeutlicht und die Forschungsfrage prägnant formuliert.
Wie sah die Germanenpolitik bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts aus?: Dieses Kapitel beschreibt die anfänglichen römischen Reaktionen auf den Kontakt mit germanischen Stämmen, beginnend mit den Kimbern und Teutonen. Es beleuchtet die verschiedenen Strategien, die Rom einsetzte, einschließlich militärischer Abwehr, diplomatischer Beziehungen und geschickter Ausnutzung innergermanischer Konflikte. Die Integration von "dediticii" und germanischen Söldnern in das römische Heer wird als wichtiger Faktor für die relative Stabilität der Situation bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts hervorgehoben. Die Kapitel verdeutlicht, dass die römische Germanenpolitik zwar nicht immer friedlich war, aber dennoch zu einer gewissen Beruhigung der Lage führte.
Die Etablierung der Germanen im Römischen Reich: Dieses Kapitel behandelt die dramatischen Veränderungen nach der Mitte des 4. Jahrhunderts, die mit dem Ende der Reihe der kurzlebigen Soldatenkaiser einhergingen. Es analysiert die Ursachen für den Untergang des Westreiches, die nicht nur in der steigenden Macht der Germanen, sondern vor allem in der Schwäche der römischen Herrschaft selbst begründet werden. Die hohen Bevölkerungszahlen germanischer Stämme werden als ein Faktor genannt, wobei die Genauigkeit der historischen Quellen betont wird. Das Beispiel des Kinderkaisers Valentinian II. unterstreicht die Schwäche der römischen Führung. Der Gotenvertrag von 382, der die Integration der Goten anstrebte, wird als gescheitertes Beispiel für ein friedliches Miteinander dargestellt. Das Kapitel zeigt auf, wie Germanen wie Merobaudes und Arbogast hohe militärische Positionen erreichten und erheblichen Einfluss auf die römische Politik ausübten, letztendlich aber auch durch Theodosius besiegt wurden. Die Kapitel unterstreicht die zunehmende germanische Präsenz in den Führungsebenen des Reiches und den damit verbundenen Machtverlust Roms.
Schlüsselwörter
Germanenpolitik, Römisches Reich, Völkerwanderung, Germanische Stämme, Söldner, Integration, Untergang des Römischen Reiches, Soldatenkaiser, Gotenvertrag, Merobaudes, Arbogast, Theodosius.
Häufig gestellte Fragen zur Germanenpolitik des Römischen Reiches
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Germanenpolitik des Römischen Reiches und ihren Einfluss auf den Untergang des Westreiches. Sie analysiert die römischen Strategien im Umgang mit germanischen Stämmen und deren allmähliche Integration in das römische System. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Ursachen des römischen Machtverlustes und der Rolle der Germanen in diesem Prozess.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die römischen Strategien im Umgang mit germanischen Stämmen (Diplomatie, militärische Aktionen, Integration), die Rolle germanischer Söldner im römischen Heer, die Schwäche der römischen Herrschaft im 4. Jahrhundert, die Etablierung von Germanen in hohen Ämtern und deren Einfluss auf die politische und militärische Situation des Römischen Reiches.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, drei Hauptkapiteln und einem Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Kapitel 1 beschreibt die Germanenpolitik bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts. Kapitel 2 behandelt die Etablierung der Germanen im Römischen Reich nach Mitte des 4. Jahrhunderts. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Werk "Die Völkerwanderung" von Klaus Rosen und zitiert Salvian von Marseille, um die dramatischen Machtverschiebungen zwischen Römern und Germanen zu verdeutlichen. Die Arbeit analysiert historische Quellen, um die Genauigkeit der Aussagen zu gewährleisten und die Rolle der Germanen im Untergang des Weströmischen Reiches zu beleuchten.
Wie sah die römische Germanenpolitik bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts aus?
Die anfänglichen römischen Reaktionen auf den Kontakt mit germanischen Stämmen beinhalteten militärische Abwehr, diplomatische Beziehungen und die Ausnutzung innergermanischer Konflikte. Die Integration von "dediticii" und germanischen Söldnern in das römische Heer führte zu einer relativen Stabilität bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts. Die Politik war nicht immer friedlich, führte aber zu einer gewissen Beruhigung der Lage.
Was geschah nach der Mitte des 4. Jahrhunderts?
Nach der Mitte des 4. Jahrhunderts kam es zu dramatischen Veränderungen, die mit dem Ende der kurzlebigen Soldatenkaiser zusammenhingen. Der Untergang des Weströmischen Reiches wird nicht nur auf die steigende Macht der Germanen, sondern auch auf die Schwäche der römischen Herrschaft selbst zurückgeführt. Hohe Bevölkerungszahlen germanischer Stämme, die Schwäche der römischen Führung (Beispiel Valentinian II.) und gescheiterte Integrationsversuche wie der Gotenvertrag von 382 spielten eine Rolle. Germanen wie Merobaudes und Arbogast erreichten hohe Positionen, übten erheblichen Einfluss aus, wurden aber letztendlich von Theodosius besiegt. Die germanische Präsenz in Führungsebenen nahm zu, was den Machtverlust Roms beschleunigte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Germanenpolitik, Römisches Reich, Völkerwanderung, Germanische Stämme, Söldner, Integration, Untergang des Römischen Reiches, Soldatenkaiser, Gotenvertrag, Merobaudes, Arbogast, Theodosius.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Untergang des Weströmischen Reiches nicht allein auf die Germanen zurückzuführen ist, sondern auch auf die innere Schwäche des Reiches selbst. Die zunehmende Integration und der Einfluss der Germanen trugen jedoch maßgeblich zum Machtverlust Roms und dem Prozess des Untergangs bei.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Die Germanenpolitik der Römer. Wie veränderten die Germanen das Römische Reich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/421611