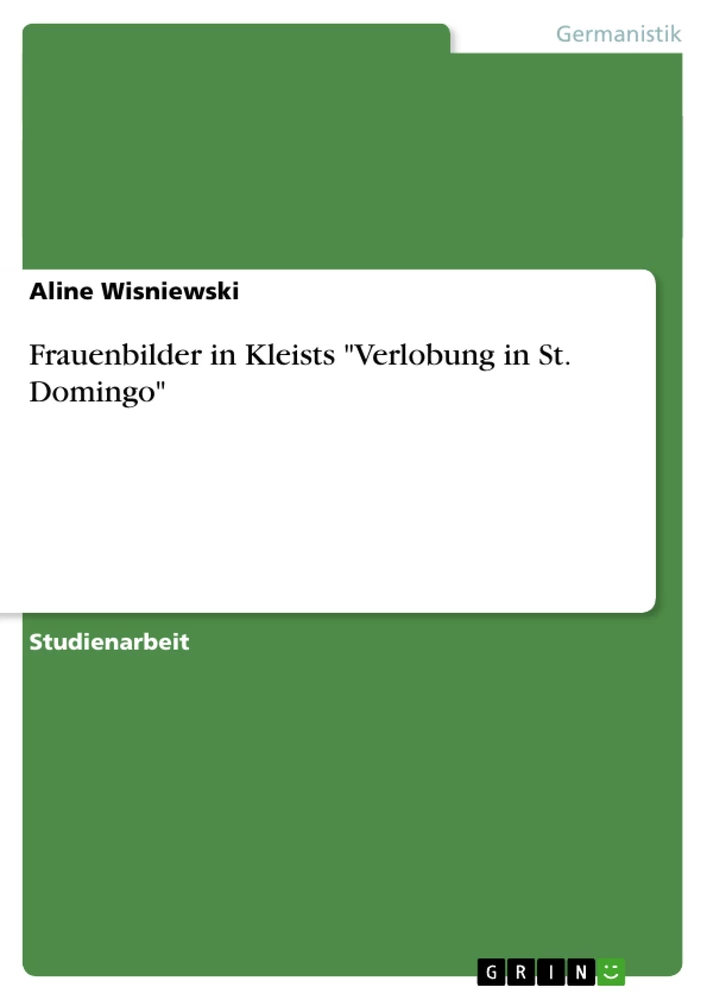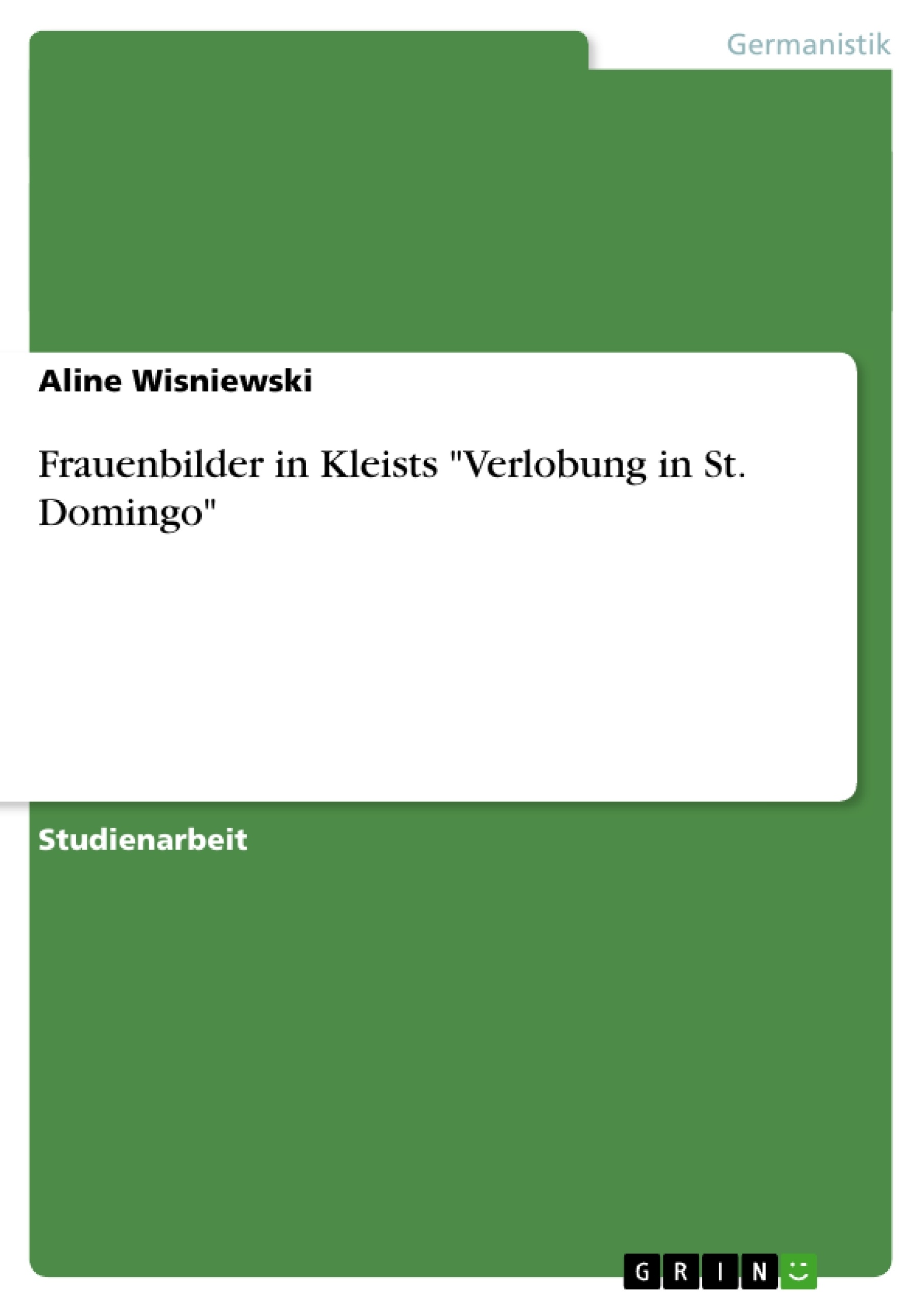Einleitung
„Alles, was Männer über die Frauen geschrieben haben, muß verdächtig sein, denn sie sind zugleich Richter und Partei.“
Poulain de la Barre 1
Die Frauenbilder, die uns in der Historie begegnen sind fast ausschließlich von den männlichen Wunsch- und Schreckensbildern ihrer Zeit geprägt. Und auch wenn das in der, dieser Arbeit zugrunde liegenden Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“ von Kleist nicht anders ist, soll diese Arbeit doch aufzeigen, in wieweit die von ihm dargestellten Frauenbildern von den gesellschaftlichen Vorstellungen seiner Zeit geprägt sind und inwieweit es ihm vielleicht doch nur darum ging, ein bestimmtes Weiblichkeitsmuster seiner Zeit zu propagieren oder zu unterminieren. Dies soll in der hier vorliegenden Arbeit geklärt werden. Dazu werde ich zunächst auf das allgemein publiziert Frauenbild dieser Zeit eingehen, um dann die Frauenbilder in Kleists Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“ näher untersuchen zu können.
Dabei habe ich mich vor allem auf die zwei Weiblichkeitsmuster aus den Legenden konzentriert, in denen Gustav Toni zwei Frauenbilder aufzeigt, die zum einen als Wunsch- und Schreckensbilder um 1800 gelten, also der Zeit, in der Kleist lebte und wirkte, die zum anderen aber auch Gustavs eigenem Wunsch- und Angstbild entsprechen. Das andere Frauenbild, das Kleist in seiner Erzählung aufzeigt ist das der Mestize Toni, in deren Figur sich die Zuspitzung des Konflikt in der Erzählung verkörpert. In Kleists Erzählung spielt neben der Thematik der Stellung der Frau in der Gesellschaft auch der Rassendiskurs eine große Rolle. Da diese beiden sich in der Erzählung Überkreuzen ist es für die Untersuchung von größter Wichtigkeit beide im Zusammenhang zu betrachten und zu werten. Ich habe versucht dies in meiner Arbeit weitgehendst zu berücksichtigen.
-------
1 Beauvoir, Simone de: Das andere Geschlecht, Sitte und Sexus der Frau, Reinbek bei Hamburg 1968, S.7
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frauenbilder in der Literatur um 1800
- Frauenbilder in Kleists „Die Verlobung in St. Domingo“
- Das Negermädchen
- Marianne Congreve - Die Weiße
- Toni - Die Mestize
- Toni und Gustav
- Frauenbilder in Kleists „Die Verlobung in St. Domingo“
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frauenbilder in Kleists Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“ im Kontext der gesellschaftlichen Vorstellungen um 1800. Es wird analysiert, inwieweit Kleists Darstellung von den vorherrschenden Weiblichkeitsmustern geprägt ist und ob er diese propagiert oder unterminiert.
- Die gesellschaftlichen Frauenbilder um 1800
- Analyse der Frauenfiguren in „Die Verlobung in St. Domingo“
- Der Einfluss des Rassendiskurses auf die Darstellung der Frauen
- Kleists mögliche Intention bezüglich der Darstellung von Weiblichkeit
- Die Ambivalenz der Frauenbilder als Wunsch- und Schreckensbilder
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss gesellschaftlicher Vorstellungen auf Kleists Frauenbilder in „Die Verlobung in St. Domingo“. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse der Frauenfiguren im Kontext der damaligen Weiblichkeitsmuster und des Rassendiskurses umfasst. Der Fokus liegt auf den Figuren Toni und Marianne Congreve als Repräsentanten von Wunsch- und Schreckensbildern des 19. Jahrhunderts. Die Einleitung betont die Bedeutung der Berücksichtigung beider Aspekte, um die Komplexität der Darstellung zu erfassen.
Frauenbilder in der Literatur um 1800: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen und literarischen Frauenbilder des 18. Jahrhunderts, betont deren Prägung durch männliche Sichtweisen und Wunsch- bzw. Schreckensbilder. Es werden Beispiele wie Lilith und Eva herangezogen, um die stereotypen Rollenzuschreibungen zu veranschaulichen. Das Kapitel diskutiert die ambivalente Darstellung von Frauen in der aufklärerischen Literatur, wo sie einerseits als freie Wesen, andererseits in traditionellen Rollenbildern erscheinen. Die Rolle der Revolutionspublikationen und des konterrevolutionären Journalismus im Formulieren widersprüchlicher Weiblichkeitsentwürfe wird ebenfalls behandelt. Schließlich werden die ambivalenten Bilder der „revolutionssüchtigen Frau“ und der „Märtyrerin“ als exemplarisch für die Zeit diskutiert.
Schlüsselwörter
Frauenbilder, Kleist, Die Verlobung in St. Domingo, Weiblichkeitsmuster, Rassendiskurs, Literatur um 1800, Wunschbilder, Schreckensbilder, gesellschaftliche Vorstellungen, Ambivalenz.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Verlobung in St. Domingo": Frauenbilder um 1800
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Frauen in Heinrich von Kleists Erzählung "Die Verlobung in St. Domingo" und setzt diese in den Kontext der gesellschaftlichen Vorstellungen um 1800. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie Kleists Frauenbilder von den vorherrschenden Weiblichkeitsmustern beeinflusst sind und ob er diese bestätigt oder untergräbt.
Welche Frauenfiguren werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich insbesondere auf die Figuren Toni (die Mestize) und Marianne Congreve (die weiße Frau), die als Repräsentanten von Wunsch- und Schreckensbildern der damaligen Zeit betrachtet werden. Das Negermädchen wird ebenfalls als relevante Figur im Kontext der Analyse des Rassendiskurses behandelt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den gesellschaftlichen Frauenbildern um 1800, der Analyse der Frauenfiguren in "Die Verlobung in St. Domingo", dem Einfluss des Rassendiskurses auf die Darstellung der Frauen, Kleists möglicher Intention bezüglich der Darstellung von Weiblichkeit und der Ambivalenz der Frauenbilder als Wunsch- und Schreckensbilder.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Frauenbildern in der Literatur um 1800, eine Schlussbetrachtung und enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Das Hauptkapitel beleuchtet die historischen und literarischen Frauenbilder und deren Ambivalenzen. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Analyse der Frauenfiguren erfolgt im Kontext der damaligen Weiblichkeitsmuster und des Rassendiskurses. Es wird untersucht, inwieweit Kleists Darstellung von den vorherrschenden Vorstellungen geprägt ist und ob er diese stützt oder hinterfragt. Die Arbeit berücksichtigt sowohl Wunsch- als auch Schreckensbilder, um die Komplexität der Darstellung zu erfassen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Frauenbilder, Kleist, Die Verlobung in St. Domingo, Weiblichkeitsmuster, Rassendiskurs, Literatur um 1800, Wunschbilder, Schreckensbilder, gesellschaftliche Vorstellungen, Ambivalenz.
Wie werden die Frauenbilder in der Literatur um 1800 dargestellt?
Das Kapitel über Frauenbilder um 1800 beleuchtet die historischen und literarischen Frauenbilder des 18. Jahrhunderts, deren Prägung durch männliche Sichtweisen und die Ambivalenz zwischen Wunsch- und Schreckensbildern. Es werden Beispiele wie Lilith und Eva herangezogen und die Rolle der Revolutionspublikationen und des konterrevolutionären Journalismus diskutiert.
- Quote paper
- Aline Wisniewski (Author), 2004, Frauenbilder in Kleists "Verlobung in St. Domingo", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/42018