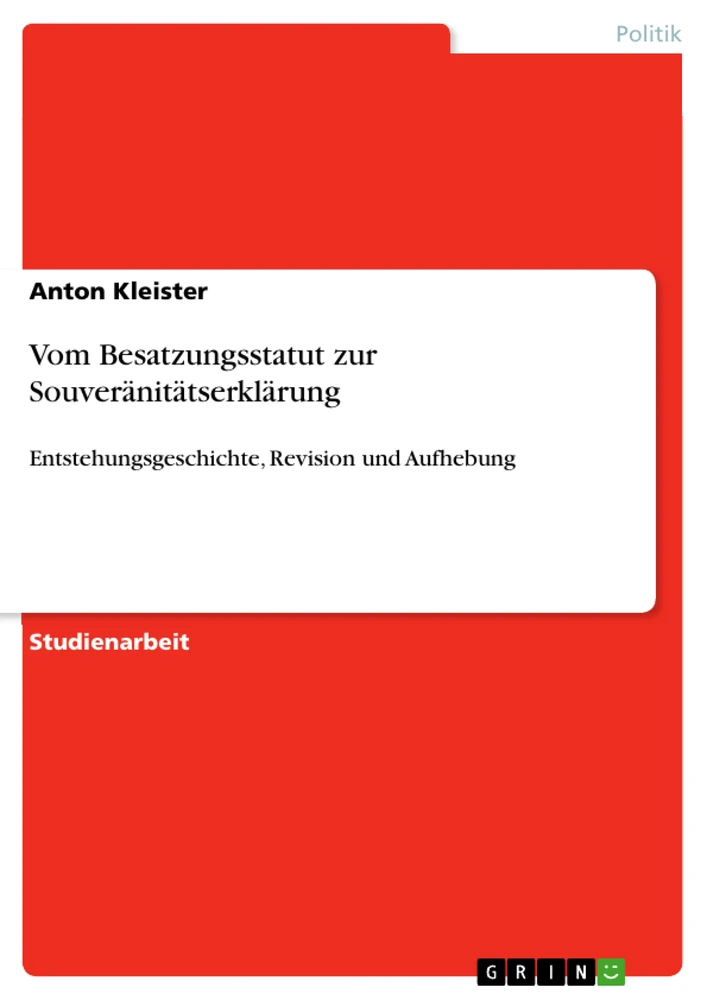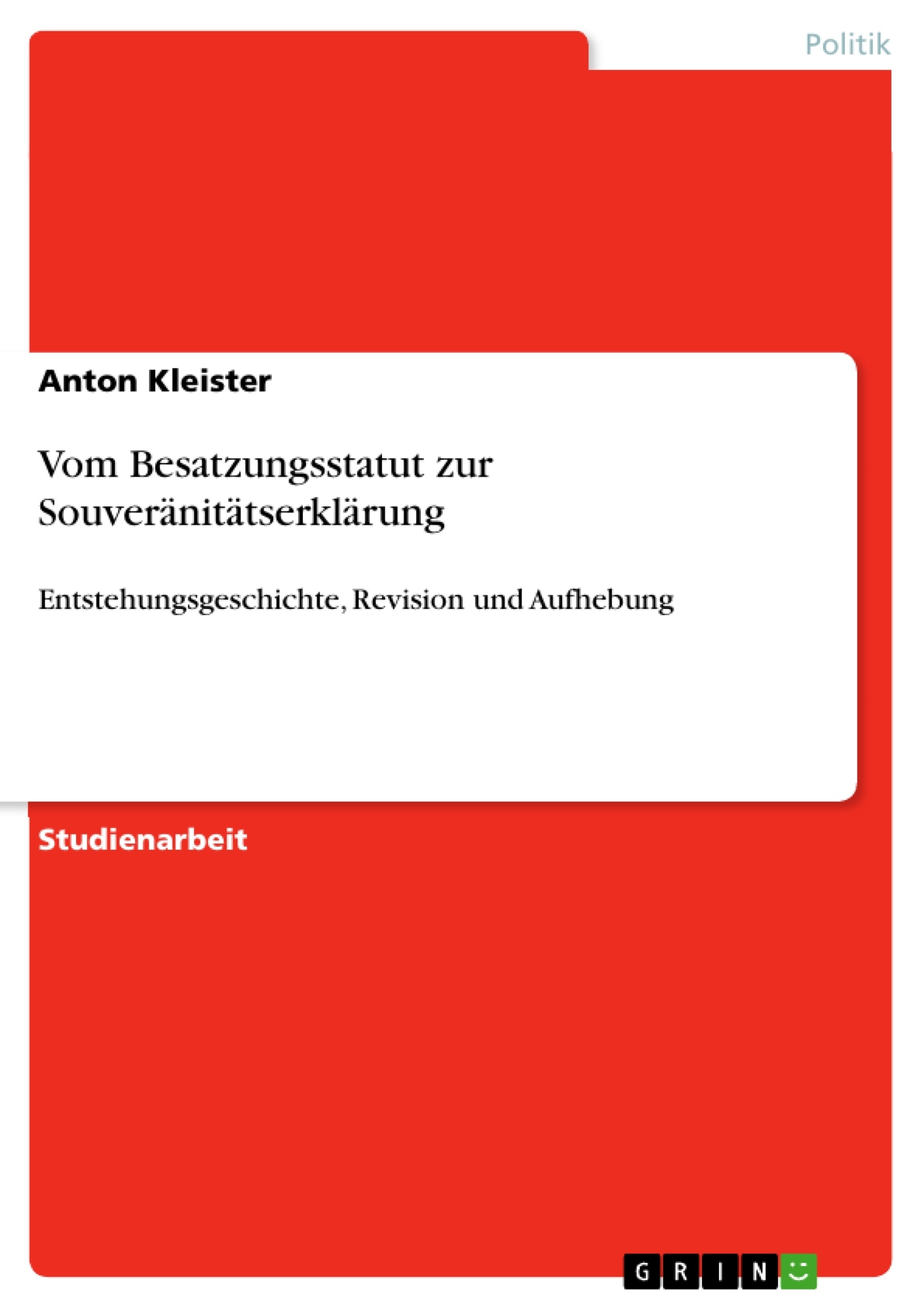Diese Arbeit behandelt die Entstehungsgeschichte des Besatzungsstatuts, dessen Revision, Aufhebung und die zu diesen Zwecken getroffenen Vereinbarungen und Verträge einschließlich deren Resultate und Folgen. Auf dieses Thema stieß ich, da ich zwecks meines Studiums von Baden-Württemberg nach Hessen zog. In Baden-Württemberg, speziell im Südwesten, läuft die ehemalige französische Besatzungszone in die ehemalige amerikanische über. Rastatt gehörte dem französischen Gebiet an, während die angrenzende Stadt, Karlsruhe, in der amerikanischen Zone lag. Kassel gehörte ebenfalls zum amerikanischen Besatzungsgebiet, Göttingen hingegen lag im britischen.
Ein interessanter Umstand, wie so nah beieinanderliegende Städte verschiedenen Verwaltungsmächten unterlagen. Im Allgemeinen ist die Auseinandersetzung mit dem Besatzungsstatut von Interesse, da es einen wichtigen Schritt zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Außerdem trug es sowohl zur Teilung als auch zur Wiedervereinigung Deutschlands bei. Es beschränkte mit seinem Inkrafttreten die deutsche Souveränität und hob mit seiner Auflösung diese Schranken wieder auf. Es war somit, zugleich Zäsur und Chance für das deutsche Volk. Aus diesen Gründen beschäftigt sich meine Arbeit mit dem Besatzungsstatut. Hierzu werden zunächst, der Begriff des Besatzungsstatuts, die Entstehung und die Gründe dafür, erklärt. Des Weiteren, bleiben die ersten Schritte zur Souveränität und die darauffolgende Ablösung des Besatzungsstatuts zu behandeln, bevor ein Fazit gezogen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Besatzungsstatut
- Schritte auf dem Weg zur Souveränität
- Pariser Außenministerkonferenzen 1949
- Londoner Außenministerkonferenz 1950
- Revision und Auflösung des Besatzungsstatuts
- Generalvertrag und die Frage nach der Wiederbewaffnung
- Souveränitätserklärung und NATO-Beitritt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehungsgeschichte des Besatzungsstatuts für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, seine Revision und letztendliche Aufhebung. Sie analysiert die damit verbundenen Vereinbarungen und Verträge sowie deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Übergang von der Besatzungszeit hin zur Souveränität Deutschlands.
- Entstehung und Rechtsnatur des Besatzungsstatuts
- Einschränkungen der deutschen Souveränität durch das Besatzungsstatut
- Schritte der Westalliierten zur Übergabe von Souveränität an Deutschland
- Die Rolle des Besatzungsstatuts in der deutschen Frage
- Auswirkungen des Besatzungsstatuts auf die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert den Forschungsstand zum Besatzungsstatut, wobei sowohl geschichtswissenschaftliche als auch rechtswissenschaftliche Perspektiven berücksichtigt werden. Der Autor beschreibt seinen persönlichen Bezug zum Thema, der durch den Kontrast zwischen den ehemaligen französischen und amerikanischen Besatzungszonen in Südwestdeutschland und dem amerikanischen Besatzungsgebiet in Kassel entsteht. Die Arbeit untersucht die Entstehung, Revision und Aufhebung des Besatzungsstatuts sowie die damit verbundenen Vereinbarungen und deren Folgen für Deutschland.
Das Besatzungsstatut: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Besatzungsstatuts und beleuchtet die Hintergründe seiner Entstehung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die "Deutsche Frage" – wie zukünftig deutsche Aggression verhindert und ein friedliches Zusammenleben in Europa sichergestellt werden kann – wird als zentrale Motivation für die Westalliierten dargestellt. Das Besatzungsstatut vom 10. April 1949, erlassen am 21. September 1949, schränkte die deutsche Souveränität deutlich ein, indem es den Alliierten wichtige Bereiche der Regierungsgewalt vorbehielt (Entwaffnung, Reparationen, Außenpolitik etc.). Gleichzeitig enthielt es aber auch die Zusage, die Selbstverwaltung Deutschlands schrittweise zu erweitern.
Schritte auf dem Weg zur Souveränität: Dieses Kapitel behandelt die Pariser Außenministerkonferenzen von 1949, die sich mit der Zukunft Deutschlands befassten. Die Differenzen zwischen den vier Siegermächten über die Gestaltung Deutschlands und die Rolle der Besatzungsmächte werden deutlich. Die Verhandlungen verdeutlichen die Schwierigkeiten, eine Einigung über die Zukunft Deutschlands zu erzielen, was letztlich zur Gründung zweier deutscher Staaten beitrug. Die Verhandlungsergebnisse zeigen die Spannungen und unterschiedlichen Interessen der Alliierten, insbesondere zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion.
Schlüsselwörter
Besatzungsstatut, Bundesrepublik Deutschland, Souveränität, Westalliierte, Deutsche Frage, Wiederbewaffnung, Teilung Deutschlands, Pariser Außenministerkonferenzen, Kalter Krieg, Selbstverwaltung.
FAQ: Entstehung und Aufhebung des Besatzungsstatuts für Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entstehung des Besatzungsstatuts für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, seine Revision und seine letztendliche Aufhebung. Sie analysiert die damit verbundenen Vereinbarungen und Verträge und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Übergang von der Besatzungszeit zur Souveränität Deutschlands.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Rechtsnatur des Besatzungsstatuts, die Einschränkungen der deutschen Souveränität durch das Statut, die Schritte der Westalliierten zur Übergabe der Souveränität, die Rolle des Statuts in der deutschen Frage und die Auswirkungen des Statuts auf die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Einleitung, Das Besatzungsstatut, Schritte auf dem Weg zur Souveränität (inkl. Pariser und Londoner Außenministerkonferenzen), Revision und Auflösung des Besatzungsstatuts (inkl. Generalvertrag und NATO-Beitritt), und Fazit.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung beschreibt den Forschungsstand zum Besatzungsstatut aus geschichtswissenschaftlicher und rechtswissenschaftlicher Perspektive. Der Autor erläutert seinen persönlichen Bezug zum Thema, basierend auf dem Kontrast zwischen den ehemaligen französischen und amerikanischen Besatzungszonen in Südwestdeutschland und dem amerikanischen Besatzungsgebiet in Kassel. Die Einleitung umreißt den Fokus der Arbeit auf Entstehung, Revision und Aufhebung des Statuts sowie die damit verbundenen Vereinbarungen und Folgen.
Was wird im Kapitel "Das Besatzungsstatut" behandelt?
Dieses Kapitel definiert das Besatzungsstatut und beleuchtet seine Entstehungsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Es thematisiert die "Deutsche Frage" als zentrale Motivation der Westalliierten und beschreibt die Einschränkungen der deutschen Souveränität durch das Statut (Entwaffnung, Reparationen, Außenpolitik etc.), sowie die Zusage zur schrittweisen Erweiterung der Selbstverwaltung.
Was wird im Kapitel "Schritte auf dem Weg zur Souveränität" behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die Pariser Außenministerkonferenzen von 1949 und deren Auseinandersetzung mit der Zukunft Deutschlands. Es zeigt die Differenzen zwischen den vier Siegermächten und die Schwierigkeiten, eine Einigung über die Zukunft Deutschlands zu erzielen, was zur Gründung zweier deutscher Staaten beitrug. Die unterschiedlichen Interessen und Spannungen zwischen den Alliierten, insbesondere zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion, werden deutlich dargestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Besatzungsstatut, Bundesrepublik Deutschland, Souveränität, Westalliierte, Deutsche Frage, Wiederbewaffnung, Teilung Deutschlands, Pariser Außenministerkonferenzen, Kalter Krieg, Selbstverwaltung.
- Quote paper
- Anton Kleister (Author), 2018, Vom Besatzungsstatut zur Souveränitätserklärung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/418919