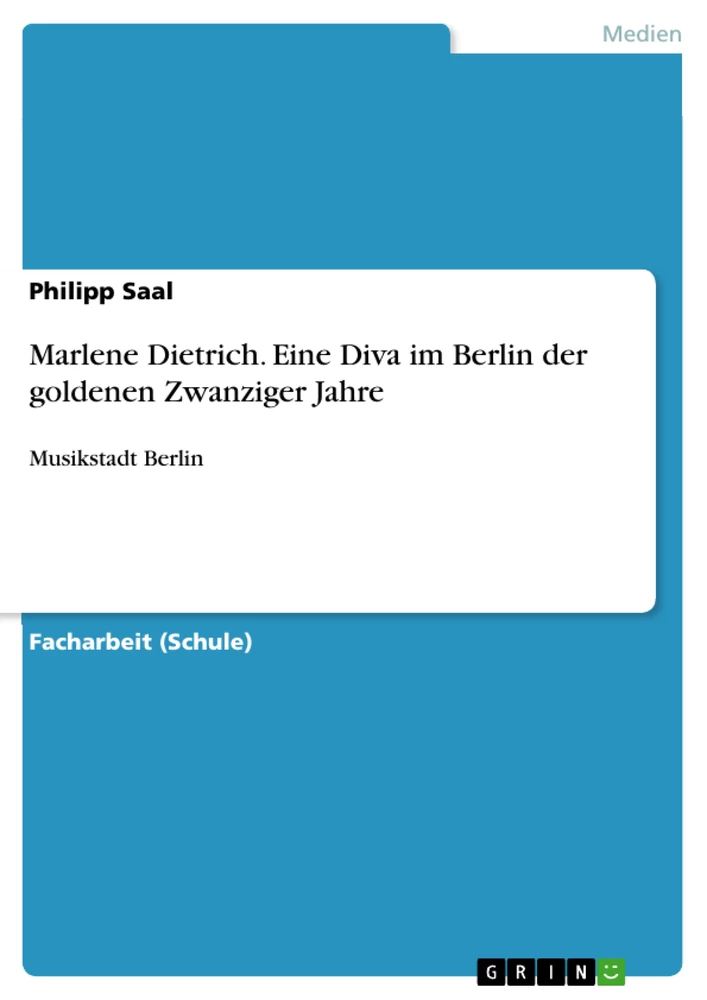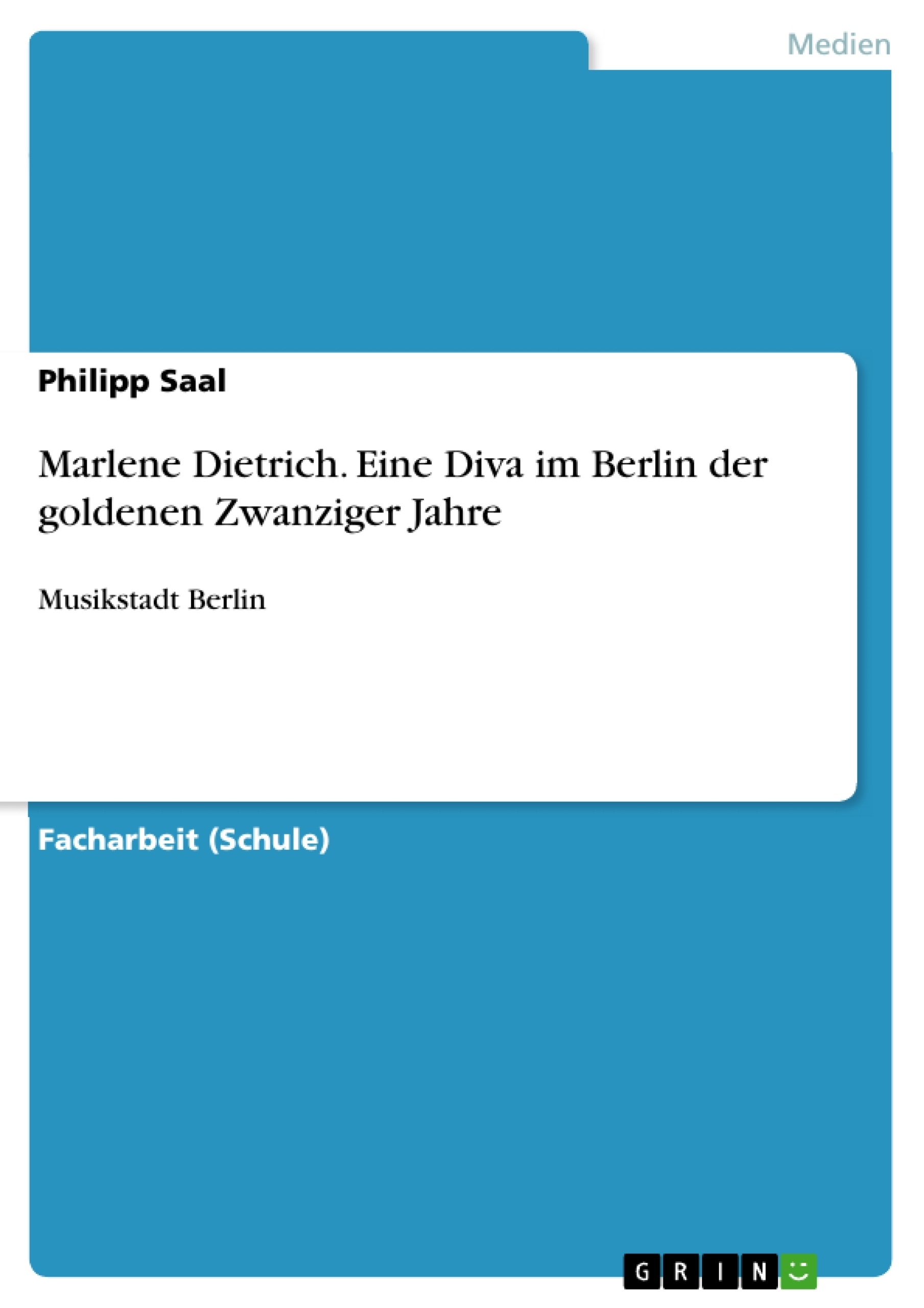„Liebling, die Beine sind nicht so schön - Ich weiß nur, was man mit ihnen macht.“ Dies ist eine der bekanntesten Aussagen der Berliner Künstlerin und des späteren Weltstars Marlene Dietrich. Sie galt ab den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts als das Sexsymbol schlechthin für die Männerwelt und hatte zugleich eine Vorbildfunktion für die Frauen der damaligen Zeit. Einen wichtigen Teil ihres Erfolges verdankte sie ihrem Aussehen, aber auch ihrem beispiellosen Charakter. Marlene verkörperte eine junge, äußerst selbstbewusste Frau, die mit ihrem Körper umzugehen wusste und diesen entsprechend nutzte, um den Männern den Kopf zu verdrehen. Viele Frauen beeindruckte sie dagegen mit ihrer selbstbewussten Art, mit der sie viele Tabus der damaligen Zeit brach. Beispielsweise kam dies zum Ausdruck, als sie, ganz im Widerspruch zu den damaligen Konventionen, als erste Frau während eines öffentlichen Auftritts eine andere Dame auf den Mund küsste. Sie „wurde so zu einem Idol der Homosexuellen“ (Arnbom, 2010), was sie mit dem Lied „Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin“ untermauerte. Ihr gesamtes Oeuvre spiegelt ihr Wesen und ihre Einstellung zu den Gepflogenheiten dieser Zeit wider. In dem Film „Der Blaue Engel“, mit welchem ihr 1930 der Durchbruch zur Weltkarriere gelang, spielt sie eine hinreißende Tänzerin. In diesem Film erlebt man die frühe Marlene Dietrich par excellence in ihrer typischen „Mischung aus Frivolität und Biederkeit.“ (Arnbom, 2010) Aufgrund der Starbesetzung mit Emil Jannings in der Hauptrolle und der erstmals durch den Tonfilm möglichen musikalischen Untermalung durch die junge, attraktive Marlene wurde der Film zu einem riesigen Erfolg.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Nimm dich in Acht vor blonden Frauen“ - Die Berliner Jahre zwischen Varieté und Film
- Kultureller Wandel im Berlin der „Goldenen Zwanziger“
- Besonderheiten Marlene Dietrichs
- Einstieg in das Showgeschäft
- Der Blaue Engel
- Handlung
- Bedeutung des Films
- „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ - Mit Sternberg in Hollywood
- Marlenes Aufstieg zum amerikanischen Star
- Anfangsschwierigkeiten in den USA
- Politische Distanzierung von der Heimat
- „The Boys in the Backroom“ - Truppenbetreuung im zweiten Weltkrieg
- Engagement gegen das Nazi-Regime von Amerika aus
- Engagement gegen das Nazi-Regime an der Front
- Auswirkungen des Einsatzes für Amerika
- „Sag mir, wo die Blumen sind“ - Zweite Karriere als Diseuse nach dem Krieg
- Weg zur Diseuse
- Erfolgsgeheimnis der Dietrich
- „Kleider langweilen mich“ - Die (Mode-) Marke Marlene Dietrich
- Die beiden Diven Marlene Dietrich und Zarah Leander - Ein kritischer Vergleich
- Kindheit und Jugend
- Karriere
- Truppenbetreuung im zweiten Weltkrieg
- Rückkehr in der Nachkriegszeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Leben und die Karriere von Marlene Dietrich, insbesondere im Kontext der „Goldenen Zwanziger“ in Berlin und ihrem späteren Aufstieg zum internationalen Star. Der Vergleich mit Zarah Leander soll eine differenziertere Sicht auf beide Persönlichkeiten ermöglichen und ihre prägende Wirkung auf die damalige Zeit beleuchten.
- Marlene Dietrichs Weg zum Erfolg im Showgeschäft
- Der kulturelle Wandel Berlins in den 1920er Jahren
- Dietrichs Image und Einfluss auf die Gesellschaft
- Der Vergleich zwischen Marlene Dietrich und Zarah Leander
- Dietrichs politische Haltung und Engagement im Zweiten Weltkrieg
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Marlene Dietrich als außergewöhnliche Künstlerin und Sexsymbol der 1920er Jahre vor und beschreibt ihren Einfluss auf Frauen und Männer. Sie hebt die Bedeutung von Dietrichs Selbstbewusstsein und ihren Bruch mit gesellschaftlichen Konventionen hervor, unterstützt durch Beispiele wie ihren öffentlichen Kuss mit einer anderen Frau. Der Erfolg des Films „Der Blaue Engel“ wird als Ausgangspunkt für ihre Weltkarriere dargestellt, und die Arbeit kündigt einen Vergleich mit Zarah Leander an.
„Nimm dich in Acht vor blonden Frauen“ - Die Berliner Jahre zwischen Varieté und Film: Dieses Kapitel beschreibt den kulturellen Wandel Berlins in den „Goldenen Zwanzigern“, gekennzeichnet durch einen Aufbruch nach dem Ersten Weltkrieg und eine Lockerung traditioneller Moralvorstellungen. Es schildert Marlene Dietrichs Wunsch nach einer Karriere als Tänzerin im aufstrebenden Kabarett- und Revue-Bereich, ihren Konflikt mit ihrem konservativen Elternhaus und die Voraussetzungen für den Erfolg einer Frau in diesem Milieu, die Dietrich alle erfüllte.
Der Blaue Engel: Der Fokus liegt auf dem Film „Der Blaue Engel“ und seiner Bedeutung für Marlene Dietrichs Karriere. Die Darstellung von Dietrich als hinreißende Tänzerin, die Kombination aus Starbesetzung (Emil Jannings) und der innovativen Verwendung von Tonfilm werden als Schlüsselfaktoren für den enormen Erfolg des Films hervorgehoben.
„Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ - Mit Sternberg in Hollywood: Dieses Kapitel behandelt Dietrichs Aufstieg zum amerikanischen Star, ihre anfänglichen Schwierigkeiten in den USA und ihre politische Distanzierung von ihrer Heimat. Es beleuchtet die Herausforderungen und den Erfolg ihrer Karriere in Hollywood.
„The Boys in the Backroom“ - Truppenbetreuung im zweiten Weltkrieg: Der Abschnitt konzentriert sich auf Marlene Dietrichs Engagement gegen das Naziregime, sowohl von Amerika aus als auch an der Front. Die Auswirkungen dieses Engagements auf ihr Leben und ihre Karriere werden analysiert.
„Sag mir, wo die Blumen sind“ - Zweite Karriere als Diseuse nach dem Krieg: Hier wird Dietrichs zweite Karriere als Diseuse nach dem Krieg thematisiert. Der Weg zu dieser neuen Karriere und ihr anhaltender Erfolg werden erklärt und analysiert.
„Kleider langweilen mich“ - Die (Mode-) Marke Marlene Dietrich: Das Kapitel befasst sich mit Marlene Dietrichs Einfluss auf die Mode und ihrem Image als Modeikone.
Die beiden Diven Marlene Dietrich und Zarah Leander - Ein kritischer Vergleich: Dieser Abschnitt stellt einen vergleichenden Überblick über das Leben und die Karriere von Marlene Dietrich und Zarah Leander dar, in Bezug auf Kindheit, Karriere, Kriegseinsatz und Nachkriegszeit. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden beleuchtet, um ein differenziertes Bild beider Frauen zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Marlene Dietrich, Zarah Leander, Goldene Zwanziger, Berlin, Hollywood, Film, Showgeschäft, Kabarett, Revue, Sexsymbol, Selbstbewusstsein, politisches Engagement, Zweiter Weltkrieg, Diseuse, Modeikone.
Häufig gestellte Fragen zu: Marlene Dietrich und Zarah Leander - Ein Vergleich
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht das Leben und die Karriere von Marlene Dietrich, insbesondere ihre Berliner Jahre in den „Goldenen Zwanzigern“ und ihren Aufstieg zum internationalen Star. Ein Vergleich mit Zarah Leander ermöglicht eine differenziertere Sicht auf beide Persönlichkeiten und ihre Wirkung auf die damalige Zeit. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Marlene Dietrichs Weg zum Erfolg im Showgeschäft, den kulturellen Wandel Berlins in den 1920er Jahren, Dietrichs Image und Einfluss auf die Gesellschaft, einen Vergleich zwischen Marlene Dietrich und Zarah Leander, Dietrichs politische Haltung und Engagement im Zweiten Weltkrieg, sowie ihre Karriere als Diseuse nach dem Krieg und ihren Einfluss auf die Mode.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, „Nimm dich in Acht vor blonden Frauen“ (Die Berliner Jahre), Der Blaue Engel, „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ (Hollywood), „The Boys in the Backroom“ (Truppenbetreuung im Zweiten Weltkrieg), „Sag mir, wo die Blumen sind“ (Zweite Karriere als Diseuse), „Kleider langweilen mich“ (Die Mode-Marke Marlene Dietrich), und „Die beiden Diven Marlene Dietrich und Zarah Leander - Ein kritischer Vergleich“.
Wie wird Marlene Dietrich in der Einleitung dargestellt?
Die Einleitung präsentiert Marlene Dietrich als außergewöhnliche Künstlerin und Sexsymbol der 1920er Jahre, betont ihr Selbstbewusstsein und ihren Bruch mit gesellschaftlichen Konventionen, und benennt den Erfolg von „Der Blaue Engel“ als Ausgangspunkt ihrer Weltkarriere. Ein Vergleich mit Zarah Leander wird angekündigt.
Was wird im Kapitel über die Berliner Jahre beschrieben?
Das Kapitel beschreibt den kulturellen Wandel Berlins in den „Goldenen Zwanzigern“, Marlene Dietrichs Wunsch nach einer Karriere als Tänzerin, ihren Konflikt mit ihrem Elternhaus und die Voraussetzungen für den Erfolg einer Frau in diesem Milieu.
Welche Bedeutung hat „Der Blaue Engel“ für Marlene Dietrichs Karriere?
Das Kapitel zu „Der Blaue Engel“ hebt die Bedeutung des Films für Dietrichs Karriere hervor, betont die Darstellung Dietrichs als Tänzerin, die Starbesetzung und die innovative Verwendung von Tonfilm als Schlüsselfaktoren für den Erfolg.
Wie wird Dietrichs Zeit in Hollywood dargestellt?
Das Kapitel über Hollywood behandelt Dietrichs Aufstieg zum amerikanischen Star, ihre anfänglichen Schwierigkeiten in den USA und ihre politische Distanzierung von Deutschland. Es beleuchtet die Herausforderungen und den Erfolg ihrer Karriere in Hollywood.
Wie wird Dietrichs Engagement im Zweiten Weltkrieg beschrieben?
Der Abschnitt über den Zweiten Weltkrieg konzentriert sich auf Dietrichs Engagement gegen das Naziregime, sowohl von Amerika aus als auch an der Front, und analysiert die Auswirkungen dieses Engagements auf ihr Leben und ihre Karriere.
Was wird in dem Kapitel über ihre zweite Karriere als Diseuse behandelt?
Dieses Kapitel thematisiert Dietrichs zweite Karriere als Diseuse nach dem Krieg, erklärt ihren Weg dorthin und analysiert ihren anhaltenden Erfolg.
Welche Rolle spielt Mode in der Seminararbeit?
Ein Kapitel widmet sich Marlene Dietrichs Einfluss auf die Mode und ihrem Image als Modeikone.
Wie wird der Vergleich zwischen Marlene Dietrich und Zarah Leander durchgeführt?
Der Vergleich stellt einen Überblick über das Leben und die Karriere beider Frauen dar, in Bezug auf Kindheit, Karriere, Kriegseinsatz und Nachkriegszeit. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Marlene Dietrich, Zarah Leander, Goldene Zwanziger, Berlin, Hollywood, Film, Showgeschäft, Kabarett, Revue, Sexsymbol, Selbstbewusstsein, politisches Engagement, Zweiter Weltkrieg, Diseuse, Modeikone.
- Quote paper
- Philipp Saal (Author), 2016, Marlene Dietrich. Eine Diva im Berlin der goldenen Zwanziger Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/418860