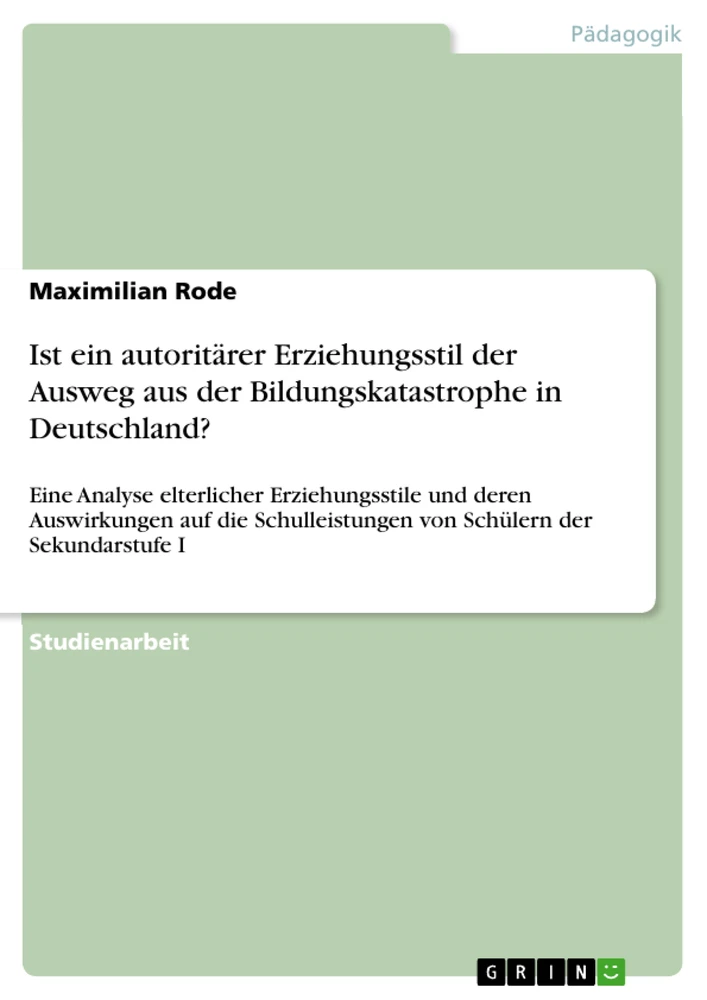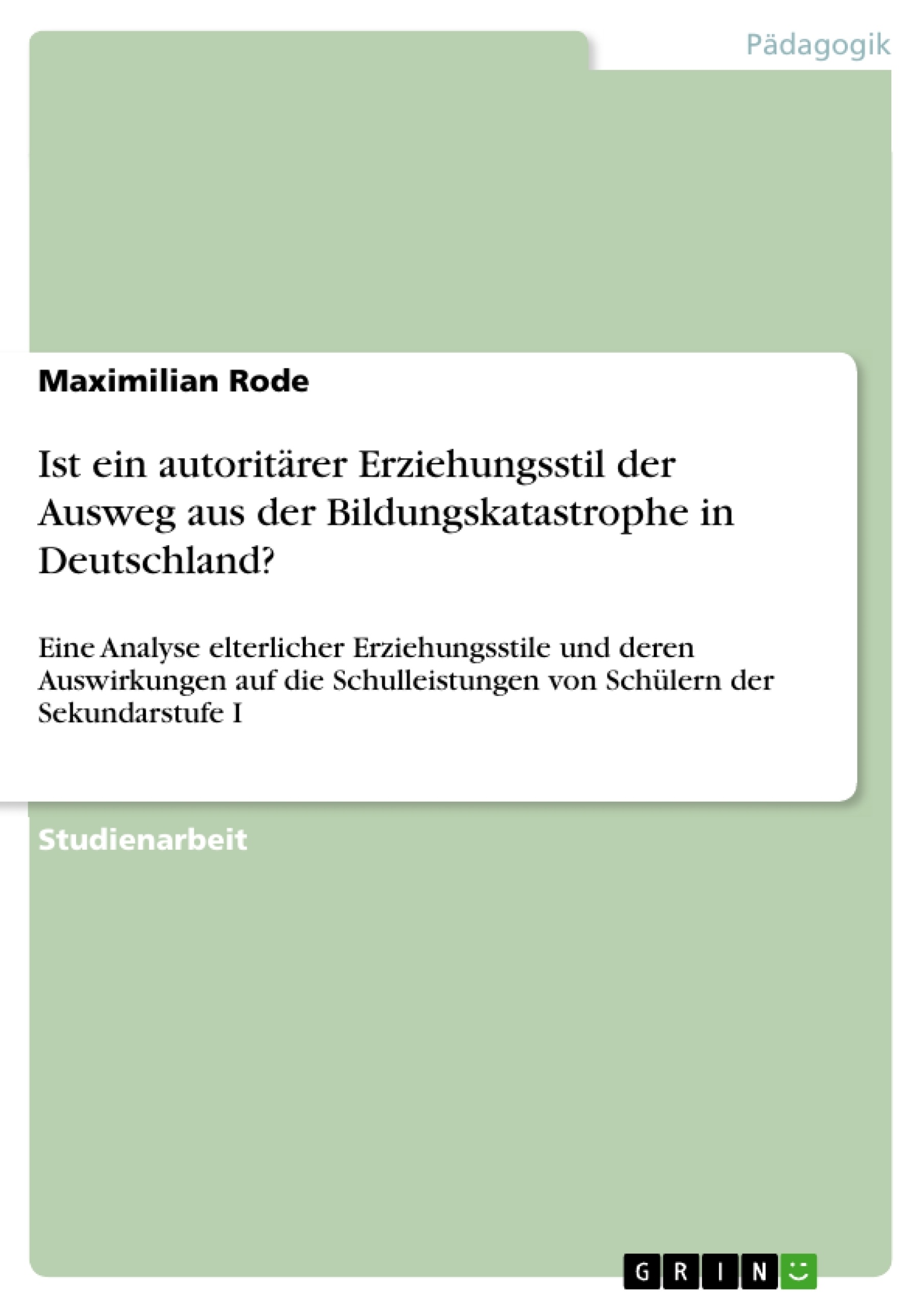Ziel dieser Arbeit soll es sein, vor dem Hintergrund der "Zweiten Bildungskatastrophe", welche im Jahre 2000 von der PISA-Studie konstatiert wurde, die Frage zu klären, ob ein autoritärer elterlicher Erziehungsstil sich positiv auf die Schulleistungen von Jugendlichen in der Sekundarstufe I auswirkt und somit das deutsche Bildungsergebnis im internationalen Vergleich verbessern würde. Dabei wird eine Gegenüberstellung der beiden wesentlichen Erziehungsstile "autoritativ" und "autoritär" vorgenommen.
Zuvor soll ein kurzer Überblick hinsichtlich der Positionierung Deutschlands im internationalen Bildungswettbewerb gegeben werden um die drastische Bezeichnung einer Katastrophe zu begründen. Anschließend werden Ansätze zur Erziehungsstilforschung in Deutschland geliefert, welche Aufschluss darüber geben sollen, welches Erziehungsverhalten in den hiesigen Regionen vorherrscht und für eine Analyse geeignet wäre.
Nach der Differenzierung der Erziehungsstile werden anhand von empirischen Studien Hypothesen aufgestellt und systematisch auf ihre Gültigkeit überprüft. Zur Beurteilung der Schulleistung werden die drei Indikatoren Lernmotivation, Schulabsentismus und Schulnoten berücksichtigt. Dies soll schlussendlich zu einer Beantwortung der eingehend gestellten Frage führen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die „Zweite Bildungskatastrophe“
- 3. Ansätze der Erziehungsstilforschung in Deutschland
- 4. Erziehungsstile
- 4.1 Autoritäre Erziehung
- 4.2 Autoritative Erziehung
- 5. Empirische Befunde
- 5.1 Erziehung und Lernmotivation
- 5.2 Erziehung und Schulabsentismus
- 6. Erziehung und Schulnoten
- 7. Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss autoritärer Erziehungsstile auf die Schulleistungen von Jugendlichen in der Sekundarstufe I vor dem Hintergrund der „Zweiten Bildungskatastrophe“, die durch die PISA-Studie 2000 aufgezeigt wurde. Es wird analysiert, ob ein autoritärer Erziehungsstil die Schulleistungen im internationalen Vergleich verbessern könnte. Die Arbeit vergleicht dazu autoritative und autoritäre Erziehungsstile nach Baumrind (1991).
- Die „Zweite Bildungskatastrophe“ und Deutschlands Position im internationalen Bildungswettbewerb.
- Ansätze der Erziehungsstilforschung in Deutschland und die Verbreitung verschiedener Erziehungsstile.
- Der Vergleich autoritärer und autoritativer Erziehungsstile nach Baumrind.
- Der Einfluss von Erziehungsstilen auf Lernmotivation, Schulabsentismus und Schulnoten.
- Die Bedeutung elterlichen Erziehungsverhaltens für den Schulerfolg.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss des autoritären Erziehungsstils auf die Schulleistung von Jugendlichen in der Sekundarstufe I. Sie betont die Bedeutung der elterlichen Erziehung für den Schulerfolg, diskutiert die begrenzte Berücksichtigung des Erziehungsverhaltens in deutschen Bildungsstudien im Vergleich zu ausländischen Studien und begründet die Relevanz der Untersuchung vor dem Hintergrund der „Zweiten Bildungskatastrophe“. Der Fokus liegt auf der Klärung, ob ein autoritärer Erziehungsstil zu einer Verbesserung der deutschen Schulleistungen im internationalen Vergleich beitragen könnte. Die Methodik der Arbeit, einschließlich der Gegenüberstellung autoritativer und autoritärer Erziehungsstile und der Verwendung von Lernmotivation, Schulabsentismus und Schulnoten als Indikatoren für die Schulleistung, wird ebenfalls skizziert.
2. Die „Zweite Bildungskatastrophe“: Dieses Kapitel erläutert die PISA-Studie und ihre Ergebnisse aus dem Jahr 2000, die zur Aussage der „Zweiten Bildungskatastrophe“ führten. Die Ergebnisse zeigen die unterdurchschnittlichen Leistungen deutscher Schüler im Vergleich zum OECD-Durchschnitt in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Der Kontext informeller Bildung in der Familie wird als wichtiger Faktor für den Schulerfolg hervorgehoben, was die These unterstreicht, dass die Qualität des elterlichen Erziehungsverhaltens einen entscheidenden Einfluss hat. Der Abschnitt betont, dass die „Katastrophe“ nicht als Endpunkt, sondern als Wendepunkt für die deutsche Bildungsreform gesehen werden sollte.
3. Ansätze der Erziehungsstilforschung in Deutschland: Dieser Abschnitt beleuchtet die Veränderungen in den Erziehungszielen und ihrer Umsetzung in Deutschland. Er beschreibt den Wandel hin zu einem autoritativen Erziehungsstil, charakterisiert durch Nähe, positive Beziehungen und die Förderung der Autonomie der Kinder, insbesondere in gesellschaftlichen Gruppen mit höherem sozialen Status. Im Gegensatz dazu wird ein autoritärer Erziehungsstil, geprägt durch Distanz und klare Hierarchien, im traditionsverwurzelten Milieu beschrieben. Der Abschnitt rechtfertigt die Fokussierung auf autoritäre und autoritative Erziehungsstile aufgrund des Mangels an nationalen Studien zu anderen Erziehungsstilen.
4. Erziehungsstile: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Erziehungsstil“ als Muster elterlicher Verhaltensweisen und Einstellungen. Es stellt Baumrinds Klassifizierung von Erziehungsstilen (autoritativ, autoritär, permissiv, zurückweisend-vernachlässigend) vor und konzentriert sich auf die für die weitere Untersuchung relevanten autoritären und autoritativen Stile. Es betont die Bedeutung des inkorporierten kulturellen Kapitals als Einflussfaktor für den Erziehungsstil.
4.1 Autoritäre Erziehung: Dieser Abschnitt beschreibt den autoritären Erziehungsstil nach Baumrind, charakterisiert durch eine streng strukturierte Umgebung, klare Regeln und die Durchsetzung des elterlichen Willens mittels Zwang, Drohungen und Bestrafungen. Er beleuchtet die Auswirkungen auf das Kind, einschließlich Angstzustände und den möglichen Verlust sozialer und emotionaler Bindung. Der Zusammenhang zwischen elterlichen Erfahrungen und der Anwendung autoritärer Erziehungsmethoden wird ebenfalls erörtert, ebenso wie die Betonung von Statusorientierung und konventionellen Werten.
Schlüsselwörter
Zweite Bildungskatastrophe, PISA-Studie, Erziehungsstile, autoritär, autoritativ, Lernmotivation, Schulabsentismus, Schulnoten, elterliches Erziehungsverhalten, Bildungserfolg, Deutschland, internationaler Vergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss autoritärer Erziehungsstile auf die Schulleistung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss autoritärer Erziehungsstile auf die Schulleistungen von Jugendlichen in der Sekundarstufe I in Deutschland, insbesondere im Kontext der „Zweiten Bildungskatastrophe“, die durch die PISA-Studie 2000 aufgezeigt wurde. Es wird analysiert, ob ein autoritärer Erziehungsstil die Schulleistungen im internationalen Vergleich verbessern könnte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die „Zweite Bildungskatastrophe“, verschiedene Ansätze der Erziehungsstilforschung in Deutschland, einen Vergleich autoritärer und autoritativer Erziehungsstile nach Baumrind (1991), den Einfluss von Erziehungsstilen auf Lernmotivation, Schulabsentismus und Schulnoten sowie die Bedeutung des elterlichen Erziehungsverhaltens für den Schulerfolg.
Was versteht man unter der „Zweiten Bildungskatastrophe“?
Die „Zweite Bildungskatastrophe“ bezieht sich auf die Ergebnisse der PISA-Studie 2000, die die unterdurchschnittlichen Leistungen deutscher Schüler im internationalen Vergleich in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften aufzeigte. Die Studie hob die Bedeutung informeller Bildung in der Familie hervor.
Welche Erziehungsstile werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht vor allem autoritäre und autoritative Erziehungsstile nach Baumrind. Autoritär ist geprägt von Strenge, klaren Regeln und Durchsetzung des elterlichen Willens; autoritativ durch Nähe, positive Beziehungen und Förderung der Autonomie des Kindes.
Wie werden die Schulleistungen gemessen?
Die Schulleistungen werden anhand von Lernmotivation, Schulabsentismus und Schulnoten als Indikatoren gemessen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit skizziert die Methodik, analysiert den Einfluss des autoritären Erziehungsstils und diskutiert die Ergebnisse im Kontext der deutschen Bildungslandschaft und des internationalen Vergleichs. Die detaillierten Schlussfolgerungen sind im Volltext der Arbeit zu finden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die „Zweite Bildungskatastrophe“, Ansätze der Erziehungsstilforschung in Deutschland, Erziehungsstile (inkl. Unterkapitel zu autoritärer und autoritativer Erziehung), Empirische Befunde (Erziehung und Lernmotivation, Erziehung und Schulabsentismus), Erziehung und Schulnoten, Diskussion und Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zweite Bildungskatastrophe, PISA-Studie, Erziehungsstile, autoritär, autoritativ, Lernmotivation, Schulabsentismus, Schulnoten, elterliches Erziehungsverhalten, Bildungserfolg, Deutschland, internationaler Vergleich.
- Quote paper
- Maximilian Rode (Author), 2017, Ist ein autoritärer Erziehungsstil der Ausweg aus der Bildungskatastrophe in Deutschland?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/416917