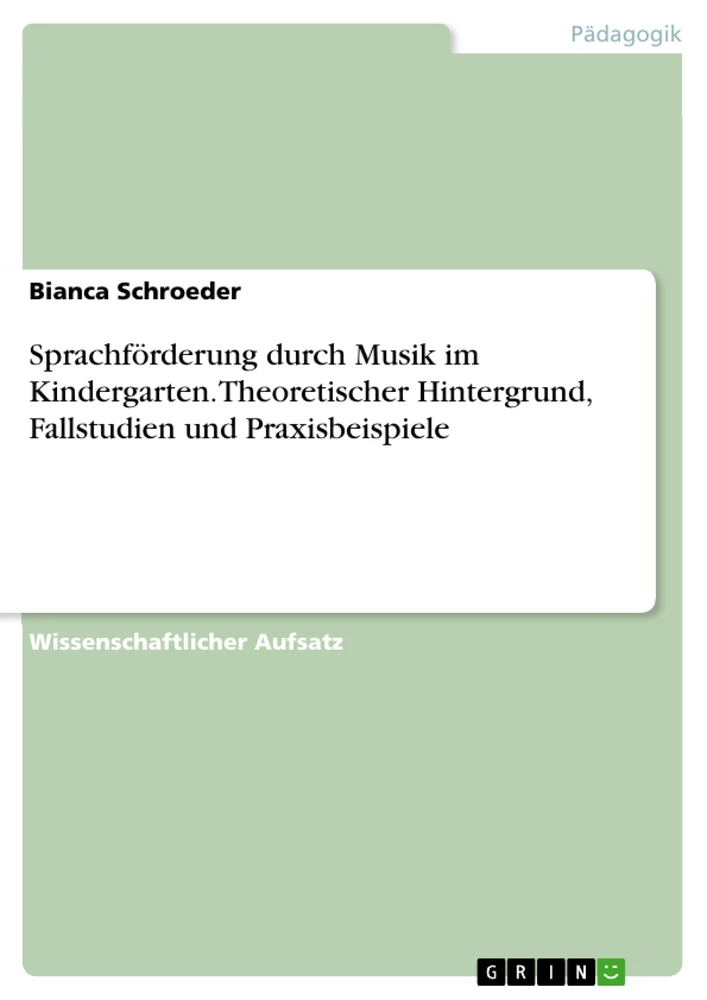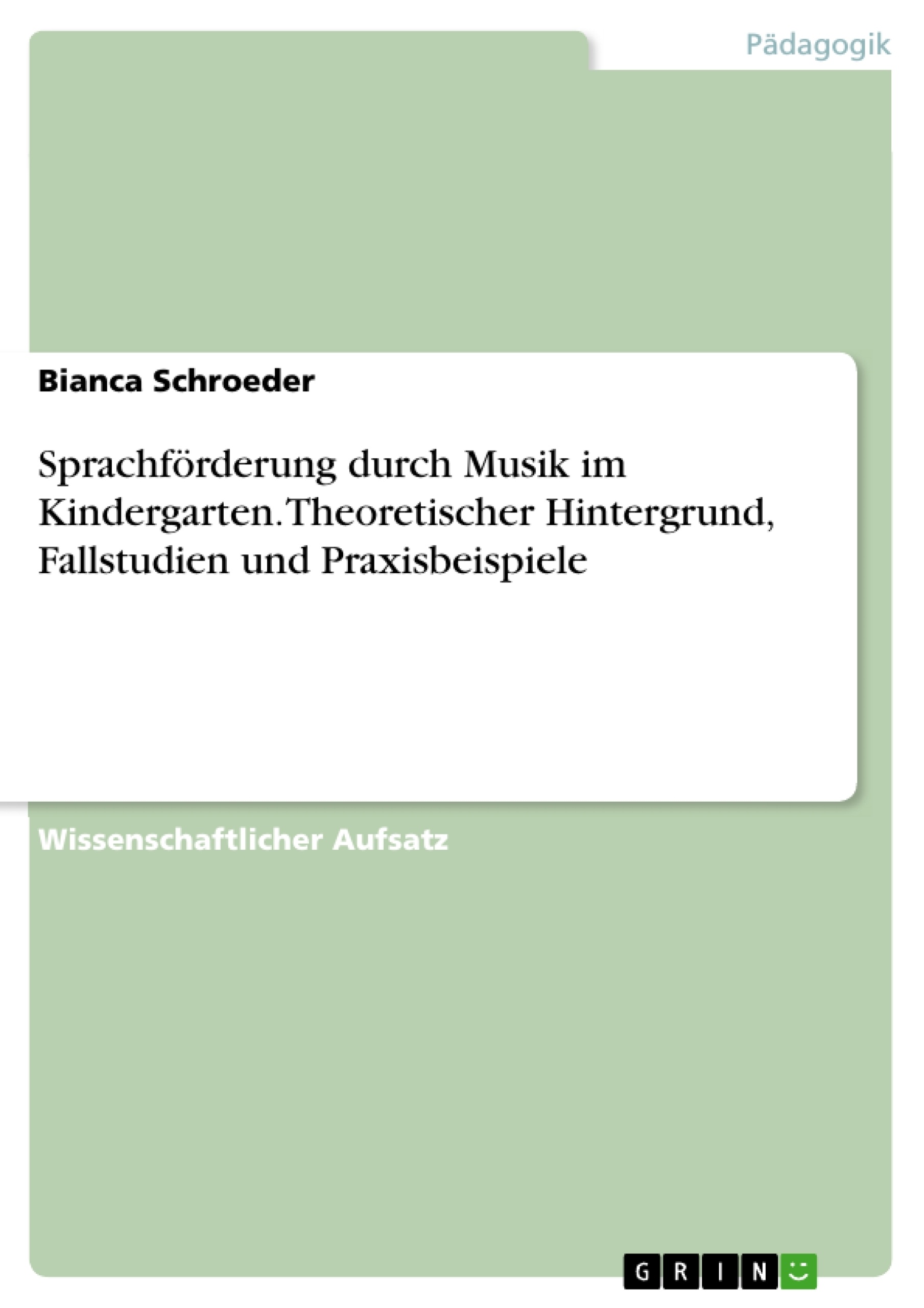Die Muttersprache zu lernen, ist für die meisten Menschen kinderleicht. Und doch gibt es Kinder, für die es sehr schwierig ist, Sprache zu lernen. Dieses hat vielfältige Hintergründe, die ebenso vielseitig und multifaktoriell sind, wie es Kinder gibt. Ziel dieser Arbeit ist es nicht, all die Gründe zu erforschen, die den kindlichen Spracherwerb blockieren, sondern Lösungen zu finden, um Kinder zu befähigen, sich mit Sprache auseinanderzusetzen und die bislang nicht gegangenen Schritte im Ablauf des Spracherwerbs nachzuholen und weiterzugehen.
Dabei geht es um die Sprachförderung von Kindern, die Probleme im Spracherwerb ihrer eigenen Muttersprache haben. Doch zeigen meine Beobachtungen, dass sich die musikalische Förderung als ebenso wirksam im Zweitspracherwerb zeigt. Nach einem Überblick der aktuellen Forschungslage gebe ich einen Einblick in meine Arbeit in einem Projekt zur Sprachförderung mit Kindergartenkindern. Konkrete Beispiele mit musikalischen Anregungen runden die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der kindliche Spracherwerb - Meilensteine und Stolpersteine
- 1.1. Meilensteine
- 1.2. Stolpersteine
- 2. Sprache und Musik - Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- 2.1. Die suprasegmentalen Elemente von Sprache
- 2.2. Phonetisch-phonologische Ebene
- 2.3. Semantisch-lexikalische und morphologisch-syntaktische Ebene
- 2.4. Pragmatisch- kommunikative Ebene
- 3. Die aktuelle Forschungslandschaft
- 4. Nur wer etwas sagt, kann auch gehört werden – Vorüberlegungen
- 5. Methodik der Untersuchung und Rahmenbedingungen: Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
- 5.1. Therapeutischer Ansatz
- 5.2. Sprachbeobachtungsbogen
- 5.3. Inhalte der Stunden
- 5.4. Eine Beispielstunde
- 6. Auswertung
- 6.1. Einzelauswertungen
- 6.2. Gesamtauswertung
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, Lösungsansätze für die Förderung der Sprachentwicklung von Kindern zu finden, die Schwierigkeiten im Spracherwerb ihrer Muttersprache haben. Der Fokus liegt dabei auf der Verwendung von Musik als Werkzeug zur Sprachförderung.
- Meilensteine und Stolpersteine im kindlichen Spracherwerb
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sprache und Musik
- Musiktherapeutische Ansätze zur Sprachförderung
- Methodische Vorgehensweise und Evaluation der Ergebnisse
- Praxisbeispiele für die Integration von Musik in die Sprachförderung im Kindergarten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Sprachförderung mit Musik im Kindergarten vor und erläutert die Relevanz des Themas.
Kapitel 1 befasst sich mit dem kindlichen Spracherwerb, indem es wichtige Meilensteine und potenzielle Stolpersteine beschreibt. Kapitel 2 analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sprache und Musik, wobei die suprasegmentalen Elemente von Sprache und die phonetisch-phonologische, semantisch-lexikalische, morphologisch-syntaktische sowie pragmatisch-kommunikative Ebene betrachtet werden.
Kapitel 3 beleuchtet die aktuelle Forschungslandschaft im Bereich der Sprachförderung mit Musik.
Kapitel 4 stellt Überlegungen zu den Vorzügen von Musik als Werkzeug für die Sprachentwicklung von Kindern an.
Kapitel 5 erläutert die Methodik der Untersuchung, die Rahmenbedingungen und die Inhalte der musiktherapeutischen Interventionen.
Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Auswertung der durchgeführten Sprachbeobachtungen.
Schlüsselwörter
Sprachförderung, Musiktherapie, Kindergarten, Spracherwerb, Meilensteine, Stolpersteine, Sprachentwicklung, Kinder, Musik, Intervention, Methodik, Evaluation, Praxisbeispiele.
- Arbeit zitieren
- Bianca Schroeder (Autor:in), 2016, Sprachförderung durch Musik im Kindergarten. Theoretischer Hintergrund, Fallstudien und Praxisbeispiele, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/416077