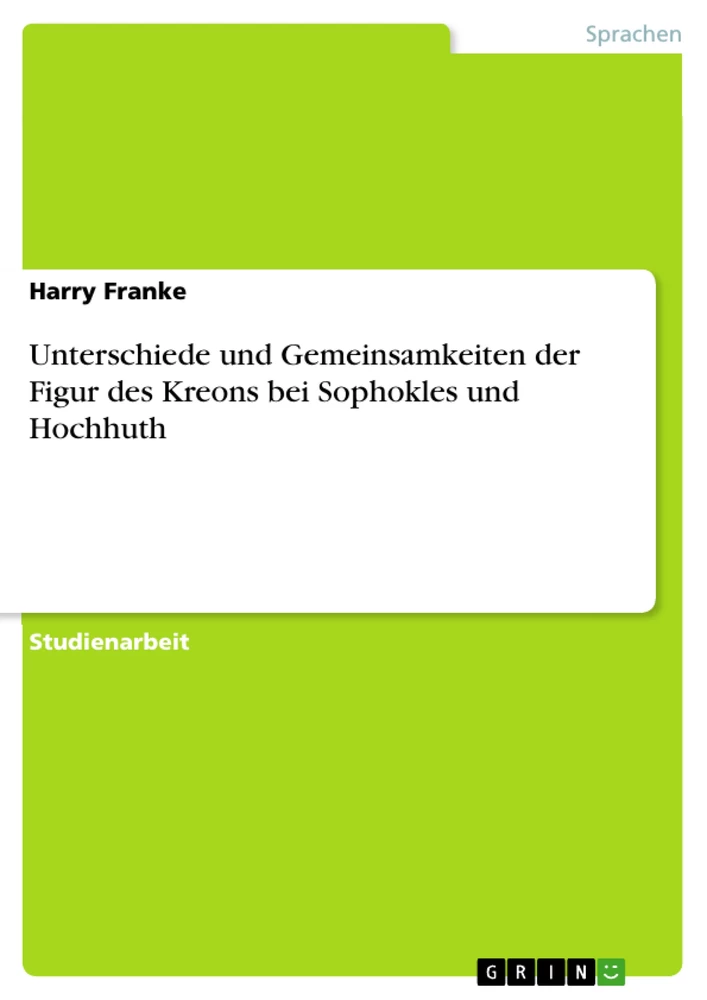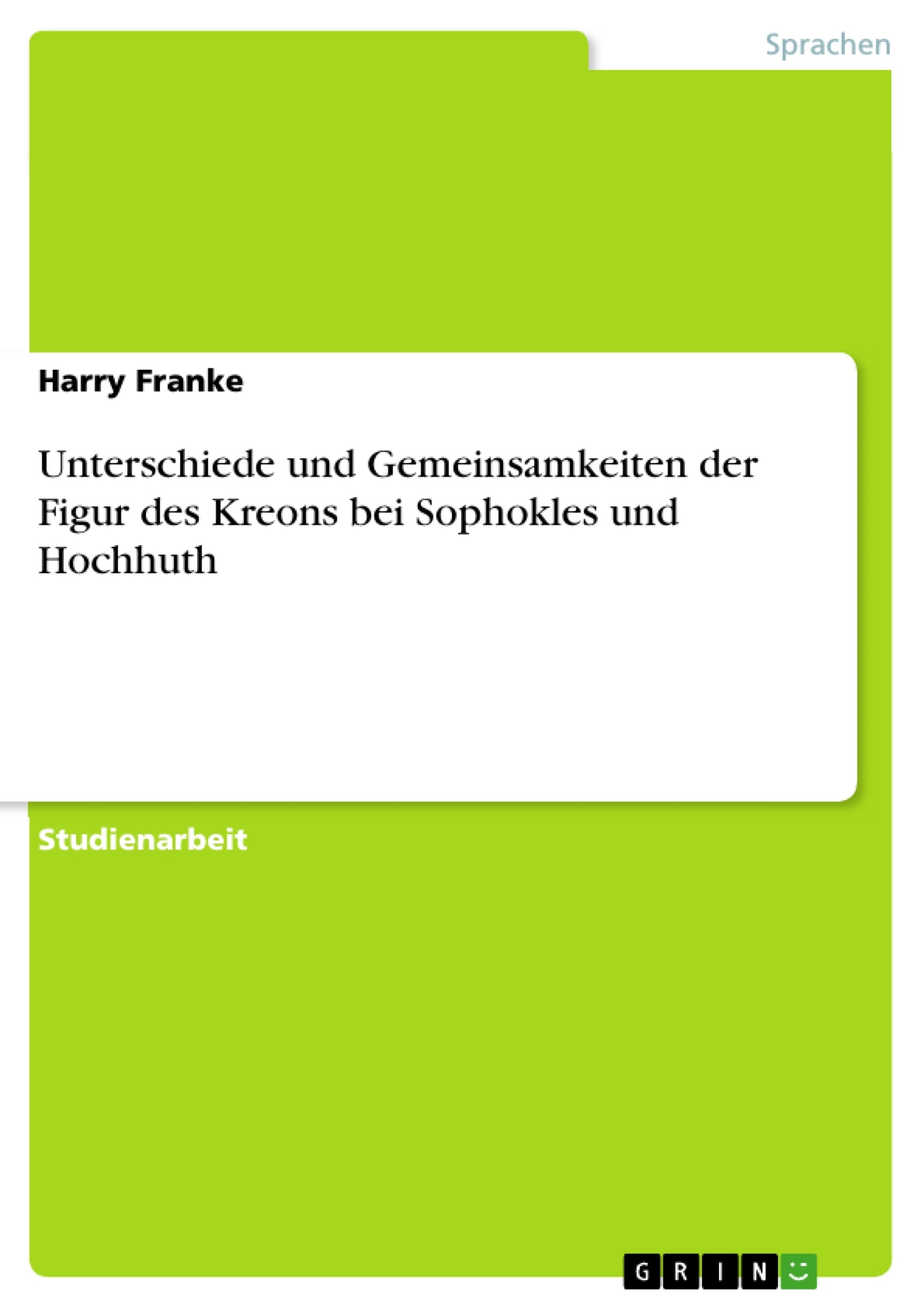In der vorliegenden Arbeit werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Kreon-Figuren aus der „Antigone“ des Sophokles und Rolf Hochhuths Novelle „Die Berliner Antigone“ herausgearbeitet. Zu diesem Zweck werden im ersten Abschnitt Kreons Eigenschaften aufgezeigt. Um den Vergleich mit den aufgeteilten Kreon-Figuren bei Hochhuth zugänglicher zu gestalten, wird diese Analyse in besonderen Unterpunkten erfolgen, die jeweils einem Teil-Kreon zugeschrieben werden können. Daran schließt sich die Auseinandersetzung mit den Teil-Kreon-Charakteren aus der Novelle an. In diesem Zusammenhang soll untersucht werden, ob, entgegen dem allgemeinen Konsens einer Aufspaltung in nur zwei Splitter-Kreon-Figuren, der nur flüchtig auftretende Admiral als dritter Unterteil gesehen werden kann und somit den Hochhuth-Kreon vervollständigt. Dies könnte eine neue Erkenntnis im Verständnis der Novelle bedeuten, sich aber auch als falsch erweisen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kurze Inhaltsangabe der bearbeiteten Werke
- 2.1 Inhaltsangabe: Sophokles „Antigone“
- 2.2 Inhaltsangabe: Hochhuth „Die Berliner Antigone“
- 3. Die Kreon-Figur
- 3.1 Kreon bei Sophokles
- 3.1.1 Ate und Hybris
- 3.1.2 Kreons Charaktereigenschaften
- 3.1.2.1 Kreons Bezug zu Eteokles
- 3.1 Kreon bei Sophokles
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kreon-Figuren in Sophokles' „Antigone“ und Hochhuths „Die Berliner Antigone“. Der Fokus liegt auf der Analyse der Charaktereigenschaften und Handlungen Kreons in beiden Werken, um einen Vergleich zu ermöglichen und gegebenenfalls neue Interpretationsansätze zu entwickeln. Die Arbeit geht der Frage nach, ob die Aufteilung der Kreon-Figur bei Hochhuth in mehrere Teilfiguren eine sinnvolle Interpretation zulässt.
- Vergleich der Kreon-Figuren in Sophokles' „Antigone“ und Hochhuths „Die Berliner Antigone“
- Analyse der Charaktereigenschaften von Kreon bei Sophokles im Kontext von Ate und Hybris
- Untersuchung der verschiedenen Teil-Kreon-Figuren in Hochhuths Novelle
- Bewertung der Interpretation der Hochhuth'schen Kreon-Figur als Aufteilung in mehrere Personen
- Bedeutung des Konflikts zwischen göttlichem und menschlichem Recht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den Vergleich der Kreon-Figuren in Sophokles' „Antigone“ und Hochhuths „Die Berliner Antigone“. Sie hebt die bisherigen Forschungslücken bezüglich der Kreon-Figur in Hochhuths Werk hervor und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Charaktereigenschaften und nicht auf den literarischen Veränderungen in Hochhuths Adaption. Die Arbeit wird die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Kreon-Figuren herausarbeiten und dabei die Frage der möglichen Aufteilung der Kreon-Figur bei Hochhuth in mehrere Teilfiguren untersuchen.
2. Kurze Inhaltsangabe der bearbeiteten Werke: Dieses Kapitel bietet eine knappe Zusammenfassung der Handlung von Sophokles’ „Antigone“ und Hochhuths „Die Berliner Antigone“. Die Zusammenfassung von Sophokles’ Stück beschreibt den Konflikt zwischen Antigone und Kreon um die Bestattung Polyneikes und die tragischen Folgen. Die Zusammenfassung von Hochhuths Novelle schildert die Handlung um Anne, die ihren Bruder trotz eines Bestattungsverbots bestattet. Beide Zusammenfassungen beleuchten den zentralen Konflikt um das Recht und die Autorität.
3. Die Kreon-Figur: Dieses Kapitel beginnt mit einer Analyse der Kreon-Figur bei Sophokles. Es werden zunächst die Begriffe Ate und Hybris erklärt und in Bezug auf Kreons Handeln gesetzt. Seine Selbstüberschätzung und sein Festhalten am positiven Recht werden als Ausdruck seiner Hybris gedeutet. Im weiteren Verlauf wird Kreons Charakter analysiert, indem sein Verhältnis zu Eteokles und Polyneikes und seine Reaktion auf Antigones Ungehorsam untersucht werden. Die Analyse soll den Vergleich mit den aufgeteilten Kreon-Figuren bei Hochhuth vorbereiten.
Schlüsselwörter
Antigone, Kreon, Sophokles, Hochhuth, Die Berliner Antigone, Ate, Hybris, göttliches Recht, positives Recht, Konflikt, Autorität, Tragödie, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Kreon-Figuren in Sophokles' „Antigone“ und Hochhuths „Die Berliner Antigone“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit vergleicht die Kreon-Figuren in Sophokles' „Antigone“ und Hochhuths „Die Berliner Antigone“. Der Fokus liegt auf der Analyse der Charaktereigenschaften und Handlungen Kreons in beiden Werken, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und gegebenenfalls neue Interpretationsansätze zu entwickeln. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob die Aufteilung der Kreon-Figur bei Hochhuth in mehrere Teilfiguren eine sinnvolle Interpretation zulässt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich der Kreon-Figuren in beiden Werken; Analyse von Kreons Charaktereigenschaften bei Sophokles im Kontext von Ate und Hybris; Untersuchung der verschiedenen Teil-Kreon-Figuren in Hochhuths Novelle; Bewertung der Interpretation der Hochhuth'schen Kreon-Figur als Aufteilung in mehrere Personen; und die Bedeutung des Konflikts zwischen göttlichem und menschlichem Recht.
Welche Werke werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Sophokles' „Antigone“ und Heinrich Böll's „Die Berliner Antigone“. Es werden die Handlung und die Charaktere, insbesondere die Figur des Kreon, in beiden Werken analysiert und verglichen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine kurze Inhaltsangabe der beiden Werke, eine ausführliche Analyse der Kreon-Figur in beiden Werken und einen Schluss mit Schlüsselbegriffen. Die Einleitung erläutert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Die Inhaltsangabe fasst die Handlung beider Werke kurz zusammen. Die Analyse der Kreon-Figur vergleicht die Charaktereigenschaften und Handlungen in beiden Werken, wobei der Fokus auf Kreons Handeln bei Sophokles im Kontext von Ate und Hybris liegt und die Aufteilung der Kreon-Figur bei Hochhuth untersucht wird.
Welche Rolle spielen Ate und Hybris in der Analyse?
Die Begriffe Ate (Verhängnis, Schicksalsschlag) und Hybris (Übermut, Selbstüberschätzung) werden im Kontext der Analyse der Kreon-Figur bei Sophokles verwendet. Kreons Handeln wird als Ausdruck seiner Hybris interpretiert, die zu seinem tragischen Untergang führt.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob und inwiefern sich die Kreon-Figuren in Sophokles' „Antigone“ und Hochhuths „Die Berliner Antigone“ ähneln und unterscheiden, und ob die Aufteilung der Kreon-Figur bei Hochhuth eine tragfähige Interpretation ermöglicht.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zum Vergleich der Kreon-Figuren, zur Interpretation von Kreons Handeln im Kontext von Ate und Hybris und zur Bewertung der Aufteilung der Kreon-Figur bei Hochhuth. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Text der Arbeit selbst detailliert dargelegt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Antigone, Kreon, Sophokles, Hochhuth, Die Berliner Antigone, Ate, Hybris, göttliches Recht, positives Recht, Konflikt, Autorität, Tragödie, Vergleichende Literaturwissenschaft.
- Arbeit zitieren
- Harry Franke (Autor:in), 2015, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Figur des Kreons bei Sophokles und Hochhuth, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/415496