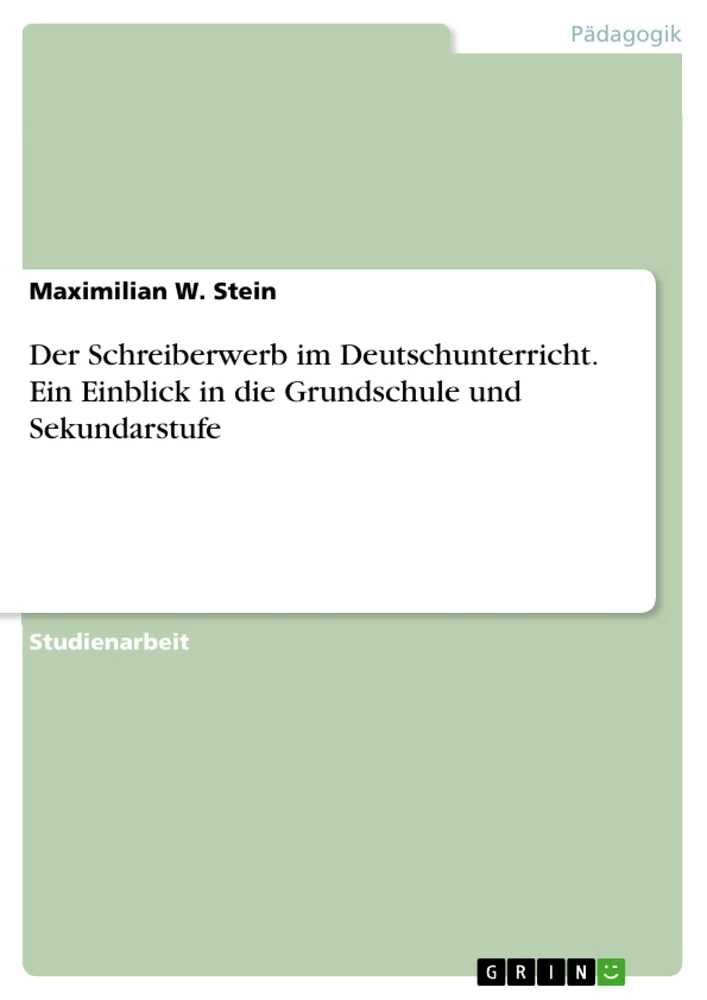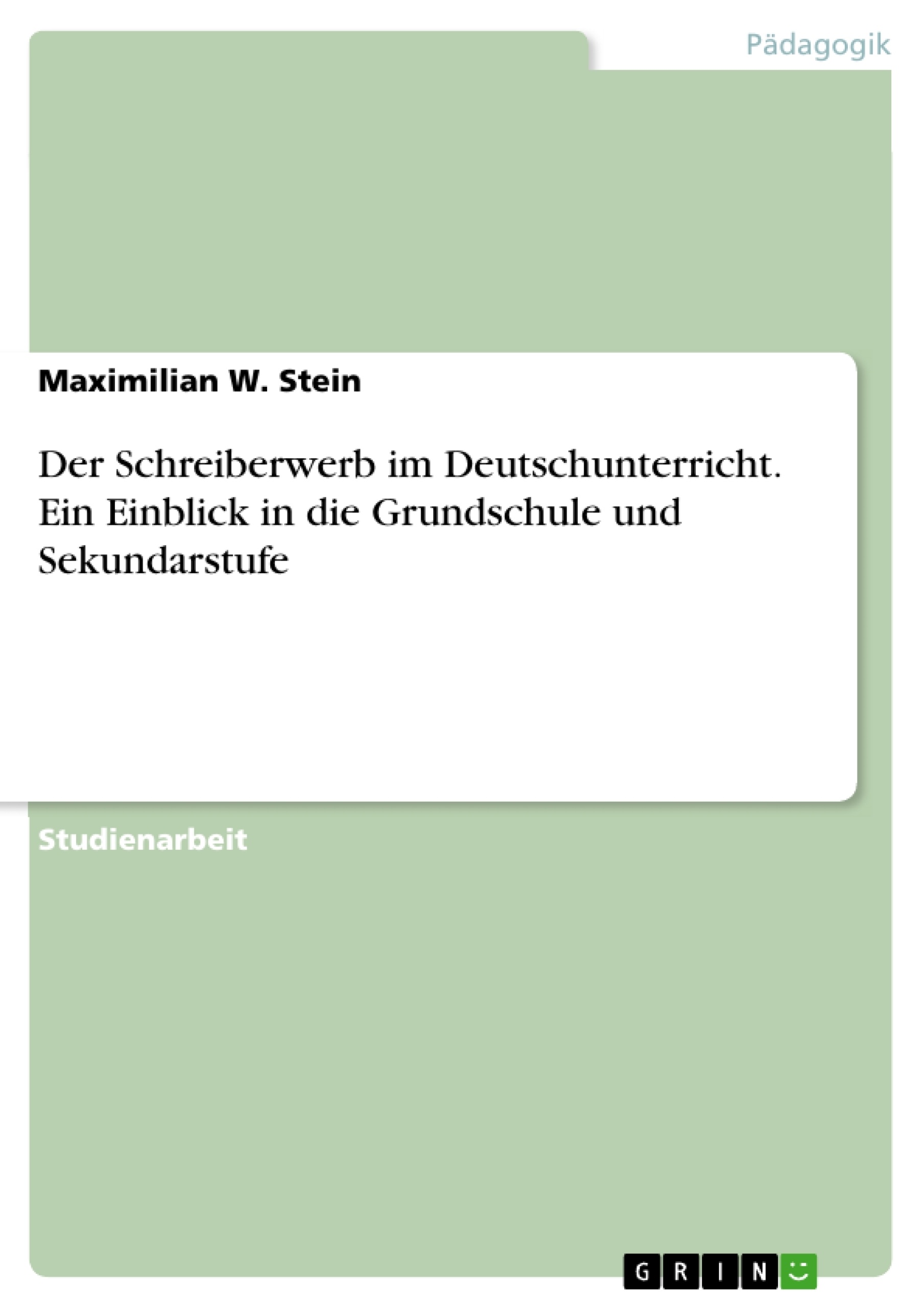Die Schriftlichkeit gehört zum wichtigsten Gut unserer Gesellschaft. Aber nicht nur im 20. und 21. Jahrhundert, sondern schon über viele hunderte Jahre hinweg. Der Beginn der Schrift kann bis in die Steinzeit zurückgeführt werden. Im Hier und Jetzt ist das Schreibenlernen zur Aufgabe der Grundschule geworden. Viele Schülerinnen und Schüler lernen dort jeden Tag durch ebenso viele Methoden Buchstaben, die zu Wörtern werden und sich im Laufe der Zeit zu Sätzen vervollständigen.
Diese Arbeit soll genau diesen Prozess in den Fokus nehmen. Der Schriftspracherwerb stellt die jungen Lernenden vor eine große Herausforderung. Trotzdem gelingt es fast jedem, das Schreiben und Lesen zu erlernen.
Zu Beginn wird der Begriff des Schriftspracherwerbs genauer definiert und die Voraussetzen, die für diesen nötig sind, zusammengefasst. Weiterhin werden zwei Methoden von Uta Frith und Jürgen Reichen präsentiert. Letzterer hat die Grundschuldidaktik revolutioniert und mit seinem Konzept tausende Lehrkräfte der Grundschule begeistert. Dennoch wird seit Jahren lautstark Kritik daran geübt.
Rückbezogen zum Schreiben, werden Strategien zum richtigen Schreiben von Ralph Köhnen aufgezeigt, die für Erleichterungen beim Erlernen sorgen sollen. Schließlich findet eine Transformation in die Praxis statt. TINTO als ein original praxisnahes Lehrwerk wird in dieser Arbeit vorgestellt. Daneben soll die Verbindung zum Reichschen Konzept offengelegt und auch Unterschiede beleuchtet werden. Das Buchstabenhaus und der Buchstabenordner finden in dieser Vorstellungsreihe ihren Platz. Um weiterführend den Fokus auch auf die Sekundarstufe zu richten, wird dafür das Kerncurriculum zur Hilfe herangezogen.
Grundsätzlich soll in dieser Arbeit die Frage im Mittelpunkt stehen, wie die Kinder die Fähigkeit des Schreibens erlernen, welche Voraussetzungen sie dafür benötigen und welche Entwicklungsstufen sie dabei durchlaufen. Es wird ein Einblick in die „moderne“ Grundschuldidaktik mit Hilfe des Kerncurriculums gewährleistet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition und Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb
- 3. Vorstellung verschiedener Theorien und Methoden zum Schriftspracherwerb
- 3.1 Das Modell von Uta Frith (1985)
- 3.2 Das Modell „Lesen durch Schreiben“ von Jürgen Reichen (1981)
- 3.3 Strategien zum richtigen Schreiben nach Ralph Köhnen
- 4. Ein Einblick in die Grundschule mit TINTO
- 4.1 Förderung des Schreibprozesses
- 4.2 Das Konzept des Buchstabenhauses
- 4.3 Das Konzept des Buchstabenordners
- 5. Die Bedeutung für die Sekundarstufe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Schriftspracherwerb im Deutschunterricht der Grundschule und Sekundarstufe. Ziel ist es, den Prozess des Schreiblernens bei Kindern zu beleuchten, die notwendigen Voraussetzungen zu definieren und verschiedene Theorien und Methoden zu präsentieren. Dabei wird der Fokus auf die praktische Umsetzung im Unterricht gelegt.
- Definition und Voraussetzungen des Schriftspracherwerbs
- Vergleichende Analyse verschiedener Theorien (Frith, Reichen)
- Praktische Anwendung im Grundschulunterricht (TINTO)
- Bedeutung des Schreibens für die Sekundarstufe
- Förderung des Schreibprozesses und Entwicklung von Schreibkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Schriftspracherwerb ein und hebt die Bedeutung der Schriftlichkeit in unserer Gesellschaft hervor. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf den Prozess des Schreiblernens in der Grundschule und Sekundarstufe und kündigt die folgenden Kapitel an, die sich mit Definitionen, Theorien, praktischen Beispielen und der Bedeutung für die Sekundarstufe befassen.
2. Definition und Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb: Dieses Kapitel definiert den Schriftspracherwerb als literarische Sozialisation und kognitive Aktivität. Es werden die unterschiedlichen Voraussetzungen bei Kindern für das Lesen- und Schreibenlernen detailliert beschrieben, einschließlich phonologischer Bewusstheit, Wortkonzeptes und der lautlichen Durchgliederung von Wörtern. Es wird betont, dass der Übergang von der gesprochenen zur geschriebenen Sprache einen qualitativen Sprung darstellt, der mit Herausforderungen für junge Lernende verbunden ist. Das Kapitel beleuchtet auch den vorschulischen Kontakt mit Schriftsprache als wichtigen Faktor.
3. Vorstellung verschiedener Theorien und Methoden zum Schriftspracherwerb: Dieses Kapitel präsentiert das dreistufige Modell von Uta Frith (logografisch, alphabetisch, orthografisch) und das Konzept „Lesen durch Schreiben“ von Jürgen Reichen. Friths Modell beschreibt die Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs als qualitativ unterschiedliche Zugriffsweisen auf die Schriftsprache. Reichens Ansatz betont das Schreiben vor dem Lesen und die Verwendung einer Buchstabentabelle (Anlauttabelle). Beide Modelle werden kritisch beleuchtet, wobei die Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze diskutiert werden. Zusätzlich werden Strategien von Ralph Köhnen zum richtigen Schreiben vorgestellt.
4. Ein Einblick in die Grundschule mit TINTO: Dieses Kapitel gibt einen Einblick in die Grundschuldidaktik anhand des Lehrwerks „TINTO“. Es beschreibt die didaktische Konzeption des Lehrwerks, die sich an der Methode von Jürgen Reichen orientiert und auf selbstgesteuertem Lernen und offener Unterrichtsgestaltung basiert. Das Kapitel erläutert detailliert das „Buchstabenhaus“ und den „Buchstabenordner“ als zentrale Elemente des TINTO-Konzepts und zeigt verschiedene Fördermaßnahmen zur Unterstützung des Schreibprozesses auf, einschließlich der Förderung der Wortgrenzenkompetenz und der Arbeit mit Wortendungen.
5. Die Bedeutung für die Sekundarstufe: Dieses Kapitel erweitert den Blick auf die Sekundarstufe und betont die Bedeutung von Schreibkompetenz für die gesellschaftliche Teilhabe. Es wird der Bezug zum Kerncurriculum der Sekundarstufe I hergestellt, und die Erweiterung und Vertiefung der Schreibkompetenz in den höheren Jahrgangsstufen wird angesprochen. Die Bedeutung von Schreibkompetenz für den Zugang zu Bildung und Beruf wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Lesen, Schreiben, Grundschule, Sekundarstufe, Theorien (Frith, Reichen), Methoden (Lesen durch Schreiben), TINTO, phonologische Bewusstheit, Schreibförderung, Schreibkompetenz, Kerncurriculum, Rechtschreibung, Orthografie.
Häufig gestellte Fragen zum Schriftspracherwerb
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Schriftspracherwerb im Deutschunterricht der Grundschule und Sekundarstufe. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Darstellung verschiedener Theorien (Frith, Reichen), Methoden (Lesen durch Schreiben) und deren praktische Anwendung im Unterricht, insbesondere mit dem Lehrwerk TINTO.
Welche Theorien und Methoden zum Schriftspracherwerb werden vorgestellt?
Das Dokument stellt das dreistufige Modell von Uta Frith (logografisch, alphabetisch, orthografisch) und das Konzept „Lesen durch Schreiben“ von Jürgen Reichen vor. Beide Modelle werden verglichen und kritisch beleuchtet. Zusätzlich werden Strategien von Ralph Köhnen zum richtigen Schreiben erläutert.
Welche Rolle spielt das Lehrwerk TINTO?
Das Kapitel über die Grundschule konzentriert sich auf das Lehrwerk TINTO. Es beschreibt die didaktische Konzeption, die auf selbstgesteuertem Lernen basiert, und erläutert zentrale Elemente wie das „Buchstabenhaus“ und den „Buchstabenordner“. Verschiedene Fördermaßnahmen zur Unterstützung des Schreibprozesses werden ebenfalls vorgestellt.
Welche Voraussetzungen sind für den Schriftspracherwerb notwendig?
Das Dokument definiert den Schriftspracherwerb und beschreibt detailliert die notwendigen Voraussetzungen bei Kindern, darunter phonologische Bewusstheit, das Wortkonzept und die lautliche Durchgliederung von Wörtern. Der vorschulische Kontakt mit Schriftsprache wird als wichtiger Faktor hervorgehoben.
Welche Bedeutung hat der Schriftspracherwerb für die Sekundarstufe?
Das Dokument betont die Bedeutung von Schreibkompetenz für die gesellschaftliche Teilhabe und den Zugang zu Bildung und Beruf in der Sekundarstufe. Der Bezug zum Kerncurriculum der Sekundarstufe I wird hergestellt, und die Erweiterung und Vertiefung der Schreibkompetenz in höheren Jahrgangsstufen wird angesprochen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Schriftspracherwerb?
Schlüsselwörter beinhalten: Schriftspracherwerb, Lesen, Schreiben, Grundschule, Sekundarstufe, Theorien (Frith, Reichen), Methoden (Lesen durch Schreiben), TINTO, phonologische Bewusstheit, Schreibförderung, Schreibkompetenz, Kerncurriculum, Rechtschreibung, Orthografie.
Wie ist der Schriftspracherwerb definiert?
Der Schriftspracherwerb wird als literarische Sozialisation und kognitive Aktivität definiert, die einen qualitativen Sprung vom gesprochenen zum geschriebenen Wort darstellt.
Welche Kapitel beinhaltet das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Definition und Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb, Vorstellung verschiedener Theorien und Methoden zum Schriftspracherwerb, Ein Einblick in die Grundschule mit TINTO und Die Bedeutung für die Sekundarstufe.
- Quote paper
- Maximilian W. Stein (Author), 2017, Der Schreiberwerb im Deutschunterricht. Ein Einblick in die Grundschule und Sekundarstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/414591