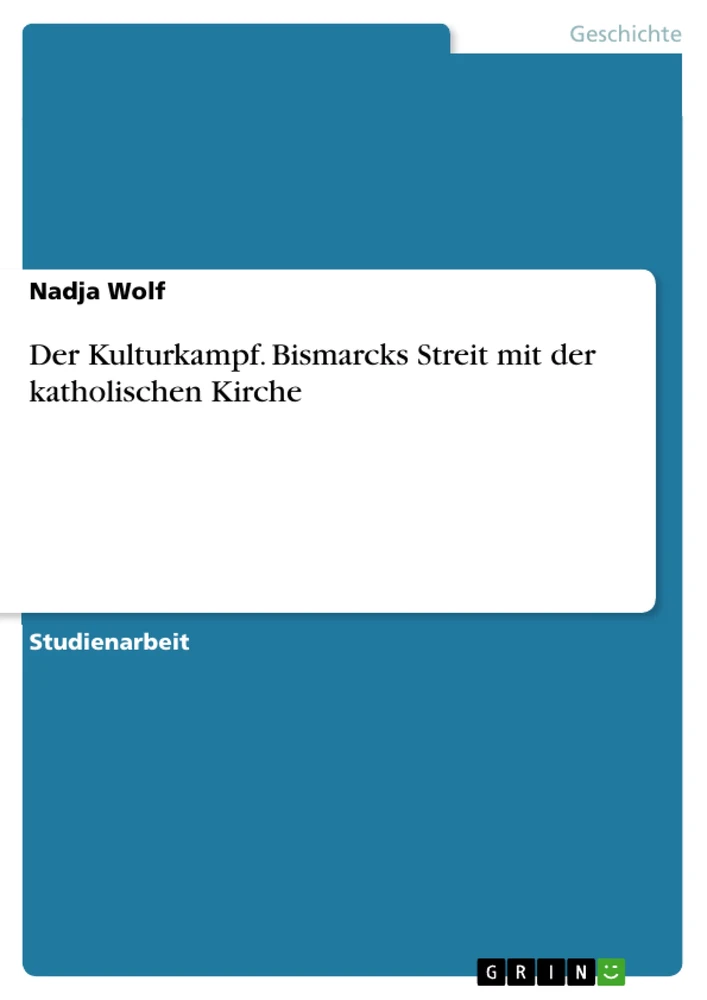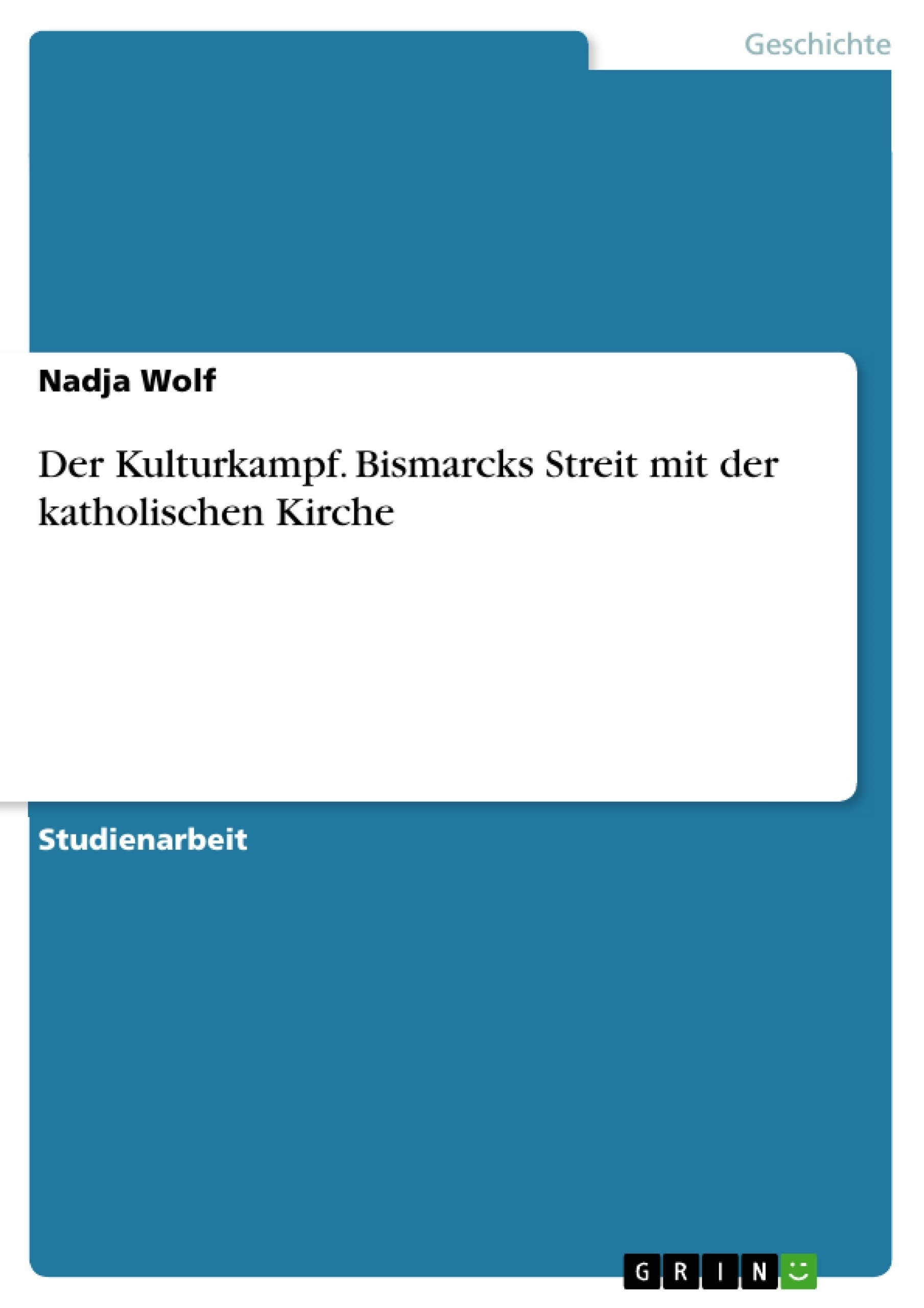In der vorliegenden Seminararbeit soll folgende Frage diskutiert und beantwortet werden: Wollte Bismarck mit dem Kulturkampf seinen Hass gegenüber den Katholiken demonstrieren und ein Feindbild entwerfen? Diskutiert wird diese Fragestellung vor dem Hintergrund einiger Kulturkampfgesetze sowie der Rede Otto von Bismarcks vom 30. Januar 1872.
Aufgrund der begrenzten Seitenanzahl kann nicht auf alle Gesetze eingegangen werden. Daher wählte ich für die Diskussion die Bedeutendsten: den Kanzelparagraphen vom Dezember 1871, das Jesuitengesetz vom Juli 1872 und das Zivilehegesetz aus dem Jahr 1875. Außerdem wird des Öfteren Otto Pflanzes „Bismarck – Der Reichsgründer“4 zitiert, da dieses Werk eine ausführliche Aufbereitung der Ära Bismarck bietet. Hierbei werden Bismarcks Lebensjahre nicht wie in herkömmlichen Biografien stur mit Ereignissen gefüllt. Pflanze setzt Bismarcks Leben in ein Geflecht aus ökonomischen, sozialen und politischen Aspekten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Religiöse und politische Umstände
- 1.1 Die Entwicklung der katholischen Kirche Mitte des 19. Jahrhunderts
- 1.2 Die Gründung der Zentrumspartei
- 2. Bismarcks Haltung zur Religion und zur katholischen Kirche
- 3. Die wichtigsten Gesetze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Kulturkampf, Bismarcks Konflikt mit der katholischen Kirche. Die zentrale Frage lautet: Wollte Bismarck mit dem Kulturkampf seinen Hass auf Katholiken demonstrieren und ein Feindbild schaffen? Die Arbeit analysiert dies anhand wichtiger Kulturkampfgesetze und Bismarcks Rede vom 30. Januar 1872.
- Die Entwicklung der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert und der Ultramontanismus
- Die Entstehung und die Rolle der Zentrumspartei
- Bismarcks politische und religiöse Motivationen
- Analyse der wichtigsten Kulturkampfgesetze (Kanzelparagraph, Jesuitengesetz, Zivilehegesetz)
- Bewertung von Bismarcks Vorgehen und dessen Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Kulturkampfes ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach Bismarcks Motivationen. Sie skizziert den historischen Kontext und die Bedeutung des Kulturkampfes, wobei auch die aktuelle Relevanz von Kulturkämpfen betont wird. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit wird erläutert, und es wird auf die Quellen und den Forschungsstand hingewiesen.
1. Religiöse und politische Umstände: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Hintergrund des Kulturkampfes. Es beleuchtet die Entwicklung der katholischen Kirche Mitte des 19. Jahrhunderts, den Ultramontanismus und die Reaktion des Papstes Pius IX. auf die Herausforderungen des Liberalismus und der Nationalstaatenbildung. Der Fokus liegt auf der Entstehung des Syllabus und des Unfehlbarkeitsdogmas als Ausdruck der kirchlichen Abgrenzung vom Liberalismus. Weiterhin wird die Gründung der Zentrumspartei und deren Bedeutung als politische Vertretung der katholischen Bevölkerung dargestellt.
Schlüsselwörter
Kulturkampf, Otto von Bismarck, Katholische Kirche, Zentrumspartei, Ultramontanismus, Kanzelparagraph, Jesuitengesetz, Zivilehegesetz, Deutsches Reich, Nationalstaat, Liberalismus, Religion, Politik.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Der Kulturkampf
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Kulturkampf, den Konflikt zwischen Otto von Bismarck und der katholischen Kirche im Deutschen Reich. Im Mittelpunkt steht die Frage nach Bismarcks Motivationen: Wollte er mit dem Kulturkampf seinen Hass auf Katholiken demonstrieren und ein Feindbild schaffen?
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert und den Ultramontanismus, die Entstehung und Rolle der Zentrumspartei, Bismarcks politische und religiöse Motivationen, eine Analyse wichtiger Kulturkampfgesetze (Kanzelparagraph, Jesuitengesetz, Zivilehegesetz) und eine Bewertung von Bismarcks Vorgehen und dessen Folgen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den religiösen und politischen Umständen (inkl. Entwicklung der katholischen Kirche und Gründung der Zentrumspartei), ein Kapitel zu Bismarcks Haltung, ein Kapitel zu den wichtigsten Gesetzen und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein, skizziert den historischen Kontext und die methodische Vorgehensweise. Das Kapitel zu den religiösen und politischen Umständen beleuchtet den historischen Hintergrund des Kulturkampfes, den Ultramontanismus und die Entstehung des Syllabus und des Unfehlbarkeitsdogmas.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kulturkampf, Otto von Bismarck, Katholische Kirche, Zentrumspartei, Ultramontanismus, Kanzelparagraph, Jesuitengesetz, Zivilehegesetz, Deutsches Reich, Nationalstaat, Liberalismus, Religion, Politik.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wollte Bismarck mit dem Kulturkampf seinen Hass auf Katholiken demonstrieren und ein Feindbild schaffen? Die Arbeit analysiert dies anhand wichtiger Kulturkampfgesetze und Bismarcks Rede vom 30. Januar 1872.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit nennt zwar nicht explizit die verwendeten Quellen, verweist aber auf den Forschungsstand und die methodische Vorgehensweise in der Einleitung. Details zu den Quellen sind im Volltext der Arbeit zu finden.
- Arbeit zitieren
- Nadja Wolf (Autor:in), 2017, Der Kulturkampf. Bismarcks Streit mit der katholischen Kirche, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/413673