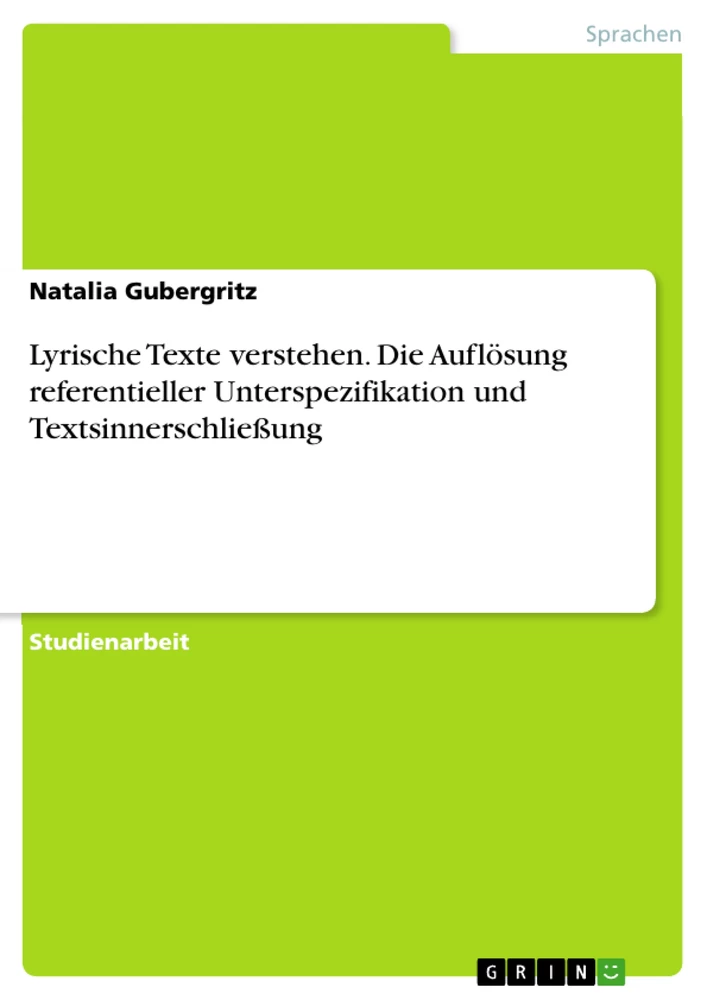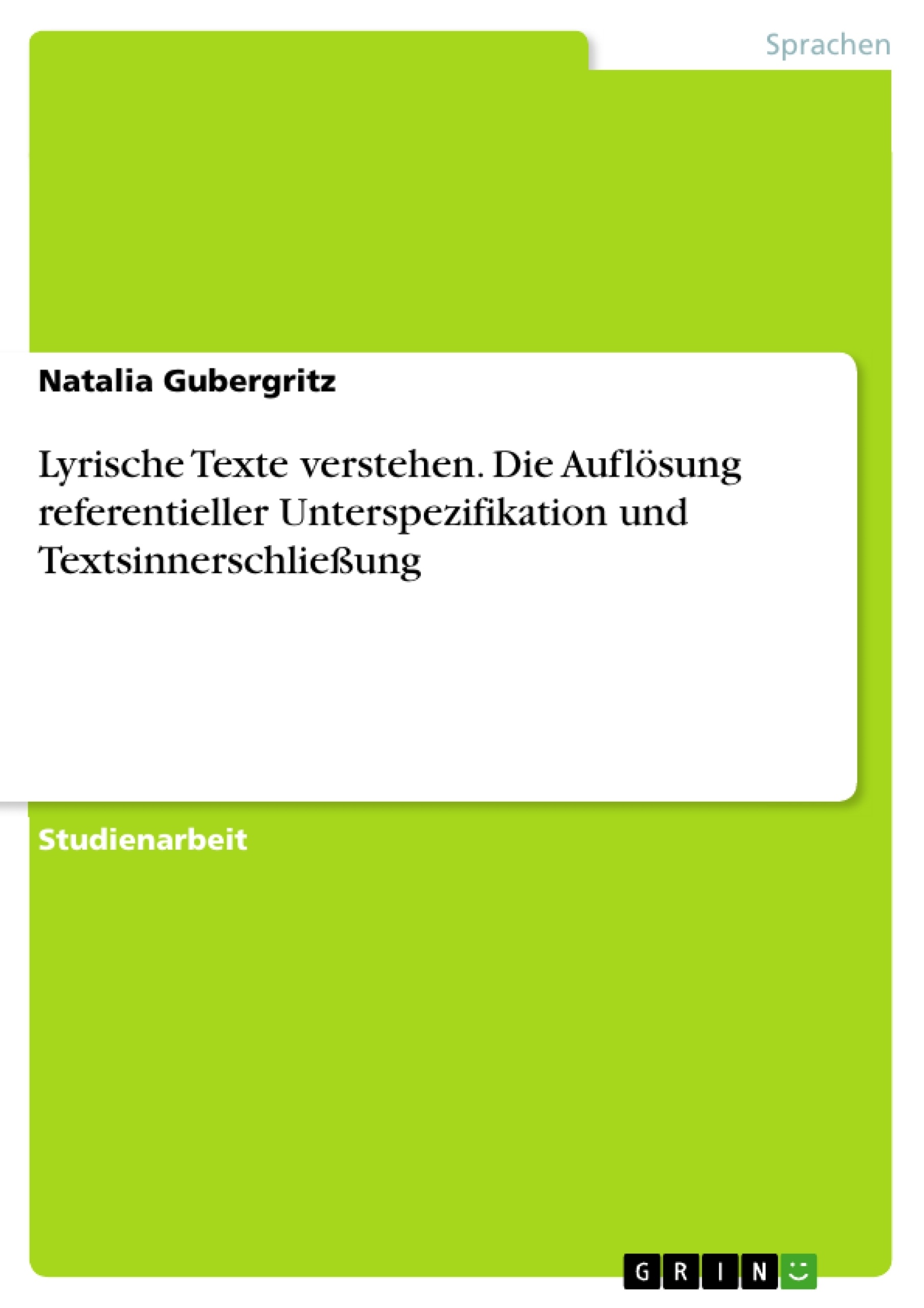Die menschliche Sprache kann unter vielen unterschiedlichen Aspekten analysiert werden. In der Phonologie untersuchen Linguisten die Bildung und Rezeption von Lauten, die Morphologie beschäftigt sich mit Wortbildung und die Syntax mit der grammatischen Konstitution von Sätzen. Doch eine der komplexesten Disziplinen der Sprachwissenschaft ist diejenige, die Gegenstand dieser Arbeit sein wird - die Wissenschaft um die Bedeutung, die Semantik.
Jedes einzelne Wort in der menschlichen Sprache hat eine oder auch mehrere Bedeutungen. Jedoch soll sich hier nicht der Bedeutung von Worten gewidmet werden, sondern der Bedeutung von Texten und den kognitiven Prozessen, die für das Verstehen von Texten verantwortlich sind. Texte, deren einfachste Einheit Sätze sind, sind die Grundlage der zwischenmenschlichen Kommunikation. Texte jeglicher Art bilden das Kommunikationsmedium zwischen deren Produzenten und Rezipienten, ob es sich nun um einen mündlichen Diskurs handelt oder um schriftliche Texte. Viel mehr noch als bei einzelnen Wörtern ist das Verstehen der Bedeutung von Texten ein sehr komplexer kognitiver Prozess, der auf mehreren Ebenen stattfindet.
Die Bedeutung von Texten konstituiert sich nämlich nicht nur aus den Lexembedeutungen der enthaltenen Wörter und ihrer syntaktischen Relationen untereinander. Vieles wird nicht expliziert erwähnt, aber trotzdem von dem Textrezipienten verstanden. Wie ein Rezipient einen Text versteht, hängt unter anderem von dem Produzenten und seiner Intention, dem Rezipienten selbst und der Kommunikationssituation ab. Schriftliche Texte bieten dabei ein anderes Verhältnis und eine andere Distanz zwischen Produzent und Rezipient als mündliche Konversation. Dies gilt insbesondere für literarische Texte. Lyrik, als spezielle Gattung der Literatur lebt von der Tatsache, dass das Verständnis nicht nur aus der Textoberfläche hervorgeht.
Im Allgemeinen kann man demnach sagen, dass alle natürlichen Texte referentiell unterspezifiziert sind. Für lyrische Texte gilt das in besonderem Maße. Für deren Verstehen muss diese referentielle Unterspezifikation aufgelöst werden. Doch wie weit geht diese Auflösung von referentieller Unterspezifikation? Welche kognitiven Prozesse kann man dazu zählen? Was kann dagegen bereits als Interpretation bzw. Textsinnerschließung gehandelt werden? Vor allem bei lyrischen Texten sind diese Fragen von essentieller Wichtigkeit. Diese Arbeit wird sich mit genau diesen Fragestellungen beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Begrifflichkeit
- 2.1. Kohärenz
- 2.2. Textverstehen
- 2.3. Textweltmodell
- 3. Referentielle Unterspezifikation
- 3.1. Überspezifikation in literarischen Texten
- 3.2. Arten und Auflösung
- 4. Unterspezifizierte Lyrik
- 4.1. Peter Maiwald – Brief, 1984
- 4.2. Hannelies Taschau - Das war mal schön, 1986
- 4.3. Hannelies Taschau - Anzeige, 1986
- 5. Fazit
- 6. Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auflösung referentieller Unterspezifikation in lyrischen Texten und grenzt sie von der Textsinnerschließung ab. Es wird analysiert, wie weit die Auflösung der Unterspezifikation reicht und welche kognitiven Prozesse dabei eine Rolle spielen.
- Referentielle Unterspezifikation in lyrischen Texten
- Kognitive Prozesse des Textverständnisses
- Abgrenzung zwischen Auflösung referentieller Unterspezifikation und Interpretation
- Analyse konkreter lyrischer Beispiele
- Der Einfluss von Produzent, Rezipient und Kommunikationssituation auf das Textverstehen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der semantischen Analyse von Texten ein und hebt die Komplexität des Textverständnisses hervor. Sie betont die Bedeutung der referentiellen Unterspezifikation, insbesondere in lyrischen Texten, und formuliert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit: Wie weit geht die Auflösung dieser Unterspezifikation? Welche kognitiven Prozesse sind beteiligt? Wann beginnt die eigentliche Interpretation bzw. Textsinnerschließung? Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die Klärung grundlegender Begriffe im zweiten Kapitel an.
2. Zur Begrifflichkeit: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe wie Text, Kohärenz und Textverstehen. Es definiert einen Text als eine zusammenhängende sprachliche Einheit aus Sätzen oder Propositionen, deren Bedeutung nicht nur aus den Einzelbedeutungen der Wörter hervorgeht, sondern auch durch implizite Informationen und den Kontext entsteht. Die Kohärenz eines Textes wird als essentiell für das Verstehen hervorgehoben und anhand von Beispielen verdeutlicht, wie die Beziehung zwischen Sätzen die Bedeutung konstituiert. Der Bezug auf die latente Produzent-Rezipient-Interaktion und das Kooperativitätsprinzip wird hergestellt.
3. Referentielle Unterspezifikation: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Phänomen der referentiellen Unterspezifikation und ihrer Auflösung. Es geht auf unterschiedliche Arten und Auflösungsmechanismen ein, wobei die Theorie von Monika Schwarz (2000) als Grundlage dient. Der Fokus liegt auf der Erklärung dieses Phänomens in einfachen Texten, um dann den Übergang zu den komplexeren Strukturen lyrischer Texte zu ebnen. Der Kapitel verbindet theoretische Überlegungen mit der Vorbereitung auf die anschließende Analyse lyrischer Beispiele.
4. Unterspezifizierte Lyrik: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte lyrische Texte von Peter Maiwald und Hannelies Taschau, um die Unterschiede zwischen der Auflösung referentieller Unterspezifikation und der Textsinnerschließung aufzuzeigen. Die Gedichte dienen als exemplarische Fälle, um die Problematik des "Lesens zwischen den Zeilen" zu verdeutlichen und die komplexen kognitiven Prozesse des Verstehens lyrischer Poesie zu illustrieren. Die Analyse der ausgewählten Texte wird die im vorhergehenden Kapitel aufgestellten Theorien verdeutlichen und veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Referentielle Unterspezifikation, Textverstehen, Kohärenz, Lyrik, Textsinnerschließung, Kognitive Semantik, Interpretation, Textweltmodell, Kommunikation, Produzent-Rezipient-Interaktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auflösung referentieller Unterspezifikation in lyrischen Texten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auflösung referentieller Unterspezifikation in lyrischen Texten und grenzt diese von der Textsinnerschließung ab. Es wird analysiert, wie weit die Auflösung der Unterspezifikation reicht und welche kognitiven Prozesse dabei eine Rolle spielen. Die Arbeit analysiert konkret ausgewählte Gedichte von Peter Maiwald und Hannelies Taschau.
Welche zentralen Begriffe werden in der Arbeit geklärt?
Die Arbeit klärt zentrale Begriffe wie Text, Kohärenz, Textverstehen, referentielle Unterspezifikation und Textsinnerschließung. Es wird erläutert, wie die Beziehung zwischen Sätzen die Bedeutung eines Textes konstituiert und wie implizite Informationen und der Kontext zum Textverständnis beitragen. Der Bezug auf die latente Produzent-Rezipient-Interaktion und das Kooperativitätsprinzip wird hergestellt.
Was ist referentielle Unterspezifikation und wie wird sie in der Arbeit behandelt?
Referentielle Unterspezifikation beschreibt das Phänomen, dass in einem Text nicht alle Informationen explizit genannt werden. Die Arbeit untersucht verschiedene Arten und Auflösungsmechanismen dieser Unterspezifikation, basierend auf der Theorie von Monika Schwarz (2000). Es wird gezeigt, wie diese Unterspezifikation in einfachen Texten funktioniert und wie sie sich in komplexeren Strukturen lyrischer Texte manifestiert.
Welche Rolle spielen kognitive Prozesse beim Textverständnis?
Die Arbeit betont die Bedeutung kognitiver Prozesse beim Textverständnis, insbesondere bei der Auflösung referentieller Unterspezifikation. Es wird analysiert, welche mentalen Prozesse beim "Lesen zwischen den Zeilen" eine Rolle spielen und wie diese Prozesse zur Interpretation lyrischer Texte beitragen. Der Einfluss von Produzent, Rezipient und Kommunikationssituation auf das Textverstehen wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie werden die theoretischen Überlegungen in der Arbeit veranschaulicht?
Die theoretischen Überlegungen werden durch die Analyse konkreter lyrischer Texte von Peter Maiwald und Hannelies Taschau veranschaulicht. Die Gedichte dienen als exemplarische Fälle, um die Problematik des "Lesens zwischen den Zeilen" und die komplexen kognitiven Prozesse des Verstehens lyrischer Poesie zu illustrieren. Die Analyse zeigt den Unterschied zwischen der Auflösung referentieller Unterspezifikation und der eigentlichen Textsinnerschließung auf.
Welche konkreten Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Gedichte "Brief, 1984" von Peter Maiwald und "Das war mal schön, 1986" und "Anzeige, 1986" von Hannelies Taschau. Diese Gedichte dienen als Fallbeispiele zur Veranschaulichung der theoretischen Konzepte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Referentielle Unterspezifikation, Textverstehen, Kohärenz, Lyrik, Textsinnerschließung, Kognitive Semantik, Interpretation, Textweltmodell, Kommunikation, Produzent-Rezipient-Interaktion.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Zur Begrifflichkeit (Kohärenz, Textverstehen, Textweltmodell), Referentielle Unterspezifikation (Überspezifikation in literarischen Texten, Arten und Auflösung), Unterspezifizierte Lyrik (Analyse von Gedichten von Peter Maiwald und Hannelies Taschau), Fazit und Quellen.
- Quote paper
- Natalia Gubergritz (Author), 2011, Lyrische Texte verstehen. Die Auflösung referentieller Unterspezifikation und Textsinnerschließung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/412998