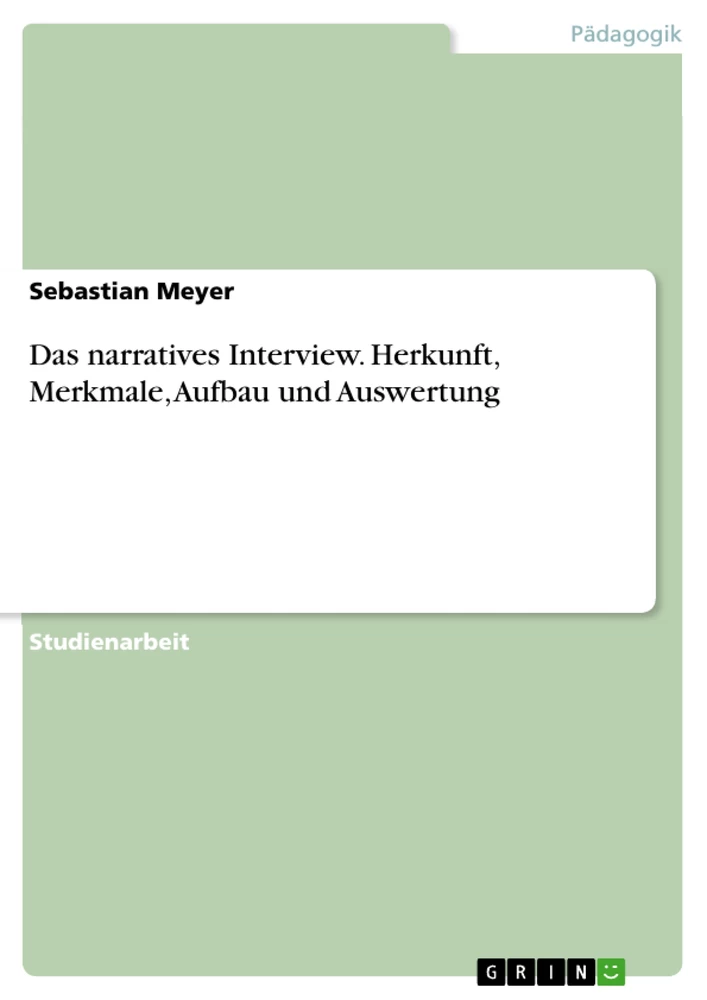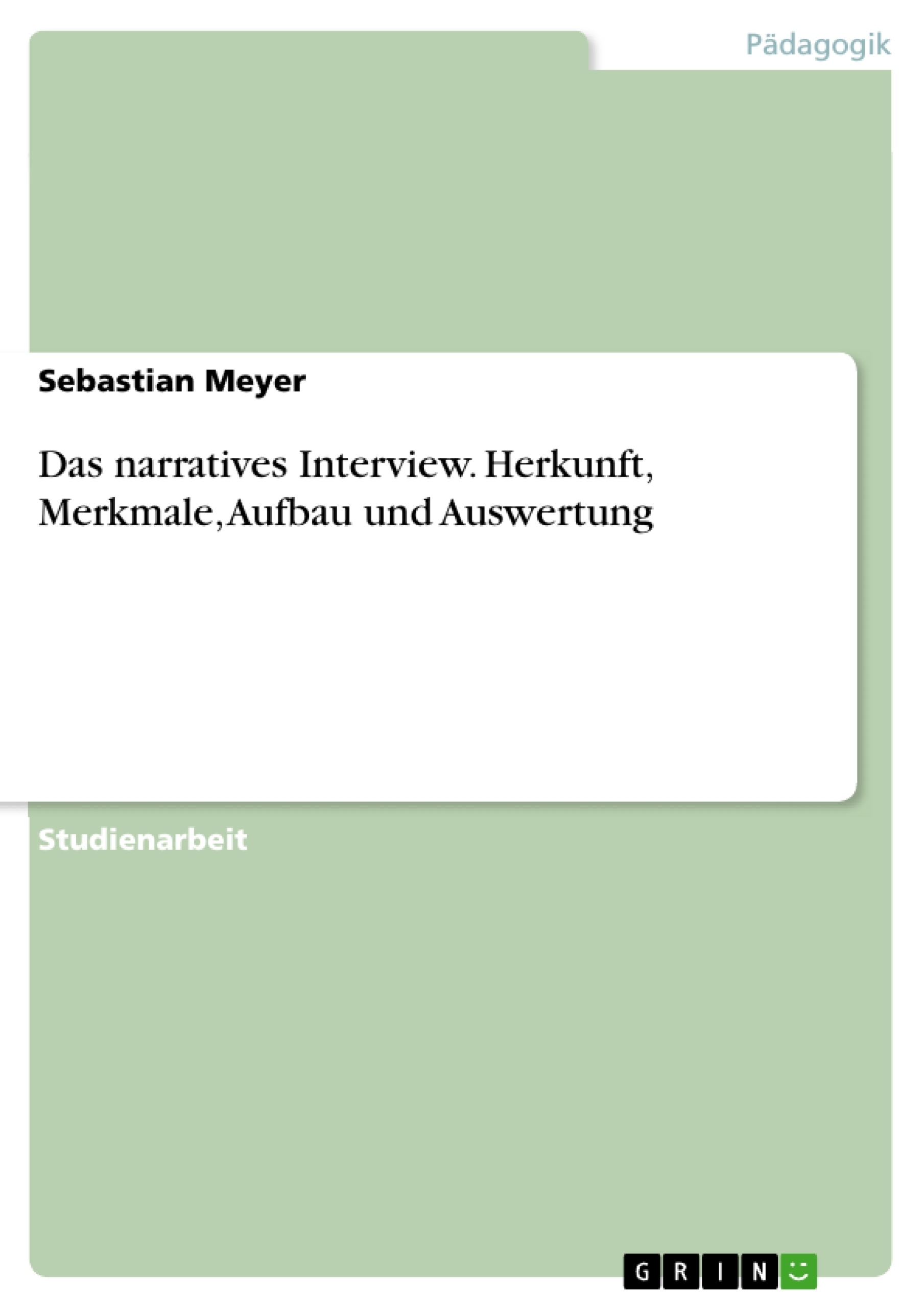Das narrative Interview wurde in Deutschland von Fritz Schütze und seinen Kollegen als Forschungsmethode entwickelt. Es fügt sich in eine Reihe von qualifizierten Verfahren ein, die mit weitreichenden, auch gesellschaftstheoretischem Anspruch in den 1970er Jahren ausgebaut wurden. Dieses steht in dem Brauch der Phänomenologie und des symbolischen Interaktionismus.
Biographen sollen nicht in erster Linie schildern, beschreiben, oder argumentieren, sondern hinsichtlich der Konzepte selbst erlebte Ereignisse und die persönliche Teilnahme entlang der Zeit rekonstruieren. Die Rekonstruktion dieser Erfahrungen in der Erzählung weist dabei bestimmte Muster auf, die den Mustern des Handelns und seiner Begrenzung in der Realität entsprechen. Ereignisse und Handlungen werden erst dann zu Erfahrungen, wenn sie erst der rückblickenden Rekonstruktion unterliegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Warum ein Interesse an Lebensläufen besteht
- 2. Herkunft der Methode
- 3. Allgemeine Merkmale des narrativen Interviews
- 4. Formale Merkmale des narrativen Interviews
- 5. Aufbau des narrativen Interviews
- 5.1 Die Erzählaufforderung
- 5.2 Die biographische Selbstpräsentation
- 5.3 Die Erzählkoda
- 5.4 Die erzählgenerierende Nachfragephase
- 5.5 Der Interviewabschluss
- 6. Zur Auswertung von autobiographischen Stegreiferzählungen
- 6.1 Schritte der Auswertung autobiographischer Stegreiferzählungen
- 7. Die Prozessstruktur der Verlaufskurve
- 8. Alternativen der Analyse und Auswertung autobiographisch-narrativer Interviews
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt das narrative Interview als Forschungsmethode in den Sozialwissenschaften, fokussiert auf die Erhebung und Auswertung von Lebensgeschichten. Ziel ist es, die Methode detailliert darzustellen, ihre Anwendung und die damit verbundenen analytischen Prozesse zu erläutern.
- Das narrative Interview als Methode der Biographieforschung
- Der Ablauf und die formalen Merkmale des narrativen Interviews
- Die Auswertung autobiografischer Erzählungen
- Prozessstrukturen im individuellen Lebenslauf
- Alternativen in der Analyse und Auswertung narrativer Interviews
Zusammenfassung der Kapitel
1. Warum ein Interesse an Lebensläufen besteht: Dieses Kapitel beleuchtet das wissenschaftliche Interesse an Lebensläufen in der Biographieforschung. Es betont die Bedeutung der Prozessstrukturen individuellen Lebens und wie diese, in Kombination mit individuellen Deutungsmustern, die Lebensgeschichte prägen. Der Fokus liegt auf der Erfassung dieser Strukturen mithilfe geeigneter Forschungsmethoden, um Fragen nach der sequentiellen Abfolge von Ereignissen und deren Bedeutung zu beantworten. Das Kapitel legt die Grundlage für die Notwendigkeit einer Methode wie dem narrativen Interview zur Erforschung dieser komplexen Zusammenhänge.
2. Herkunft der Methode: Hier wird die Entstehung des narrativen Interviews in Deutschland durch Fritz Schütze und Kollegen beschrieben. Es wird eingeordnet in den Kontext der qualifizierten Verfahren der 1970er Jahre, verbunden mit Phänomenologie und symbolischem Interaktionismus. Der Schwerpunkt liegt auf der Rekonstruktion von selbst erlebten Ereignissen und der Bedeutung der rückblickenden Betrachtung für die Entstehung von Erfahrungen. Das Kapitel verdeutlicht den methodologischen Hintergrund und die theoretischen Annahmen des narrativen Interviews.
3. Allgemeine Merkmale des narrativen Interviews: Dieses Kapitel beschreibt die charakteristischen Merkmale des narrativen Interviews. Es hebt die Fähigkeit hervor, lückenlos Ereignisverstrickungen und Erfahrungsaufschichtungen zu reproduzieren, wobei sowohl äußerer Ablauf als auch innere Reaktionen des Befragten erfasst werden. Im Vergleich zu anderen Methoden wird die "Offenheit" für Interviewer und Befragten betont, mit dem Ziel, individuelle Probleme sichtbar zu machen, die durch standardisierte Verfahren nicht erfasst werden könnten. Der Fokus liegt auf der Generierung umfassender Erzählungen und der Vermeidung von standardisierten Fragen.
4. Formale Merkmale des narrativen Interviews: Dieses Kapitel befasst sich mit den formalen Aspekten der Durchführung des narrativen Interviews. Es betont die Bedeutung eines flexiblen Fragenkatalogs, die Vermeidung von Druck bei der Beantwortung von Fragen und die Wichtigkeit der Anonymität und des Vertrauensaufbaus. Die Rolle des Interviewers als Stichwortgeber und aufmerksamer Zuhörer wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Organisation und Durchführung des Interviews, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
5. Aufbau des narrativen Interviews: Das Kapitel beschreibt den strukturellen Aufbau des narrativen Interviews, beginnend mit der Erzählaufforderung. Es werden unterschiedliche Arten der Erzählaufforderung vorgestellt, mit dem Ziel, den Interviewpartner zum freien Erzählen anzuregen, ohne ihn zu stark einzuschränken. Der Aufbau des Interviews in Erzählphase und Nachfragephase wird erklärt, wobei der Fokus auf dem Ermöglichen einer umfassenden und selbstbestimmten Erzählung liegt.
6. Zur Auswertung von autobiographischen Stegreiferzählungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Auswertung der im narrativen Interview gewonnenen Daten. Es beschreibt die Schritte der Auswertung, die den Analyseprozess der autobiographischen Erzählungen systematisieren. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Erzählungen unter Berücksichtigung der sequentiellen Abfolge von Ereignissen und deren Bedeutung im Lebenslauf.
7. Die Prozessstruktur der Verlaufskurve: Dieses Kapitel behandelt die Analyse der Prozessstrukturen innerhalb des Lebenslaufes. Es beschreibt die Methode der Verlaufskurve zur Darstellung von Veränderungen und Entwicklungen im Laufe der Zeit und ihre Bedeutung für das Verständnis der erzählten Lebensgeschichte. Der Fokus liegt auf der Erfassung von dynamischen Prozessen und deren Darstellung im Kontext der biographischen Erzählung.
8. Alternativen der Analyse und Auswertung autobiographisch-narrativer Interviews: Dieses Kapitel diskutiert alternative Ansätze und Methoden zur Analyse und Auswertung narrativer Interviews. Es beschreibt verschiedene Perspektiven und Herangehensweisen, um die Komplexität der gewonnenen Daten adäquat zu berücksichtigen. Der Fokus liegt auf der methodischen Reflexion und dem Bewusstsein für die Vielfalt der Analysemethoden.
Schlüsselwörter
Narratives Interview, Biographieforschung, Lebenslaufanalyse, qualitative Methoden, Erzählforschung, Prozessstrukturen, Lebensgeschichte, Auswertung, Sequenzanalyse, Selbstpräsentation.
Häufig gestellte Fragen zum narrativen Interview
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das narrative Interview als Methode der Biographieforschung. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, und abschließend Schlüsselwörter.
Worum geht es in Kapitel 1 ("Warum ein Interesse an Lebensläufen besteht")?
Kapitel 1 beleuchtet das wissenschaftliche Interesse an Lebensläufen und betont die Bedeutung von Prozessstrukturen und individuellen Deutungsmustern bei der Gestaltung der Lebensgeschichte. Es begründet die Notwendigkeit einer Methode wie dem narrativen Interview zur Erforschung dieser komplexen Zusammenhänge.
Woher stammt die Methode des narrativen Interviews (Kapitel 2)?
Kapitel 2 beschreibt die Entstehung des narrativen Interviews in Deutschland durch Fritz Schütze und Kollegen, ordnet es in den Kontext der qualifizierten Verfahren der 1970er Jahre ein und hebt den methodologischen Hintergrund und die theoretischen Annahmen hervor.
Welche allgemeinen Merkmale kennzeichnen das narrative Interview (Kapitel 3)?
Kapitel 3 beschreibt die Fähigkeit des narrativen Interviews, lückenlos Ereignisverstrickungen und Erfahrungsaufschichtungen zu reproduzieren. Es betont die Offenheit der Methode und den Fokus auf die Generierung umfassender Erzählungen.
Wie sieht der formale Ablauf eines narrativen Interviews aus (Kapitel 4)?
Kapitel 4 befasst sich mit den formalen Aspekten der Durchführung, wie flexiblem Fragenkatalog, Vermeidung von Druck, Anonymität, Vertrauensaufbau und der Rolle des Interviewers als Stichwortgeber und Zuhörer.
Wie ist ein narratives Interview aufgebaut (Kapitel 5)?
Kapitel 5 beschreibt den strukturellen Aufbau, beginnend mit der Erzählaufforderung, über die Erzählphase bis zum Interviewabschluss. Es erklärt den Aufbau des Interviews in Erzählphase und Nachfragephase.
Wie werden autobiographische Stegreiferzählungen ausgewertet (Kapitel 6)?
Kapitel 6 beschreibt die Schritte der Auswertung autobiographischer Erzählungen, die den Analyseprozess systematisieren und die Interpretation der Erzählungen unter Berücksichtigung der sequentiellen Abfolge von Ereignissen im Lebenslauf betreffen.
Was versteht man unter der Prozessstruktur der Verlaufskurve (Kapitel 7)?
Kapitel 7 behandelt die Analyse von Prozessstrukturen im Lebenslauf mithilfe der Verlaufskurve zur Darstellung von Veränderungen und Entwicklungen über die Zeit.
Welche Alternativen gibt es zur Analyse und Auswertung narrativer Interviews (Kapitel 8)?
Kapitel 8 diskutiert alternative Ansätze und Methoden zur Analyse und Auswertung, um die Komplexität der gewonnenen Daten adäquat zu berücksichtigen und die methodische Reflexion zu fördern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt dieses Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Narratives Interview, Biographieforschung, Lebenslaufanalyse, qualitative Methoden, Erzählforschung, Prozessstrukturen, Lebensgeschichte, Auswertung, Sequenzanalyse, Selbstpräsentation.
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Das Dokument beschreibt das narrative Interview als Forschungsmethode in den Sozialwissenschaften, fokussiert auf die Erhebung und Auswertung von Lebensgeschichten. Ziel ist die detaillierte Darstellung der Methode, ihrer Anwendung und der damit verbundenen analytischen Prozesse.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Meyer (Autor:in), 2010, Das narratives Interview. Herkunft, Merkmale, Aufbau und Auswertung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/412702