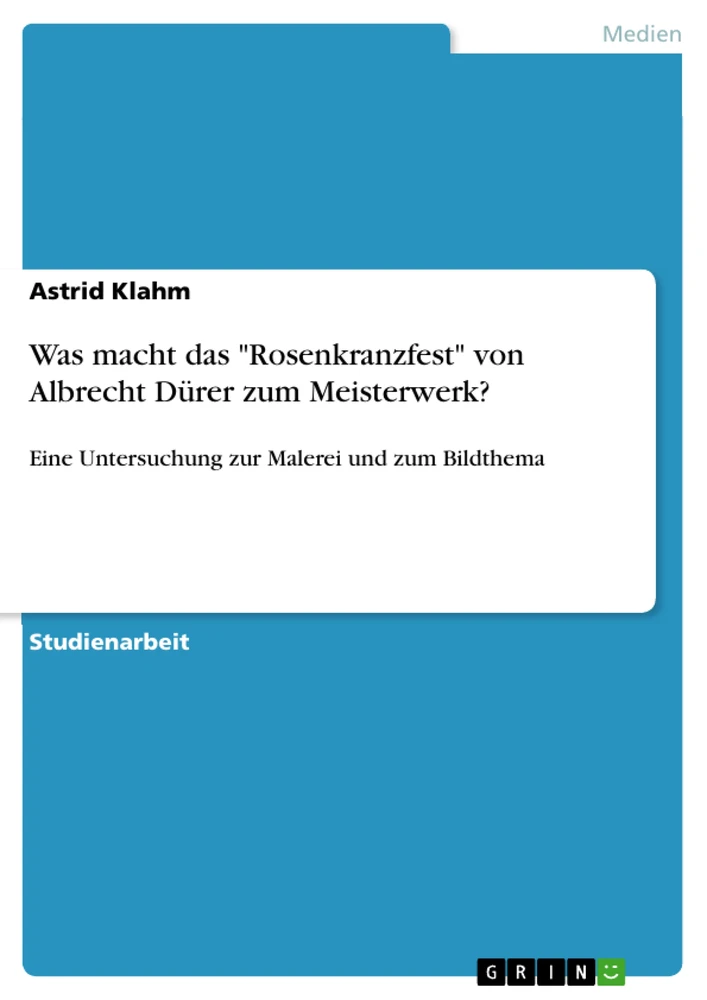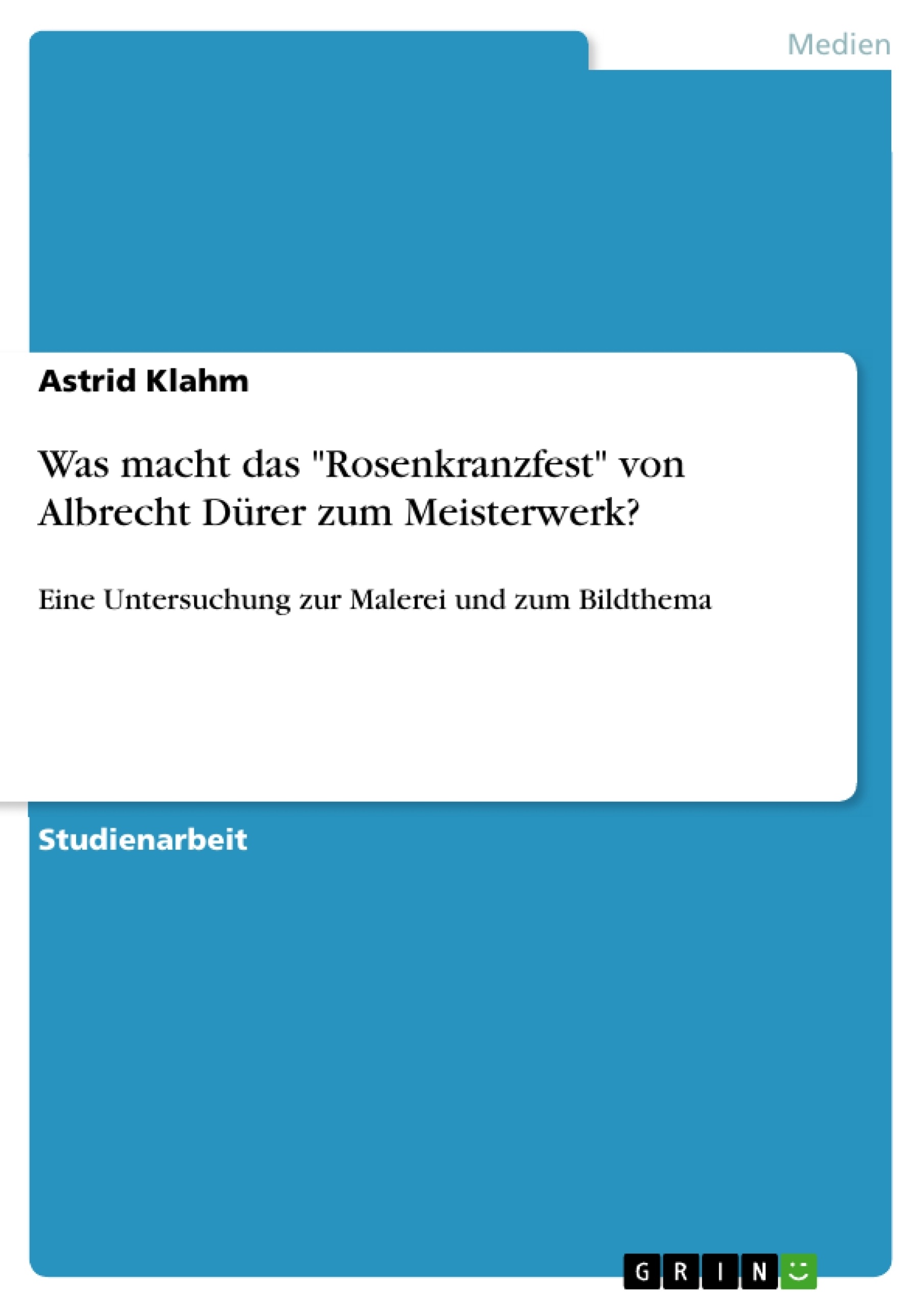Im Herbst 1505 flüchtete Albrecht Dürer zum zweiten Mal vor der Pest aus Nürnberg nach Venedig. Bereits 1494 hatte er den Pestausbruch in seiner Heimatstadt genutzt, um eine Italienreise anzutreten. Die Lagunenstadt galt als wichtiges Fernhandelsziel der deutschen Kaufmannsfamilien, so dass Dürer auf Hilfe und Unterstützung in der Fremde von Seiten seiner Landsleute hoffen konnte. Kurz nach seiner Ankunft in Venedig bestellten sie bei ihm ein Marienbild für einen der Nebenaltäre ihrer Grabeskirche San Bartolomeo . Der Anlass des Bildauftrages kann wohl mit dem Wiederaufbau des deutschen Kauf-, Lager- und Wohnhauses, dem Fondaco dei Tedeschi an der Rialtobrücke und nahe der Kirche San Bartolomeo in Verbindung gebracht werden, der 1505 bei einem Brand zerstört worden war. Hundert Jahre später, im Frühjahr 1606 erwarb der Venezianer Sekretär Bernhardino Rossi das Gemälde Rosenkranzfest im Auftrag von Kaisers Rudolf II. (1552-1612) für die kaiserliche Sammlung in Prag. Nachdem das Gemälde in Teppich, Baumwolle und Leinwand eingepackt worden war, wurde es auf einer eigens angefertigten Trage, auf den Schultern vier starker Männer über die Alpenpässe getragen, damit es keinen Erschütterungen von einem Fuhrwerk ausgesetzt werden musste.
Aber bereits nach den Verzeichnissen der Prager Schatz- und Kunstkammer von 1718 bis 1763 galt das Rosenkranzfest wegen der nachlässigen Aufbewahrung während des Dreißigjährigen Krieges als stark verdorben. Eine Zeitlang glaubte man sogar, es sei verschollen. Nach einer alten Überlieferung soll das Gemälde als Regenschutz für eine Dachluke der Prager Burg gedient haben, bis es 1782 zufällig wieder entdeckt worden war. Es folgten zahlreiche Besitzerwechsel und eine - wohl mehr schlechte als rechte – Restaurierung 1841 von Johann Grusz. Der tschechische Staat erwarb das Gemälde 1930.
Heute befindet sich das Rosenkranzfest in einem schlechten Zustand. Anhand der 22 erhaltenen Skizzen von Albrecht Dürer wurde versucht, das ursprüngliche Aussehen einiger Bildflächen zu rekonstruieren, so dass große Teile nicht mehr als authentisch angesehen werden können. Einen aussagekräftigen Vergleich gibt Heinrich Musper, der das Berliner Gemälde Madonna mit dem Zeisig in einem besseren Zustand als das Rosenkranzfest wähnt. Vor allem sei die leuchtende Farbigkeit bei der Zeisigmadonna besser als im Rosenkranzfest nachzuvollziehen. Der heutige Bildtitel ist eine Zugabe des 19. Jahrhunderts.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Das Rosenkranzfest
- Die Beschreibung
- Thesen
- Der historische Kontext
- Das Rosenkranzfest – ein politisches Gemälde?
- Die Botschaft in der Hand
- Das Bildthema: das Verteilen von Rosenkränzen an eine christliche Gemeinde
- Die Rosenkranzgebetsschnur und deren symbolische Deutung
- Die Rosenkranzbruderschaft
- Der Einfluss der nordalpinen Malerei
- Der ikonographische Bildtypus der Rosenkranzbruderschaft
- Die Anbetung der Heiligen drei Könige von Stefan Lochner
- Der Einfluss der venezianischen Malerei
- Die Sacra Conversazione mit vier Heiligen und das Votivbild des Dogen Agostino Barbarigo von Giovanni Bellini
- Die venezianische Farbigkeit
- Innovation und Tradition im Rosenkranzfest
- Die Kleinwelt der Natur
- Das Gruppenbildnis
- Die Verschmelzung von venezianischer und nordalpiner Malerei
- Resümee
- Die Gleichberechtigung vor Gott im Rosenkranzfest – Ein Versuch
- ,,Der Himmel steigt auf die Erde herab¹"
- Der sakrale und profane Appell
- Liste der Abbildungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Albrecht Dürers „Rosenkranzfest“ von 1506 und erforscht, welche Elemente dieses Werk zum Meisterwerk machen. Die Untersuchung beleuchtet die Maltechnik, das Bildthema und den historischen Kontext des Gemäldes.
- Das Rosenkranzfest als Marienbild und seine politische Symbolik
- Die Bedeutung des Rosenkranzes und der Rosenkranzbruderschaft
- Der Einfluss der nordalpinen und venezianischen Malerei auf Dürers Stil
- Die innovative Komposition des Gemäldes und seine Verbindung von Tradition und Moderne
- Die Interpretation der Darstellung von Papst Julius II. und Kaiser Maximilian I.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Leben und Werk Albrecht Dürers und beleuchtet den Entstehungshintergrund des „Rosenkranzfestes“. Im zweiten Kapitel wird das Gemälde detailliert beschrieben, wobei der Fokus auf der Komposition, den Figuren und der Symbolik liegt. Kapitel 3 widmet sich dem historischen Kontext des Gemäldes und untersucht die politische Bedeutung des Rosenkranzfestes. In Kapitel 4 wird das Bildthema näher beleuchtet, einschließlich der symbolischen Deutung des Rosenkranzes und der Rolle der Rosenkranzbruderschaft. Die Kapitel 5 und 6 analysieren den Einfluss der nordalpinen und venezianischen Malerei auf Dürers Werk. Kapitel 7 befasst sich mit den innovativen Elementen des „Rosenkranzfestes“ und der Verbindung von Tradition und Moderne. Der Abschluss der Arbeit, der hier nicht zusammengefasst wird, bietet eine Gesamtschau der Ergebnisse und interpretiert die zentrale Botschaft des Gemäldes.
Schlüsselwörter
Albrecht Dürer, Rosenkranzfest, Marienbild, politisches Gemälde, Rosenkranz, Rosenkranzbruderschaft, nordalpine Malerei, venezianische Malerei, Innovation, Tradition, Papst Julius II., Kaiser Maximilian I., Kunstgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Astrid Klahm (Autor:in), 2008, Was macht das "Rosenkranzfest" von Albrecht Dürer zum Meisterwerk?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/412087