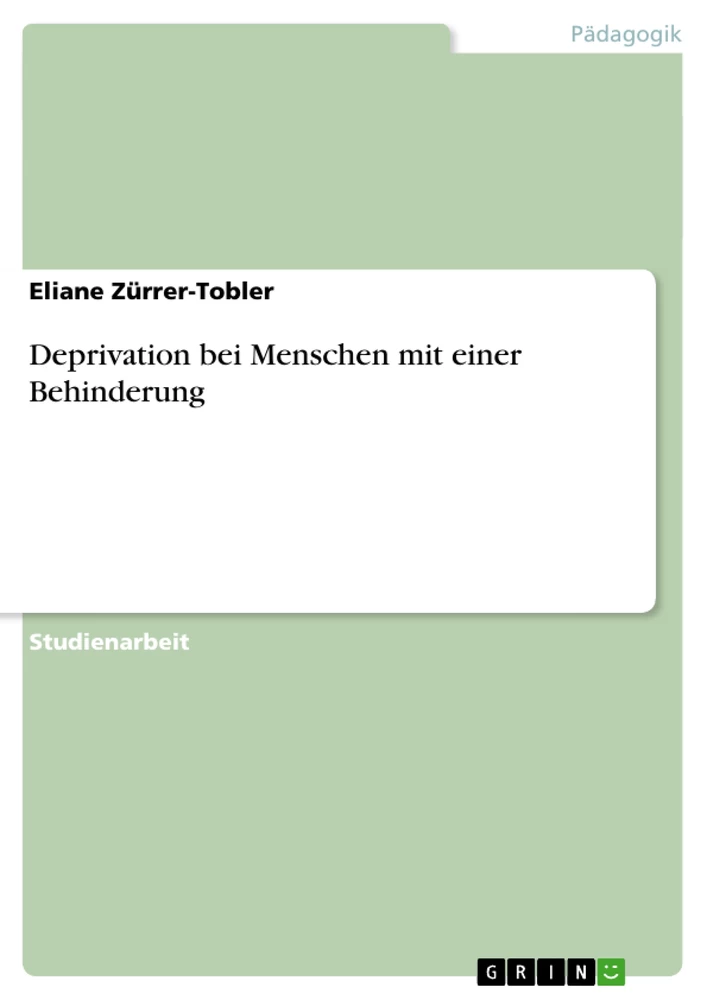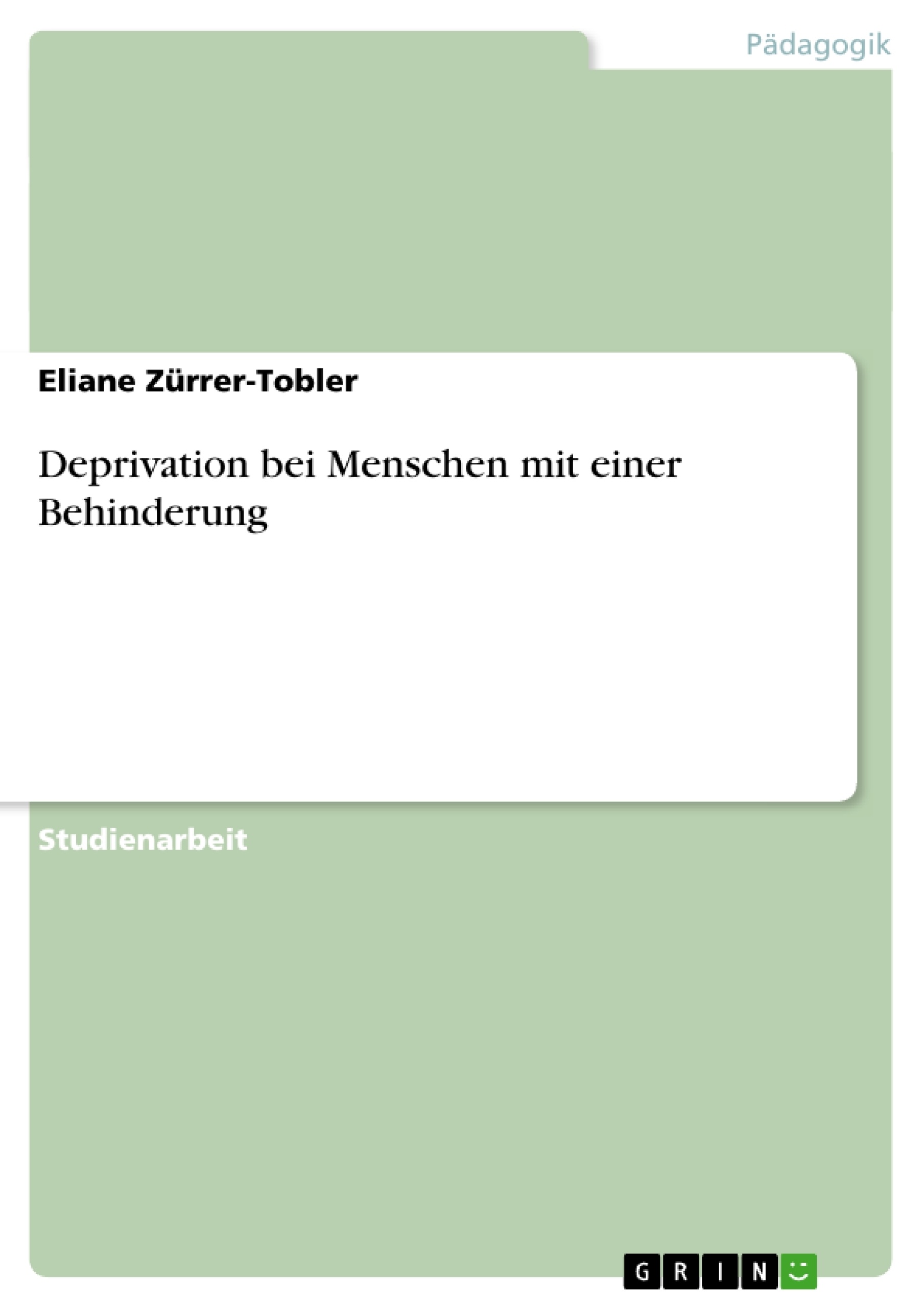Anfangs des 20. Jahrhunderts starben in den Findelhäusern Deutschlands rund 70% der Säuglinge. (vgl. Spitz 1969, 77) Die Tatsache, dass Kinder aufgrund deprivierender Lebensbedingungen sterben können ist erschreckend. Auch behinderte Menschen litten während des letzten Jahrhunderts unter enorm isolierenden und deprivierenden Bedingungen. Die Enthospitalisierungs- und Normalisierungsdebatte haben dazu beigetragen, die Lebensumstände von behinderten Menschen stark zu verbessern. Doch gibt es heute wirklich keine deprivierende Faktoren mehr? Ist Deprivation bei Menschen mit Behinderung im 21. Jahrhundert kein Thema mehr? Solche und ähnliche Überlegungen liessen mich folgende Fragestellung formulieren: ‚Inwiefern ist Deprivation bei Menschen mit einer Behinderung ein heute noch aktuelles Thema?’ Anhand folgender Arbeit möchte ich verschiedene Faktoren zusammentragen, welche die Aktualität des Themas deutlich machen. Als Einstieg dient eine Definition des Begriffes Deprivation. Da es einige eng mit Deprivation verwandte Begriffe gibt, scheint eine anschliessende Begriffsklärung notwendig. Folgend verschafft das vierte Kapitel einen Überblick über die Geschichte der Deprivationsforschung. Dabei werden auch die Lebensbedingungen behinderter Menschen im letzten Jahrhundert betrachtet. Anschliessend gehet das Fünfte Kapitel auf verschiedene, aktuelle Risikofaktoren für Deprivation bei Menschen mit einer Behinderung ein. Die folgenden Kapiteln beschäftigen sich mit den Folgen und der Prävention von Deprivation. In der Schlussfolgerung wird obige Fragestellung beantwortet. Literarisch stützt sich die Arbeit auf verschiedene Bücher und Artikel zum Thema. Dabei beziehe ich mich vor allem auf die Werke von Theunissen (1991, 1999) und eine Studie von M. Seifert (2002). Leider gibt es nur wenig aktuelle Literatur zum Thema.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Begriffsklärung
- Geschichtlicher Überblick
- Beginn der Hospitalismusforschung
- Die Klassische Deprivationslehre
- Die Versorgung behinderter Menschen im 20. Jahrhundert
- Deprivation bei Menschen mit einer Behinderung heute
- Aktuelle Risikofaktoren für Deprivation bei Menschen mit einer Behinderung
- Krankenhausaufenthalte
- Mutter-Kind Bindung
- Heimunterbringung
- Einschränkung der Mobilität
- Einschränkung der Kommunikation
- Einschränkung der Wahrnehmung
- Soziale Ausgrenzung
- Modell zur Entstehung von Deprivation bei Menschen mit einer Behinderung
- Folgen der Deprivation bei Menschen mit einer Behinderung
- Prävention/Therapie von Deprivation bei Menschen mit einer Behinderung
- Basale Stimulation
- Unterstütze Kommunikation
- Gesellschaftliche Ebene
- Aktuelle Risikofaktoren für Deprivation bei Menschen mit einer Behinderung
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Aktualität von Deprivation bei Menschen mit Behinderung im 21. Jahrhundert. Die Arbeit analysiert historische Entwicklungen und beleuchtet aktuelle Risikofaktoren, um die Bedeutung des Themas zu verdeutlichen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Deprivation
- Historischer Überblick über Deprivationsforschung und die Lebensbedingungen behinderter Menschen
- Identifizierung aktueller Risikofaktoren für Deprivation bei Menschen mit Behinderung
- Analyse der Folgen von Deprivation
- Möglichkeiten der Prävention und Therapie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht, inwiefern Deprivation bei Menschen mit Behinderung ein aktuelles Thema ist. Ausgehend von der hohen Säuglingssterblichkeit in Findelhäusern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wird die Fragestellung formuliert und der Aufbau der Arbeit skizziert, der eine Definition, Begriffsklärung, historische Einordnung und die Analyse aktueller Risikofaktoren umfasst. Die Arbeit stützt sich auf ausgewählte Literatur, wobei die begrenzte Verfügbarkeit aktueller Literatur erwähnt wird.
Definition: Es wird die Definition von Deprivation aus der Enzyklopädie der Sonderpädagogik zitiert. Diese Definition hebt die Bedeutung des Entzugs von primären und sekundären Bedürfnissen hervor, unterscheidet zwischen sensorischer und sozialer Deprivation und erklärt den Begriff der relativen sozialen Deprivation. Die verschiedenen Facetten des Begriffs werden hervorgehoben.
Begriffsklärung: Dieses Kapitel grenzt Deprivation von verwandten Begriffen ab, insbesondere Hospitalismus (psychischer und infektiöser) und Vernachlässigung. Es wird der historische Kontext des Hospitalismus und seine heutige, eher seltene Verwendung im Vergleich zum Begriff Deprivation erläutert. Der Unterschied zwischen Vernachlässigung (Täterfokus) und Deprivation (Opferfokus) wird deutlich gemacht.
Geschichtlicher Überblick: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Geschichte der Deprivationsforschung, beginnend mit der Hospitalismusforschung. Die klassische Deprivationslehre und die Lebensbedingungen behinderter Menschen im 20. Jahrhundert werden beleuchtet, um den historischen Kontext der Thematik zu verdeutlichen und den Weg zu heutigen Überlegungen zu ebnen.
Deprivation bei Menschen mit einer Behinderung heute: Dieses Kapitel befasst sich mit aktuellen Risikofaktoren wie Krankenhausaufenthalten, Problemen der Mutter-Kind-Bindung, Heimunterbringung, eingeschränkter Mobilität, Kommunikation und Wahrnehmung sowie sozialer Ausgrenzung. Ein Modell zur Entstehung von Deprivation wird vorgestellt, gefolgt von einer Diskussion der Folgen und der Prävention/Therapie, einschließlich basaler Stimulation, unterstützter Kommunikation und gesellschaftlicher Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Deprivation, Behinderung, Hospitalismus, Vernachlässigung, Risikofaktoren, Mutter-Kind-Bindung, soziale Ausgrenzung, Prävention, Therapie, Basale Stimulation, Unterstützte Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Deprivation bei Menschen mit Behinderung
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Aktualität von Deprivation bei Menschen mit Behinderung im 21. Jahrhundert. Sie analysiert historische Entwicklungen und beleuchtet aktuelle Risikofaktoren, um die Bedeutung des Themas zu verdeutlichen.
Welche Aspekte werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Definition und Abgrenzung des Begriffs Deprivation, einen historischen Überblick über Deprivationsforschung und die Lebensbedingungen behinderter Menschen, die Identifizierung aktueller Risikofaktoren für Deprivation bei Menschen mit Behinderung, eine Analyse der Folgen von Deprivation und Möglichkeiten der Prävention und Therapie.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Definition und Begriffsklärung von Deprivation, einen geschichtlichen Überblick (Hospitalismusforschung, klassische Deprivationslehre, Versorgung im 20. Jahrhundert), einen Schwerpunkt auf Deprivation bei Menschen mit Behinderung heute (Risikofaktoren wie Krankenhausaufenthalte, Mutter-Kind-Bindung, Heimunterbringung etc., Folgen und Präventions- und Therapieansätze), und eine Schlussfolgerung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Risikofaktoren für Deprivation bei Menschen mit Behinderung werden genannt?
Die Arbeit nennt folgende aktuelle Risikofaktoren: Krankenhausaufenthalte, Probleme der Mutter-Kind-Bindung, Heimunterbringung, eingeschränkte Mobilität, Kommunikation und Wahrnehmung sowie soziale Ausgrenzung.
Welche Präventions- und Therapieansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert basale Stimulation, unterstützte Kommunikation und gesellschaftliche Maßnahmen als Präventions- und Therapieansätze.
Wie wird Deprivation definiert?
Die Arbeit verwendet eine Definition aus der Enzyklopädie der Sonderpädagogik, die den Entzug von primären und sekundären Bedürfnissen betont und zwischen sensorischer und sozialer Deprivation sowie relativer sozialer Deprivation unterscheidet.
Wie wird Deprivation von Hospitalismus und Vernachlässigung abgegrenzt?
Der Unterschied zwischen Deprivation (Opferfokus) und Vernachlässigung (Täterfokus) wird herausgestellt. Hospitalismus (psychischer und infektiöser) wird historisch eingeordnet und im Unterschied zu Deprivation als heute eher selten verwendeter Begriff dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Deprivation, Behinderung, Hospitalismus, Vernachlässigung, Risikofaktoren, Mutter-Kind-Bindung, soziale Ausgrenzung, Prävention, Therapie, Basale Stimulation, Unterstützte Kommunikation.
Gibt es ein Inhaltsverzeichnis?
Ja, die HTML-Datei enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit Unterpunkten.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, welche die Kernaussagen jedes Kapitels kurz und prägnant beschreiben.
- Quote paper
- lic. phil. Eliane Zürrer-Tobler (Author), 2005, Deprivation bei Menschen mit einer Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/40941