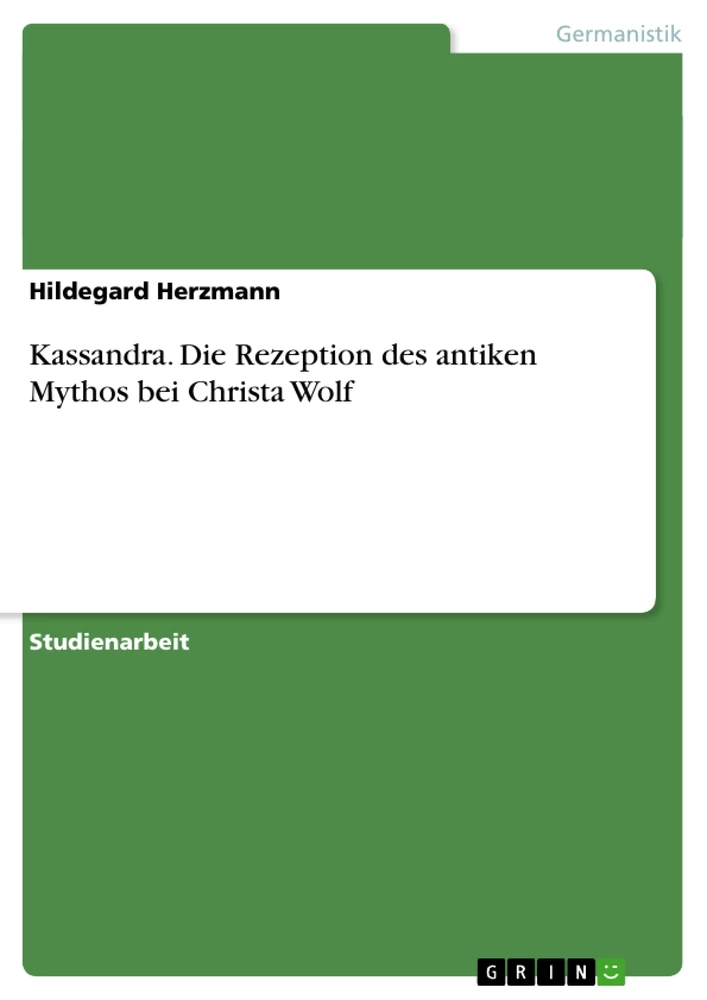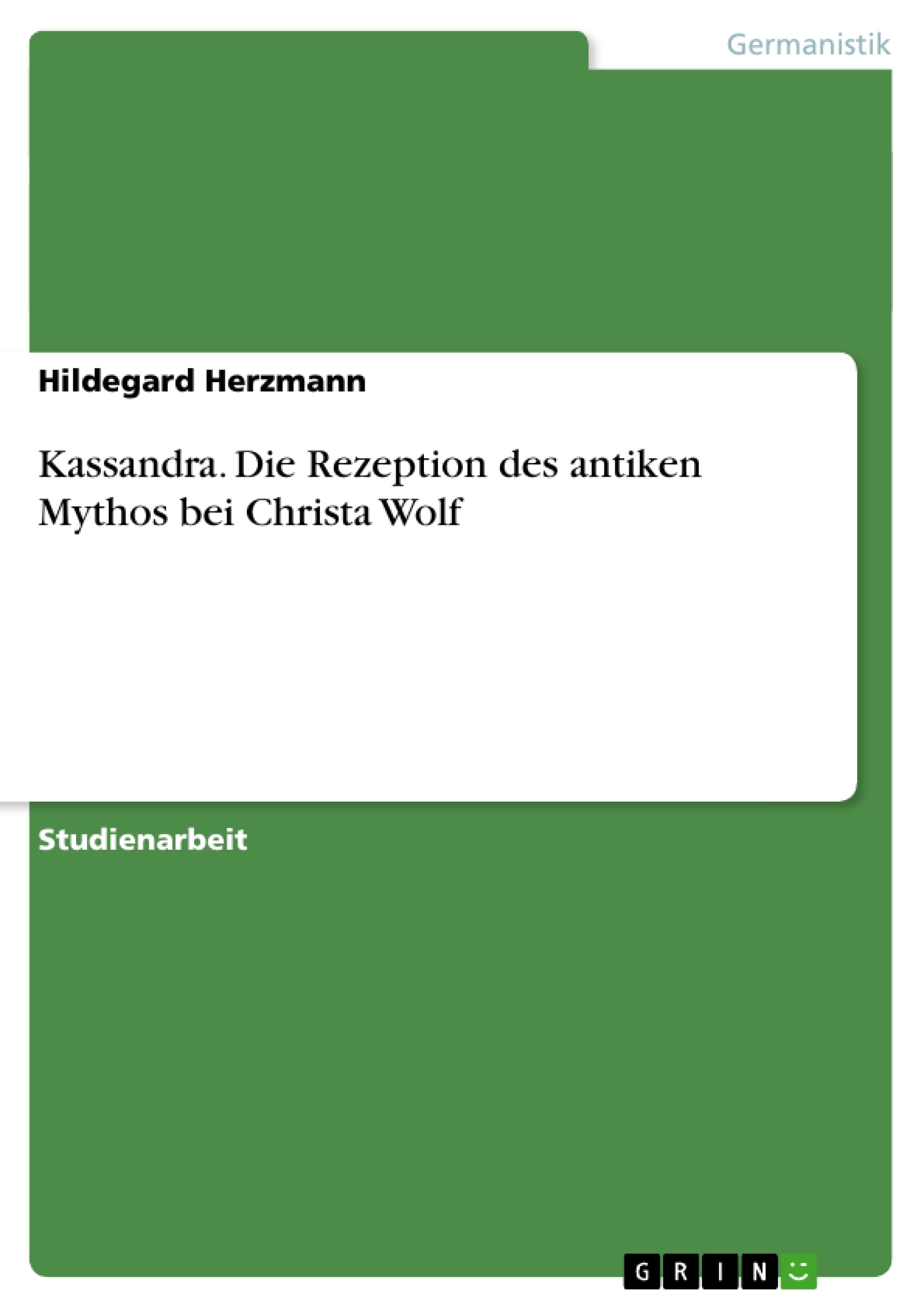Mythen weisen in die Urzeit von Völkern zurück. Entstanden vermutlich aus "Heiligen Reden" einzelner Kultgötter, wurden diese zu geschlossenen Biographien der jeweiligen Götter, später zu Erzählungen über ein ganzes System von Göttern. Damit ist der Schritt vom Glauben zum Mythos vollzogen, wobei der Begriff zunächst nur bedeutet, dass es sich um gesprochene Rede beliebigen Inhalts handelt. Er entwickelte sich dann aber im Gegensatz zum Logos, der immer die Wahrheit zu sagen beansprucht, zum Begriff der unverbindlichen dichterischen Erfindung. Dies mag mit der Tatsache zusammenhängen, dass Mythen jahrhundertelang ausschließlich mündlich überliefert wurden. Etwa zu Beginn des 7. vorchristlichen Jahrhunderts wurde der Stoff vieler verschiedener Mythen in Griechenland kunstvoll verflochten und schriftlich festgehalten, zuerst von einer Person, die mit Homer identifiziert wurde, dann von Hesiod, der als erster versuchte, den mythischen Stoff systematisch zu ordnen. Damit endete die mündliche Überlieferung und der Mythos, in Zukunft vielfach verwendet und auch ausgeweitet in der attischen Tragödie und der hellenistischen Epik, blieb von da an im Kern unverändert.
Versteht man Mythen als erste Versuche, auf die existentiellen Fragen der Menschen nach Sinn, Sicherheit und Gültigkeit bestimmter Werte zu antworten, so wird ihre zeitlose, bis in die Gegenwart wirkende Anziehungskraft verständlich. Und noch immer sind es die antiken Mythen, denen,wieder und wieder rezipiert und umgestaltet, der Rang von Vorlagen zugewachsen ist.
Ein zeitgenössisches Werk, das besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist Christa Wolfs Erzählung "Kassandra", erschienen 1983, begleitet von den 1982 in Frankfurt a.M. gehaltenen Poetik-Vorlesungen mit dem Titel "Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra", die den theoretischen Rahmen des literarischen Werks bilden. Beide Schriften sollen im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen und unter der Fragestellung betrachtet werden, aus welchen Motiven heraus eine zeitgenössische, damals in der DDR lebende Schriftstellerin einen antiken Mythenstoff aufgreift, in welches Verhältnis sie sich zu ihm begibt und in welcher Weise sie ihn ausgestalten will. Im zweiten Teil wird anhand von ausgewählten Beispielen aus der Erzählung dargestellt werden, wie sie ihre theoretischen Überlegungen in die künstlerische Praxis umsetzt. Ein Blick in die literaturwissenschaftliche Beurteilung beider Werke schließt die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Entstehung und Entwicklung des Mythos
- „Voraussetzungen einer Erzählung”
- Christa Wolfs Auseinandersetzung mit dem mythischen Stoff
- Motive für die Bearbeitung des Stoffs
- Die Art und Weise der Ausgestaltung
- Subjektivierung des Erzählens
- Historisierung des Materials
- „Kassandra”
- Deutung der Erzählung unter geschichtsphilosophischem Aspekt – Der Übergang von matriarchalischen zu patriarchalischen Lebensformen
- Deutung der Erzählung unter individualpsychologischem Aspekt – Die Entwicklung der Protagonistin
- „Kassandra” – eine Allegorie des 20. Jahrhunderts
- Die Gegenwelt am Skamander - ein Modell für die Zukunft
- Die Erzählung im Spiegel der Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Christa Wolfs Erzählung „Kassandra“ und die dazugehörigen „Voraussetzungen einer Erzählung“. Ziel ist es, die Motive für Wolfs Auseinandersetzung mit dem antiken Mythenstoff zu beleuchten, ihre Gestaltungsmethoden zu analysieren und die Rezeption des Werkes in der Literaturkritik zu betrachten.
- Christa Wolfs persönliche Motive und ihre gesellschaftlich-politische Kritik im Kontext der DDR.
- Die literarische Gestaltung des antiken Stoffes und die Subjektivierung der Erzählperspektive.
- Die geschichtsphilosophische und individualpsychologische Deutung von Wolfs „Kassandra“.
- Der Vergleich mit den antiken Quellen (Homer, Aischylos) und die kritische Auseinandersetzung mit deren Darstellung.
- Die Rezeption von Wolfs Werk in der Literaturkritik.
Zusammenfassung der Kapitel
Entstehung und Entwicklung des Mythos: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Kassandra-Mythos von seinen urzeitlichen Wurzeln in religiösen Kulten bis hin zu seiner schriftlichen Fixierung durch Homer und Hesiod. Es wird die Transformation des Mythos von mündlicher Überlieferung zu einem festen literarischen Kanon beschrieben und die Bedeutung der verschiedenen Quellen und Interpretationen herausgestellt. Die Entwicklung verdeutlicht die Wandelbarkeit und Anpassungsfähigkeit von Mythen im Laufe der Geschichte, sowie die Schwierigkeit, einen "ursprünglichen" Kern zu identifizieren. Der Kapitelverlauf zeichnet die Entwicklung des Mythos nach und betont dessen andauernde Relevanz und Anpassungsfähigkeit.
„Voraussetzungen einer Erzählung”: Dieser Abschnitt analysiert Christa Wolfs Auseinandersetzung mit dem Kassandra-Mythos. Er untersucht die Einflüsse von Aischylos' Orestie und Homers Ilias auf Wolfs Werk, wobei der Fokus auf Wolfs kritischer Distanz zu den patriarchalen Strukturen und der männlich dominierten Erzählperspektive der antiken Epen liegt. Der Abschnitt beleuchtet Wolfs Motivationen, den Mythos neu zu interpretieren, ihre persönlichen Erlebnisse und den gesellschaftlich-politischen Kontext der DDR. Wolf nutzt den Mythos, um ihre eigenen kritischen Beobachtungen zur politischen Lage und gesellschaftlichen Strukturen zu verdeutlichen, was den historischen und individuellen Aspekt der Arbeit herausstellt.
„Kassandra”: Das Kapitel fasst die einzelnen Aspekte von Christa Wolfs Erzählung zusammen. Es werden die geschichtsphilosophischen und individualpsychologischen Aspekte des Textes erörtert: Kassandras Schicksal wird als Allegorie des 20. Jahrhunderts und insbesondere der Erfahrungen von Frauen interpretiert. Die Vorstellung einer "Gegenwelt am Skamander" wird als Utopie und Vision einer alternativen Zukunft analysiert. Der Fokus liegt auf der Synthese der verschiedenen Deutungsebenen und der Gesamtwirkung der Erzählung. Die Kapitelzusammenfassung betont die multiplen Interpretationsebenen und die zeitlose Relevanz von Wolfs Interpretation des Mythos.
Die Erzählung im Spiegel der Kritik: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Rezeption von Christa Wolfs „Kassandra“ und „Voraussetzungen einer Erzählung“ in der Literaturkritik. Es werden verschiedene Interpretationsansätze und Rezensionen vorgestellt und bewertet, ohne jedoch auf konkrete Einzelmeinungen oder detaillierte Kritik einzugehen.
Schlüsselwörter
Kassandra, Christa Wolf, Antiker Mythos, Patriarchat, Matriarchat, Geschichtsphilosophie, Individualpsychologie, DDR, Gesellschaftkritik, Literaturkritik, Säkularisierung, Mythenrezeption, Allegorie, Utopie.
Häufig gestellte Fragen zu Christa Wolfs "Kassandra"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Christa Wolfs Erzählung "Kassandra" und den einleitenden Essay "Voraussetzungen einer Erzählung". Der Fokus liegt auf Wolfs Motiven für die Auseinandersetzung mit dem antiken Mythenstoff, ihren Gestaltungsmethoden und der Rezeption des Werkes in der Literaturkritik.
Welche Themen werden in "Kassandra" behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte von "Kassandra", darunter die geschichtsphilosophische und individualpsychologische Deutung des Mythos. Es wird Kassandras Schicksal als Allegorie des 20. Jahrhunderts interpretiert, insbesondere im Hinblick auf die Erfahrungen von Frauen. Die "Gegenwelt am Skamander" wird als Utopie und Vision einer alternativen Zukunft analysiert.
Welche Aspekte von Christa Wolfs Werk werden im Einzelnen betrachtet?
Die Analyse umfasst Christa Wolfs persönliche Motive und ihre gesellschaftlich-politische Kritik im Kontext der DDR, die literarische Gestaltung des antiken Stoffes und die Subjektivierung der Erzählperspektive, den Vergleich mit antiken Quellen (Homer, Aischylos) und die kritische Auseinandersetzung mit deren Darstellung sowie die Rezeption von Wolfs Werk in der Literaturkritik.
Wie wird der Kassandra-Mythos in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit verfolgt die Entstehung und Entwicklung des Kassandra-Mythos von seinen religiösen Ursprüngen bis zu seiner literarischen Fixierung. Sie beschreibt die Transformation des Mythos und betont dessen Wandelbarkeit und andauernde Relevanz. Besonderes Augenmerk liegt auf Wolfs kritischer Distanz zu den patriarchalen Strukturen der antiken Erzählungen und ihrer Neuinterpretation des Mythos.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel "Entstehung und Entwicklung des Mythos", "Voraussetzungen einer Erzählung", "Kassandra" und "Die Erzählung im Spiegel der Kritik". Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Erzählung und ihrer Entstehung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Kassandra, Christa Wolf, Antiker Mythos, Patriarchat, Matriarchat, Geschichtsphilosophie, Individualpsychologie, DDR, Gesellschaftkritik, Literaturkritik, Säkularisierung, Mythenrezeption, Allegorie, Utopie.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Motive für Wolfs Auseinandersetzung mit dem antiken Mythenstoff zu beleuchten, ihre Gestaltungsmethoden zu analysieren und die Rezeption ihres Werkes in der Literaturkritik zu betrachten. Es geht um eine umfassende Analyse von "Kassandra" im Kontext ihrer Entstehungszeit und Rezeption.
Wie wird die Rezeption von "Kassandra" behandelt?
Die Arbeit bietet einen Überblick über die Rezeption von Christa Wolfs "Kassandra" und "Voraussetzungen einer Erzählung" in der Literaturkritik. Verschiedene Interpretationsansätze und Rezensionen werden vorgestellt, ohne auf konkrete Einzelmeinungen oder detaillierte Kritik einzugehen.
- Quote paper
- Hildegard Herzmann (Author), 2005, Kassandra. Die Rezeption des antiken Mythos bei Christa Wolf, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/40849