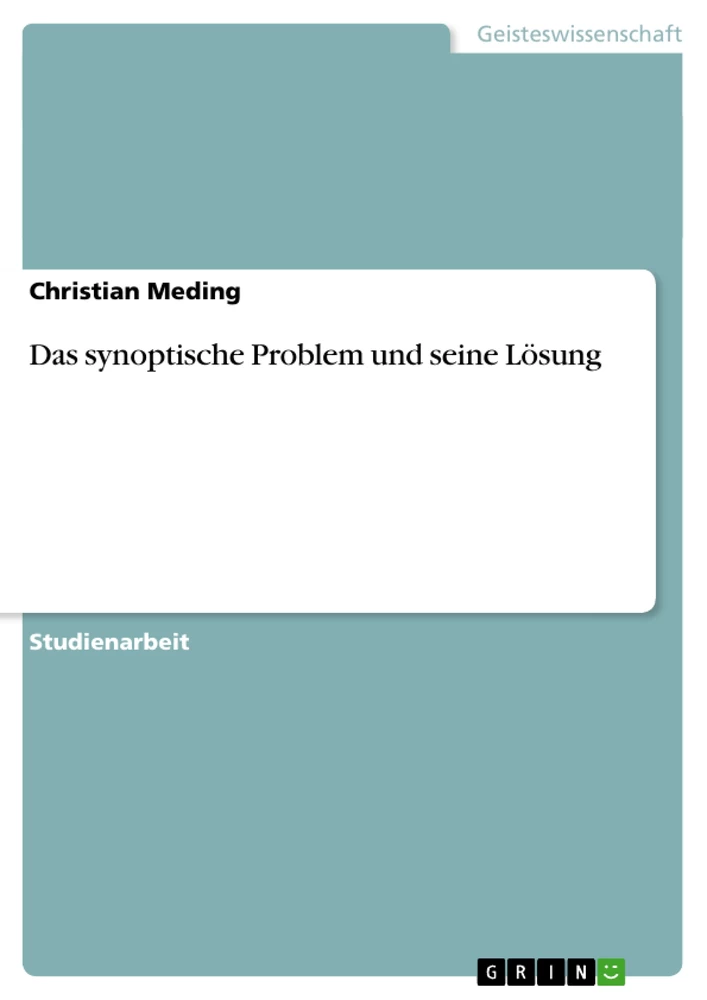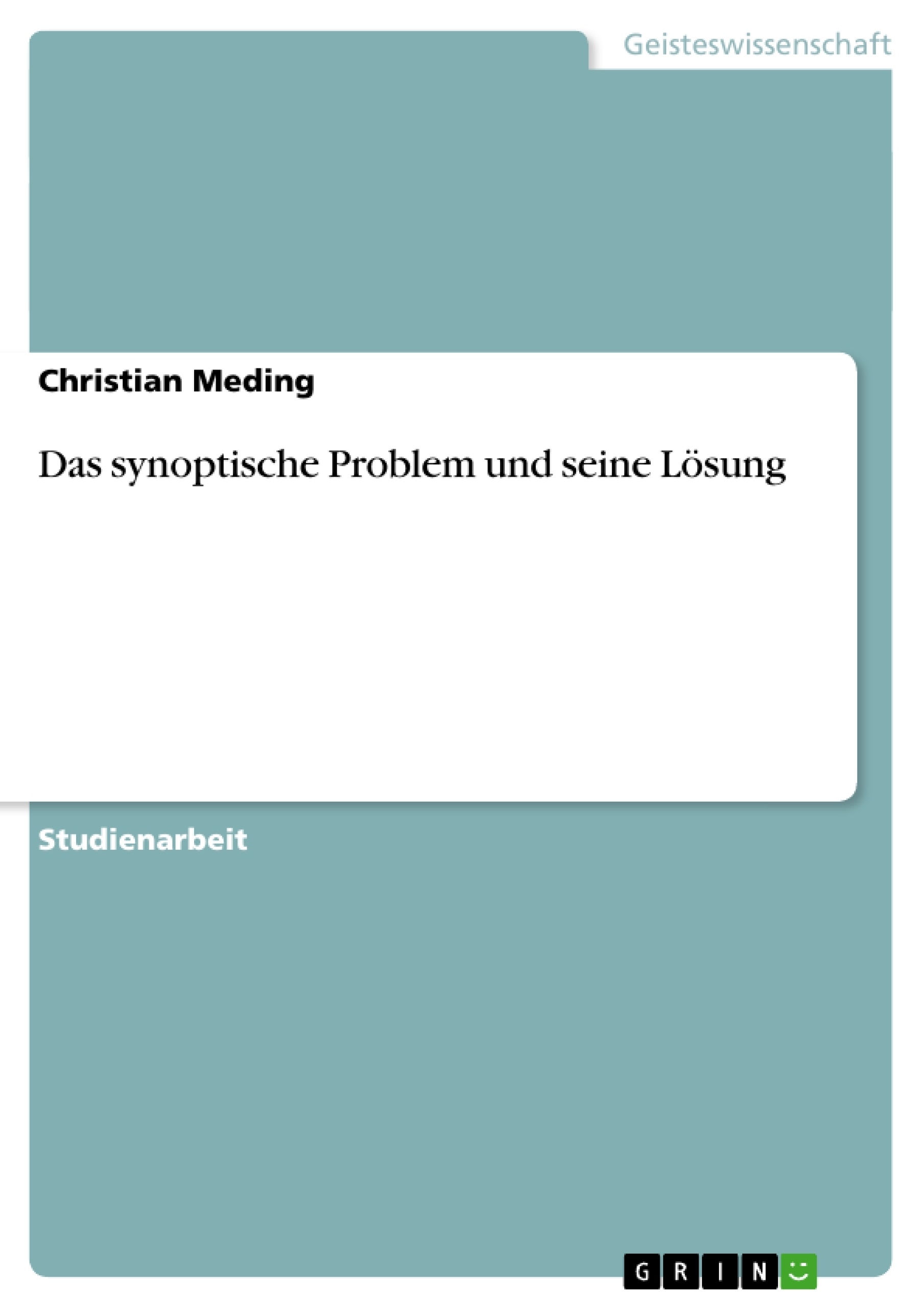Die synoptische Frage behandelt das literarische Verhältnis der drei synoptischen Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas zueinander. Es fällt nämlich auf, dass manche Erzählungen bzw. größere Erzähleinheiten in allen drei Evangelien fast wortgleich niedergeschrieben sind, andere Perikopen wiederum werden nur von einem oder von zwei Evangelisten überliefert. Deshalb wird davon ausgegangen, dass ihre Entstehungsgeschichte auf irgendeine Weise zusammenhängt. Zum einen sind Inhalt und Anordnung des Stoffes bei allen drei Synoptikern ähnlich. Zu Beginn wird immer die Verhaftung Johannes des Täufers angeführt, darauf folgt die Geschichte Jesu von der Taufe bis zur Leidensgeschichte. Dabei stellt das Petrusbekenntnis eine Zäsur dar. Der gesamte Stoff wird in episodenhaften Einzelgeschichten vermittelt. Zum anderen stimmen Matthäus, Markus und Lukas in vielen Einzelheiten überein. So sind Texte teilweise annähernd identisch. Wortwahl und Satzbau weisen große Übereinstimmungen auf. Daraus folgert man, dass es sich nicht um zwei oder drei unabhängige Augenzeugenberichte handeln kann. Denn dass diese nicht rein zufällig gleichlautend sind, erscheint durchaus plausibel, vor allem, weil dies nicht nur stellenweise, sondern in vielen längeren Texten der Fall ist. Dennoch stehen dieser Gleichheit ausgeprägte Unterschiede im sprachlichen Ausdruck wie auch Widersprüche gegenüber: Am deutlichsten zu erkennen beim Stammbaum Jesu oder dem Wohnort von Jesu Eltern. Es stellt sich also die Frage, worin dieses eigenartige Nebeneinander von zugleich enger Verwandtschaft und doch starker Verschiedenheit begründet liegt. Dieser Frage nach der „concordia discors“ soll in dieser Hausarbeit nachgegangen werden und mögliche Lösungsansätze aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Das synoptische Problem und seine Lösung
- Was ist das synoptische Problem?
- Die verschiedenen historischen Theorien zur Lösung des synoptischen Problems
- Die Urevangeliumshypothese (um 1750)
- Die Fragmententheorie (um 1800)
- Die Traditionshypothese (um 1800)
- Die Benutzungshypothese als Wegbereiter der Zweiquellentheorie
- Die klassische Zweiquellentheorie als aktuelle Lösung des synoptischen Problems
- Markus als Quelle für Matthäus und Lukas
- Die Perikopenreihenfolge
- Die Sprache
- Sachliche Verbesserungen
- Die Wortstatistik
- Das Markussondergut
- Eine zweite gemeinsame Quelle für Matthäus und Lukas: die Logienquelle „Q“
- Die Logienquelle „Q“
- Zeit und Ort der Entstehung von „Q“
- Sprache und Art der Überlieferung
- Griechisches oder aramäisches Original?
- Mündliche oder schriftliche Überlieferung?
- Die Zweiquellentheorie: Begründungen und Probleme
- Doppelüberlieferungen
- Minor agreements
- Sondergut
- Markussondergut
- Sondergut von Matthäus und Lukas
- Die Lukanische Lücke
- Die schematische Darstellung der Zweiquellentheorie
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das synoptische Problem, also das literarische Verhältnis der Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas. Ziel ist es, verschiedene historische Lösungsansätze zu präsentieren und zu bewerten, mit dem Fokus auf die Zweiquellentheorie als aktuelle Lösung. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und die Stärken dieses Modells.
- Das literarische Verhältnis der synoptischen Evangelien
- Historische Lösungsansätze des synoptischen Problems
- Die Zweiquellentheorie (Markus und Q)
- Begründungen und Probleme der Zweiquellentheorie
- Bewertung der verschiedenen Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Was ist das synoptische Problem?: Dieses Kapitel führt in das synoptische Problem ein. Es beschreibt die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den drei synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus und Lukas) und stellt die Frage nach dem literarischen Zusammenhang. Die auffälligen Übereinstimmungen, aber auch die bestehenden Widersprüche in Inhalt und Formulierung, werden herausgestellt und als Ausgangspunkt der weiteren Untersuchung etabliert. Die "concordia discors" der Evangelien wird als zentrale Fragestellung formuliert, der die Arbeit nachgeht.
Die verschiedenen historischen Theorien zur Lösung des synoptischen Problems: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene historische Lösungsansätze zum synoptischen Problem. Es werden die Urevangeliumshypothese (Lessing und Eichhorn), die Fragmententheorie (Schleiermacher) und die Traditionshypothese (Herder und Gieseler) vorgestellt und kritisch bewertet. Jede Theorie wird hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Erklärung der Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Evangelien analysiert und letztendlich als unzureichend für eine umfassende Erklärung des synoptischen Problems verworfen.
Die klassische Zweiquellentheorie als aktuelle Lösung des synoptischen Problems: Dieses Kapitel stellt die Zweiquellentheorie als die heute vorherrschende Lösung des synoptischen Problems vor. Es analysiert detailliert die Rolle des Markusevangeliums als Quelle für Matthäus und Lukas und die Hypothese einer zusätzlichen gemeinsamen Quelle, der Logienquelle "Q". Die Argumentation stützt sich auf textkritische Analysen, die Perikopenreihenfolge, sprachliche Übereinstimmungen und Unterschiede, sowie die statistische Auswertung der Wortwahl. Das Kapitel diskutiert die Beweise für die Abhängigkeit von Matthäus und Lukas von Markus und Q, aber auch mögliche Limitationen des Modells.
Die Logienquelle „Q“: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der hypothetischen Logienquelle "Q", einer zweiten Quelle neben Markus, die sowohl Matthäus als auch Lukas verwendet haben sollen. Es diskutiert die Herausforderungen bei der Rekonstruktion von "Q", Fragen nach dem ursprünglichen Sprachgebrauch (aramäisch oder griechisch) und der Art der Überlieferung (mündlich oder schriftlich). Das Kapitel hinterfragt die Existenz und den Inhalt von Q und die möglichen Schlussfolgerungen, die aus seiner angenommenen Existenz gezogen werden können.
Die Zweiquellentheorie: Begründungen und Probleme: Dieser Abschnitt analysiert die Zweiquellentheorie im Detail, indem er deren Stärken und Schwächen untersucht. Er geht auf die Probleme ein, die das Modell aufwirft, z.B. Doppelüberlieferungen, "minor agreements", Sondergut und die "lukanische Lücke", und diskutiert mögliche Erklärungen für diese Phänomene. Die kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Theorie dient als umfassende Bewertung ihrer Gültigkeit und Grenzen als Lösungsansatz für das synoptische Problem.
Schlüsselwörter
Synoptische Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, synoptisches Problem, Zweiquellentheorie, Logienquelle Q, Urevangeliumshypothese, Fragmententheorie, Traditionshypothese, Perikopenreihenfolge, Textkritik, literarische Abhängigkeit, mündliche Tradition, schriftliche Überlieferung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Das Synoptische Problem
Was ist das Thema des Dokuments?
Das Dokument behandelt das synoptische Problem, also die Frage nach dem literarischen Verhältnis der drei Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas. Es untersucht verschiedene historische Lösungsansätze und konzentriert sich insbesondere auf die Zweiquellentheorie als aktuell gängigste Erklärung.
Was ist das synoptische Problem?
Das synoptische Problem beschreibt die auffälligen Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas. Die Evangelien weisen sowohl zahlreiche Übereinstimmungen als auch Abweichungen in Inhalt und Formulierung auf. Die Frage ist, wie diese „concordia discors“ zu erklären ist – also wie der literarische Zusammenhang zwischen den drei Texten aussieht.
Welche historischen Lösungsansätze werden vorgestellt?
Das Dokument präsentiert und bewertet verschiedene historische Theorien zur Lösung des synoptischen Problems: die Urevangeliumshypothese, die Fragmententheorie und die Traditionshypothese. Diese werden kritisch beleuchtet und als unzureichend für eine umfassende Erklärung des Problems verworfen.
Was ist die Zweiquellentheorie?
Die Zweiquellentheorie ist die derzeit am weitesten verbreitete Lösung des synoptischen Problems. Sie besagt, dass Matthäus und Lukas beide auf das Markusevangelium und eine weitere gemeinsame Quelle, die sogenannte Logienquelle „Q“, zurückgegriffen haben. „Q“ enthielt hauptsächlich Jesu Reden (Logien).
Welche Beweise unterstützen die Zweiquellentheorie?
Die Zweiquellentheorie stützt sich auf verschiedene Beweise: die Perikopenreihenfolge (Abfolge der Erzählungen), sprachliche Übereinstimmungen und Unterschiede, statistische Auswertung der Wortwahl und die Analyse von Textabschnitten, die nur in einem der Evangelien vorkommen (Sondergut).
Was ist die Logienquelle „Q“?
Die Logienquelle „Q“ ist eine hypothetische Quelle, die nur aus der Zweiquellentheorie erschlossen wird. Es ist eine Sammlung von Jesu Reden und Aussprüchen, die sowohl Matthäus als auch Lukas verwendet haben sollen. Die genaue Natur von „Q“ (aramäisches oder griechisches Original, mündliche oder schriftliche Überlieferung) ist Gegenstand von Diskussionen.
Welche Probleme weist die Zweiquellentheorie auf?
Trotz ihrer weiten Akzeptanz weist die Zweiquellentheorie auch Probleme auf. Dazu gehören Doppelüberlieferungen, „minor agreements“ (geringfügige Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Lukas, die nicht auf Markus oder Q zurückzuführen sind), Sondergut (Abschnitte, die nur in einem Evangelium vorkommen) und die sogenannte „lukanische Lücke“ (Abschnitte in Markus, die in Lukas fehlen).
Wie wird die Zweiquellentheorie schematisch dargestellt?
Das Dokument enthält eine schematische Darstellung der Zweiquellentheorie, die die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas (unter Einbezug von Q) verdeutlicht. (Die schematische Darstellung ist im Originaldokument enthalten, aber nicht explizit in dieser FAQ wiedergegeben.)
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter zum Verständnis des Themas sind: Synoptische Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, synoptisches Problem, Zweiquellentheorie, Logienquelle Q, Urevangeliumshypothese, Fragmententheorie, Traditionshypothese, Perikopenreihenfolge, Textkritik, literarische Abhängigkeit, mündliche Tradition, schriftliche Überlieferung.
- Arbeit zitieren
- Christian Meding (Autor:in), 2004, Das synoptische Problem und seine Lösung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/40706