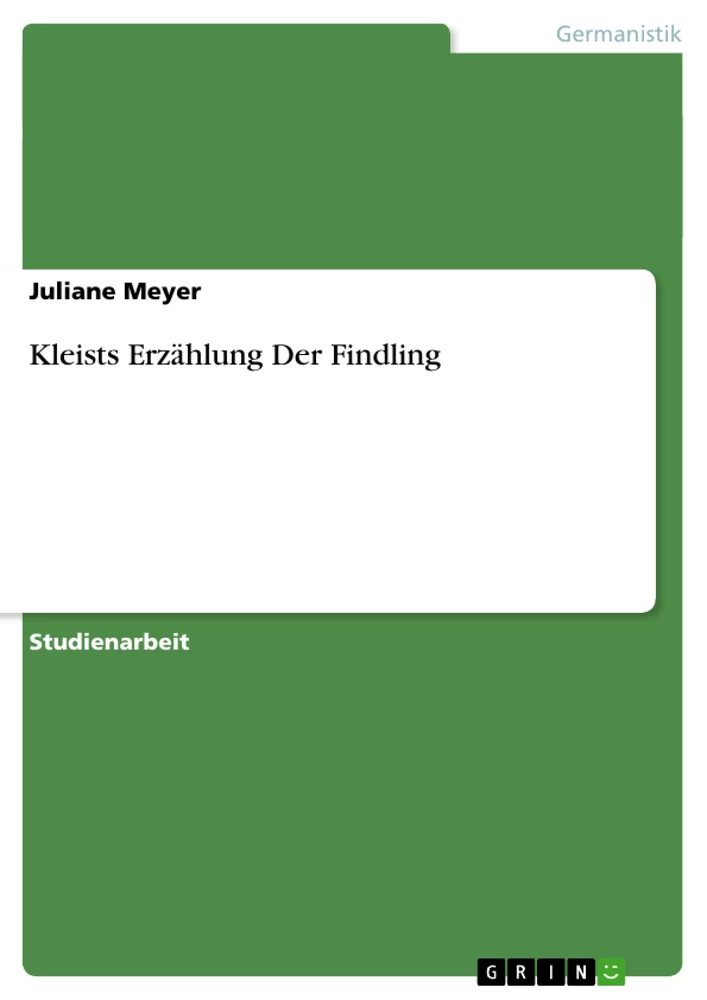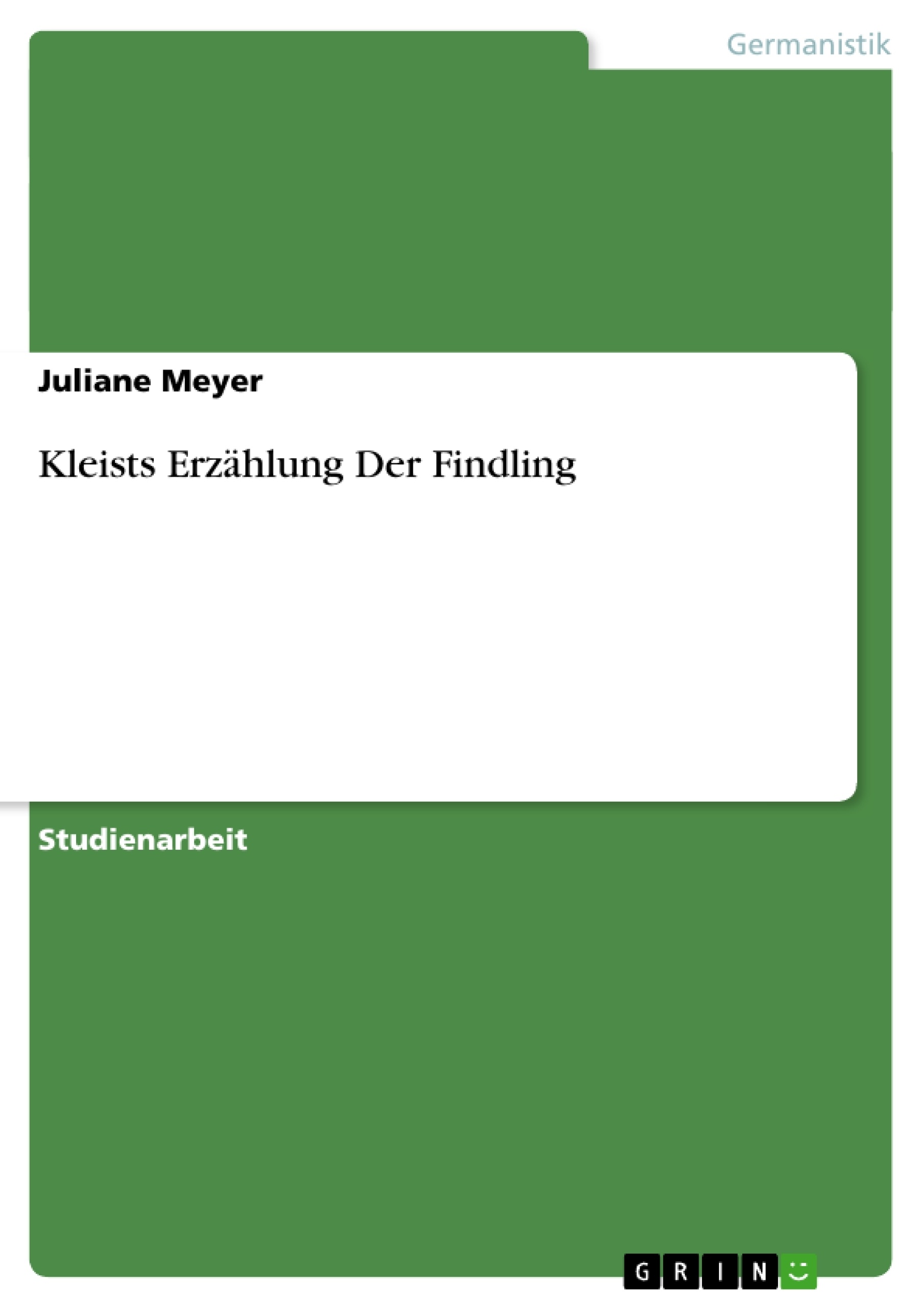Der Findling ist sowohl in der Radikalität des Themas als auch in der Härte und Kühnheit der Motivverschränkung in Kleists Werk einzigartig. Kleists konstruktive Phantasie hat in dieser Erzählung, deren Entstehungszeit unbestimmt ist, Extremfälle menschlichen Handels und Leidens gestaltet. Nirgends in Kleists Werken ist das Böse so wirksam und mächtig als hier.1 Mein erster Leseeindruck ist typisch für die gesamte Novelle: ich war verwirrt. Am Ende der Novelle wusste ich nicht mehr, wer der Bösewicht war und wer nicht. Wurde Nicolo nicht am Anfang so unschuldig und hilflos dargestellt? Wieso hat er sich zu dem entwickelt was er ist? Interessanterweise spiegelt sich dies auch in der Sekundärliteratur wieder. Stets wurde Nicolo als durchtriebener, falscher Bösewicht dargestellt. Im Gegensatz dazu waren Piachi und Elvire die Güte und Liebenswürdigkeit in Person und Piachis Tat ist am Ende durchaus verständlich. In den späten 70er Jahren jedoch wandelte sich die Richtung der Sichtweise. Den Höhepunkt dieser anderen Lesart bildet Schröders Plädoyer für Nicolo (1985). Nicolo war von nun an eben nicht mehr der teuflische Falschspieler, sondern vielmehr ein Opfer. Er war das Opfer einer falschen Erziehung, eines lieblosen Elternhauses, einer kapitalistischen Gesellschaft, eines korrupten Klerus.2 Fakt ist zwar, dass Nicolo böse ist: er versucht seine Adoptivmutter zu vergewaltigen und wirft seinen Adoptivvater aus seinem eigenen Haus. Allerdings drängt sich einem die Frage auf: ist Nicolo von Natur aus böse oder sind es die äußeren Umstände, die ihn im Verlaufe der Erzählung böse werden lassen? Da sich die Forschung ebenfalls mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, ist es Ziel meiner Arbeit, diese zwei Sichtweisen des „Findlings“ genauer zu betrachten. 1 Hoffmeister, Werner: Heinrich von Kleists „Findling“. In: Monatshefte 58 (1966) S. 49 2 Oesterle, Günter: Der Findling Redlichkeit versus Verstellung – oder zwei Arten böse zu werden. In: Interpretationen Kleists Erzählungen Reclam Stuttgart 1998, S. 163
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Ein Plädoyer für Nicolo“ nach Jürgen Schröder
- Inkarnation des Bösen?
- Die zwei Leidenschaften des Nicolo
- Wer ist der höllische Bösewicht, Nicolo oder Piachi?
- Piachi – moralischer Zuchtmeister
- Nicolo – Lückenbüßer und Unperson
- Gestörte Kommunikation
- Die Affekte des Nicolo und ihre Entwicklung nach Günter Oesterle
- Kein Plädoyer für Nicolo
- Grundmotiv der Infektion
- Affekte und ihre Logik
- Die zweite Novellenhälfte entwickelt Dynamik aus Kalkül, Zufällen und Erkennungen, Recherche und Projektion
- Die Wendung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Interpretation der Kleistschen Novelle „Der Findling“ und analysiert zwei gegensätzliche Sichtweisen auf die Figur des Nicolo. Sie beleuchtet, ob Nicolo von Natur aus böse ist oder ob ihn äußere Umstände zu seinem Handeln treiben.
- Die Frage nach der Natur des Bösen und dessen Entstehung
- Die Rolle der Erziehung und der sozialen Verhältnisse in der Entwicklung des Individuums
- Die Ambivalenz der Figur des Nicolo: Opfer oder Täter?
- Die Darstellung von Gewalt und Verführung in der Novelle
- Das Verhältnis von Vater und Sohn und dessen Einfluss auf die Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Novelle „Der Findling“ als ein einzigartiges Werk in Kleists Schaffen vor und beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen der Figur des Nicolo in der Sekundärliteratur.
Das zweite Kapitel analysiert Jürgen Schröders „Plädoyer für Nicolo“. Schröder argumentiert, dass Nicolo nicht als ein böser Mensch, sondern als Opfer seiner Umwelt und seiner Erziehung dargestellt wird.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Günter Oesterles Analyse der Affekte des Nicolo und ihrer Entwicklung. Oesterle stellt heraus, dass die Affekte des Nicolo ein wesentlicher Motor der Handlung sind und dass seine Handlungen aus einer Mischung aus Kalkül, Zufällen und Erkennungen resultieren.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe der Arbeit sind "Der Findling", "Heinrich von Kleist", "Nicolo", "Piachi", "Böses", "Erziehung", "Soziale Verhältnisse", "Affekte", "Interpretation", "Plädoyer", "Opfer", "Täter", "Gewalt", "Verführung".
- Quote paper
- Juliane Meyer (Author), 2002, Kleists Erzählung Der Findling, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/40142