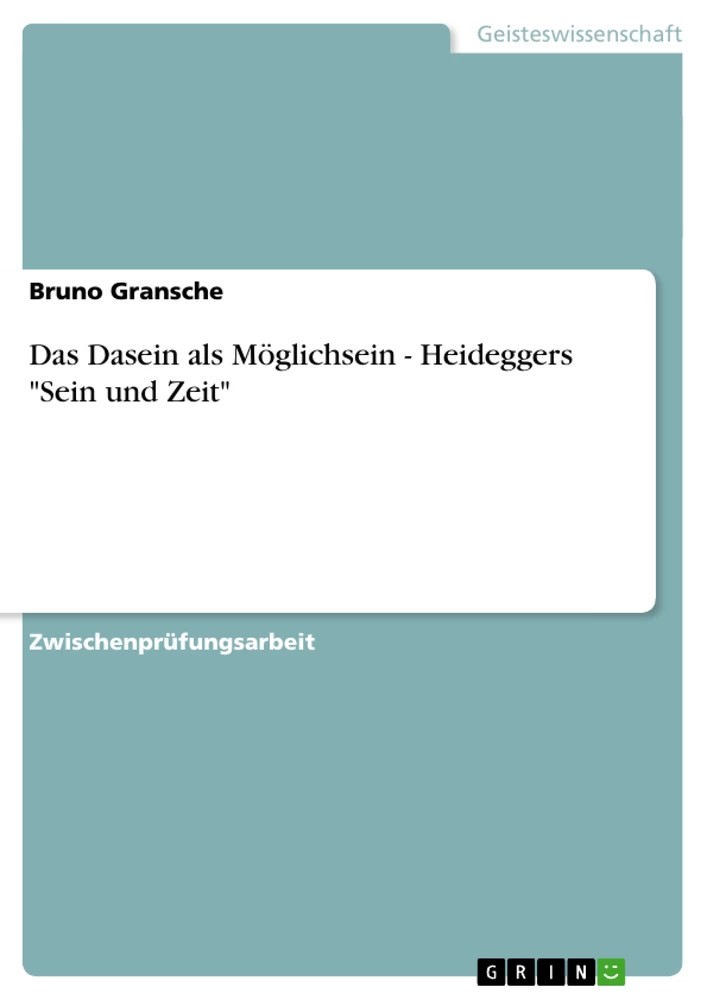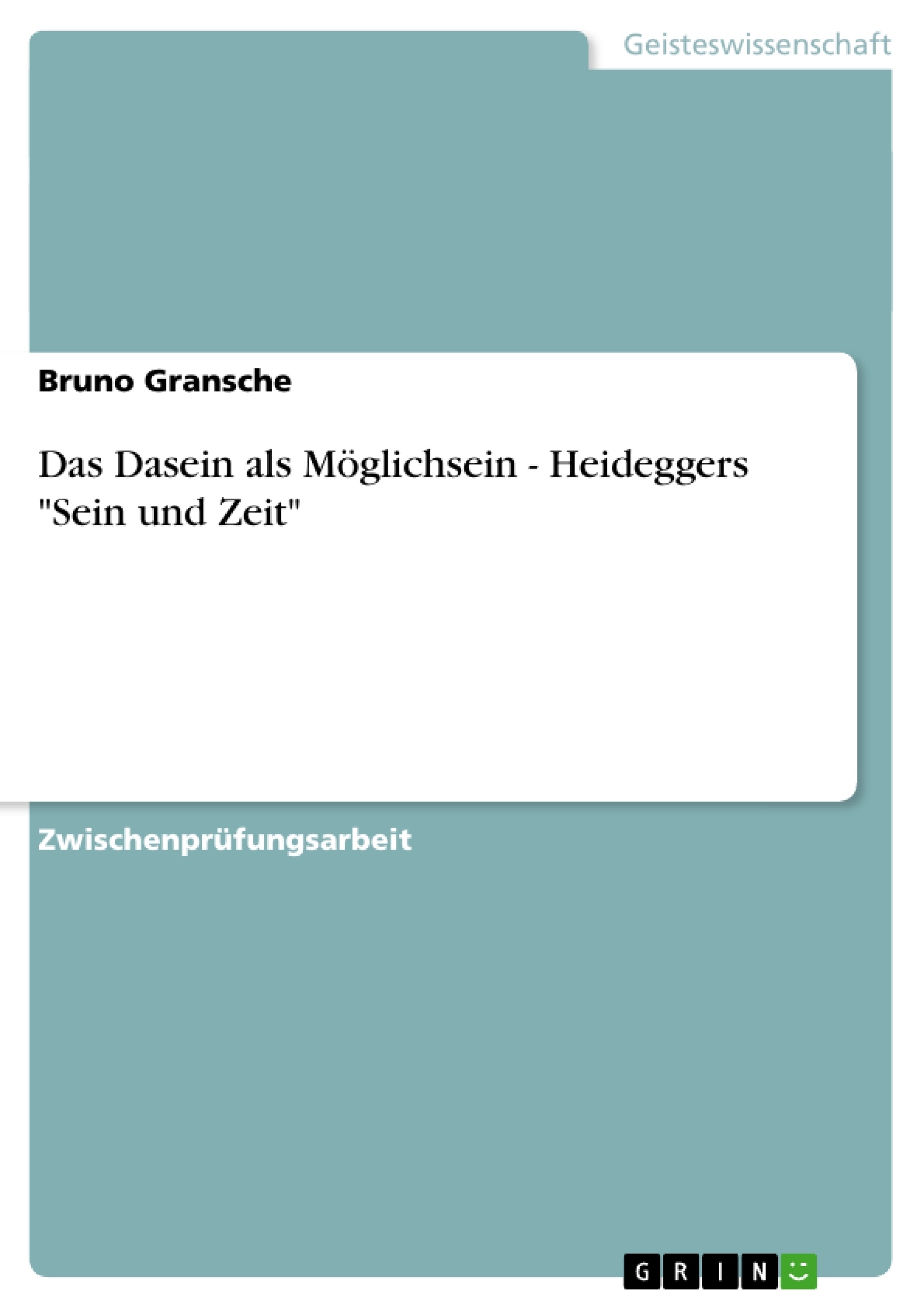In seinem einflussreichstem Werk, „Sein und Zeit“ von 1927, stellt Heidegger die Frage nach dem Sinn von Sein. Er sieht die Frage nach dem Sein zwar von Platon und Aristoteles behandelt, ab dann jedoch, vor allem in der modernen Philosophie sträflich vernachlässigt. Nach Heideggers Meinung habe die Philosophie der Antike noch einen reinen Zugang zum Sein gesucht, wohingegen die darauf folgende Tradition der Metaphysik sich nur noch mit Seiendem befasst habe. Ein Umstand, den er später „Seinsvergessenheit“ nennen wird.
Diese Seinsvergessenheit ist für Heidegger Zeugnis von Unverständnis, da unser Sein uns zwar ontisch am nächsten, ontologisch aber am fernsten sei. Somit nicht leer und selbstverständlich, sondern dunkel und interessant. Heidegger stellt die Frage nach dem Sein und versucht mit „Sein und Zeit“ eine Fundamentalontologie. Obgleich die Ontologie, anders als die Naturwissenschaften, nach allen Formen des Seins, nach dem Sein schlechthin fragt, muss auch eine ontologische Untersuchung von einem bestimmten Sein ausgehen, um überhaupt sinnvoll die Seinsfrage angehen zu können. Es muss ein konkreter Ansatzpunkt gefunden werden. Das geeignetste Sein, das man als solchen wählen kann, sei das Sein des Menschen, das „Dasein“.
Das Dasein hat gleich mehrfachen Vorrang; ontischen und ontologischen Vorrang, und „Vorrang als ontisch-ontologische Bedingung der Möglichkeit aller Ontologien“. Heidegger fasst das Dasein als dasjenige Seiende, dem es in seinem Sein um es selbst geht.
Außerdem gebietet schon die Schwierigkeit einer fundamentalontologischen Analyse, bei einem zugänglichem, uns nahem, nachvollziehbarem und verfügbarem Punkt anzusetzen. Und was wäre uns näher als wir selbst? Im Zentrum der Seinsfrage steht also zunächst, die Daseinsanalyse.
Thema meiner Arbeit ist es, Heideggers Ideen zur Daseinsanalyse und deren ontologische Fundierung herauszustellen. Dazu werden zunächst die existenzialen Strukturmomente des Daseins dargelegt, wovon eines, das Möglichsein, anschließend auf seine Bedeutung und Konsequenzen hin untersucht werden soll. Kann das Dasein als Möglichsein gedacht werden? Welche Art von Möglichkeiten hat es? Was bedeutet das Möglichsein für die Freiheit, für Verantwortung und für den Lebensvollzug des Menschen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorbemerkung
- 2. Das Dasein
- 2.1 Die Strukturmomente des Daseins
- 2.1.1 Die Geworfenheit
- 2.1.2 Die Befindlichkeit
- 2.1.3 Das Verstehen
- 2.1.4 Die Rede
- 2.1.5 Die Verfallenheit
- 2.1.6 Die Existenzialität
- 2.1.7 Der Entwurf
- 2.1.8 Die Sicht
- 2.2 Die Ganzheit der Struktur des Daseins
- 2.2.1 Das Gewissen
- 2.2.2 Die Sorge
- 2.2.3 Die Angst
- 2.1 Die Strukturmomente des Daseins
- 3. Das Möglichsein
- 3.1 Realisierbare Möglichkeiten
- 3.2 Ewige Möglichkeiten
- 3.3 Das Ideal
- 4. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Heideggers Konzept des Daseins als Möglichsein in „Sein und Zeit“. Ziel ist es, die existenzialen Strukturmomente des Daseins darzulegen und die Bedeutung des Möglichseins für Freiheit, Verantwortung und den Lebensvollzug des Menschen zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Daseinsanalyse im ersten Abschnitt von „Sein und Zeit“, unter weitgehender Aussparung des Zeitbegriffs.
- Die Strukturmomente des Daseins nach Heidegger
- Das Möglichsein als zentrale Seinsmöglichkeit des Daseins
- Die ontologische Differenz zwischen Sein und Seiendem
- Die Bedeutung des Daseins als ontologisch primär zu Befragendes
- Die Konsequenzen des Möglichseins für den menschlichen Lebensvollzug
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorbemerkung: Die Vorbemerkung führt in Heideggers Projekt in „Sein und Zeit“ ein, welches die Frage nach dem Sinn von Sein stellt. Heidegger kritisiert die „Seinsvergessenheit“ der modernen Philosophie und argumentiert, dass die Frage nach dem Sein nicht trivial oder überflüssig ist, sondern essentiell für ein Verständnis unseres Wesens. Er wählt das Dasein als den geeigneten Ansatzpunkt für eine fundamentalontologische Untersuchung, da es das Seiende ist, dem es in seinem Sein um es selbst geht. Die Arbeit konzentriert sich auf die Daseinsanalyse und die Idee des Möglichseins.
2. Das Dasein: Dieses Kapitel erläutert die Strukturmomente des Daseins, um das Möglichsein als eine ausgezeichnete Seinsmöglichkeit zu verstehen. Es werden die ontologische Differenz zwischen Sein und Seiendem und die Bedeutung der Existenzialien (z.B. Befindlichkeit, Verstehen, Verfallenheit) erläutert. Das Dasein ist nicht einfach ein Seiendes unter anderen, sondern zeichnet sich durch sein Verhältnis zu seinem eigenen Sein aus – die Existenz. Die Ganzheit der Daseinsstruktur wird durch Phänomene wie Sorge, Gewissen und Angst beschrieben.
Schlüsselwörter
Dasein, Sein und Zeit, Heidegger, Möglichsein, Existenzialien, Befindlichkeit, Verstehen, Verfallenheit, Existenzialität, ontologische Differenz, Fundamentalontologie, Seinsvergessenheit, Sorge, Angst, Existenzphilosophie.
Häufig gestellte Fragen zu Heideggers "Sein und Zeit" (Auszug)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Vorschau auf eine wissenschaftliche Arbeit über Martin Heideggers „Sein und Zeit“. Es enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der behandelten Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf Heideggers Konzept des Daseins als Möglichsein.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die existenzialen Strukturmomente des Daseins nach Heidegger, insbesondere das Möglichsein als zentrale Seinsmöglichkeit. Weitere Schwerpunkte sind die ontologische Differenz zwischen Sein und Seiendem, die Bedeutung des Daseins als ontologisch primär zu Befragendes und die Konsequenzen des Möglichseins für den menschlichen Lebensvollzug. Der Zeitbegriff wird weitestgehend ausgeklammert.
Welche Strukturmomente des Daseins werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Strukturmomente des Daseins, darunter die Geworfenheit, die Befindlichkeit, das Verstehen, die Rede, die Verfallenheit, die Existenzialität, der Entwurf, die Sicht, das Gewissen, die Sorge und die Angst. Diese werden im Kontext der Ganzheit der Daseinsstruktur betrachtet.
Was ist das Möglichsein nach Heidegger?
Das Möglichsein ist eine zentrale Seinsmöglichkeit des Daseins. Die Arbeit beleuchtet, wie dieses Konzept mit den existenzialen Strukturmomenten zusammenhängt und welche Bedeutung es für Freiheit, Verantwortung und den Lebensvollzug des Menschen hat. Es wird untersucht, wie sich realisierbare und ewige Möglichkeiten zum Dasein verhalten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Vorbemerkung, ein Kapitel über das Dasein (mit Unterkapiteln zu den Strukturmomenten und der Ganzheit der Daseinsstruktur), ein Kapitel über das Möglichsein und eine Schlussbemerkung. Das Kapitel über das Dasein behandelt detailliert die existenzialen Strukturmomente und ihre Bedeutung für das Verständnis des Daseins.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Dasein, Sein und Zeit, Möglichsein, Existenzialien (z.B. Befindlichkeit, Verstehen, Verfallenheit), Existenzialität, ontologische Differenz, Fundamentalontologie, Seinsvergessenheit, Sorge, Angst und Existenzphilosophie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Heideggers Konzept des Daseins als Möglichsein in „Sein und Zeit“ darzulegen und zu analysieren. Sie möchte die existenzialen Strukturmomente des Daseins verdeutlichen und die Bedeutung des Möglichseins für Freiheit, Verantwortung und den Lebensvollzug des Menschen beleuchten.
Wie wird der Begriff der Zeit in der Arbeit behandelt?
Der Zeitbegriff wird in dieser Arbeit weitestgehend ausgeklammert, der Fokus liegt auf der Daseinsanalyse und der Idee des Möglichseins im ersten Abschnitt von "Sein und Zeit".
- Quote paper
- Bruno Gransche (Author), 2005, Das Dasein als Möglichsein - Heideggers "Sein und Zeit", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/40041