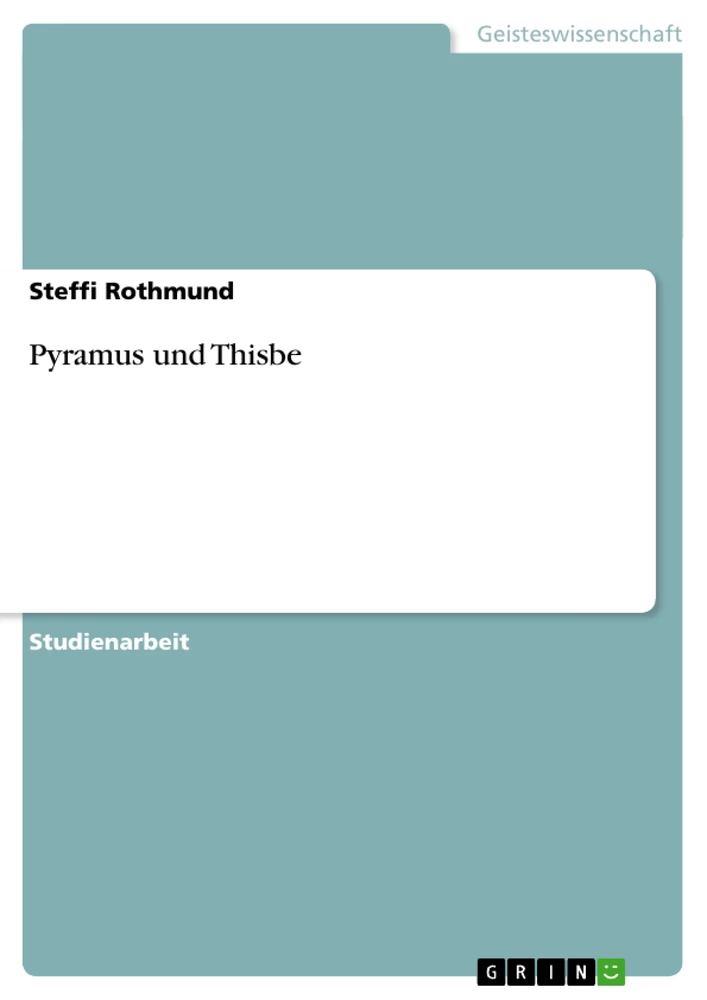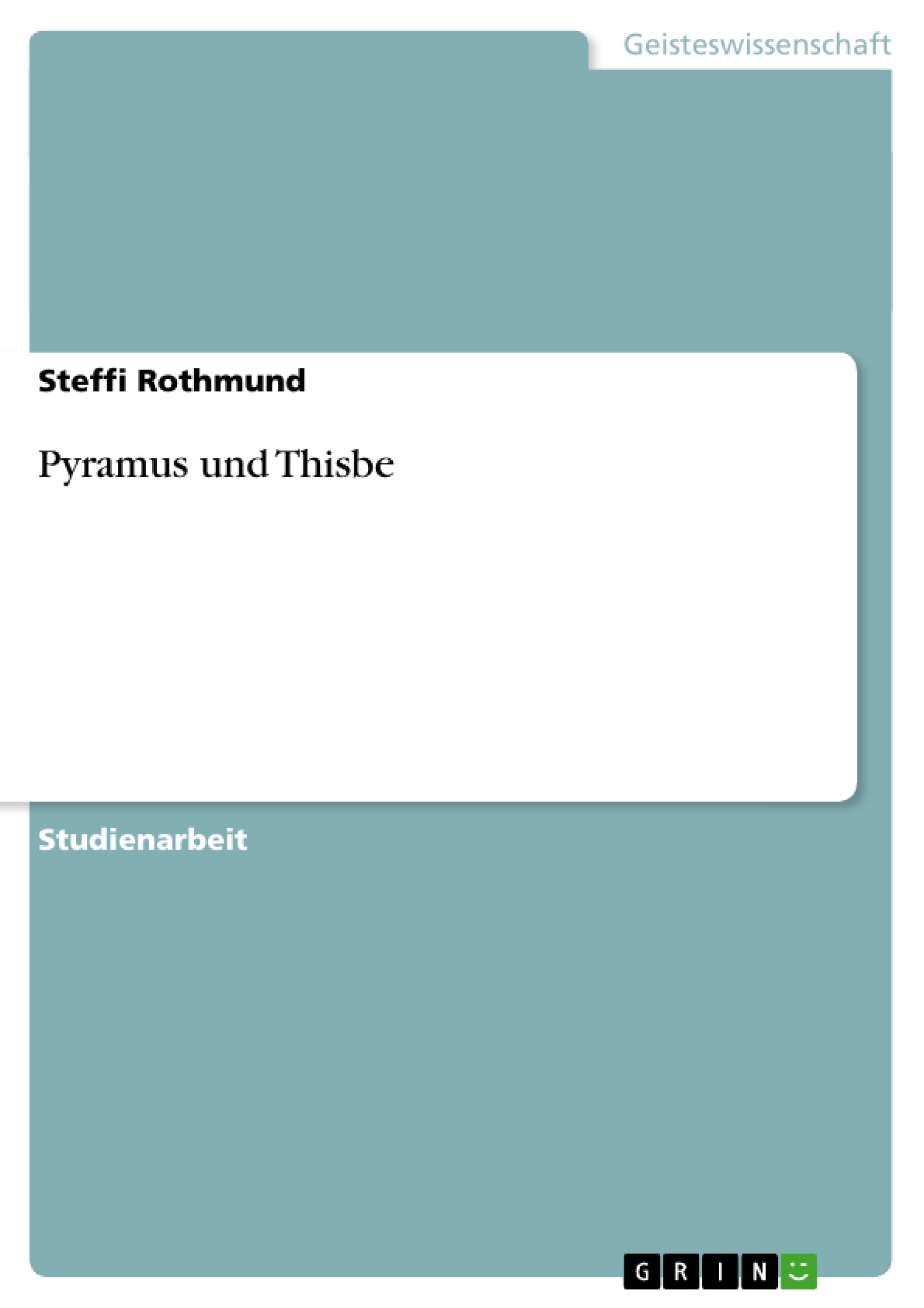Die Metamorphosen des Publius Ovidius Naso zählen mit Sicherheit zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Die etwa dreihundert Erzählungen der insgesamt fünfzehn Bücher sind untereinander thematisch verknüpft, so dass am Ende ein kunstvolles Gesamtwerk entsteht. Walther Ludwig beschreibt dies in seinem Werk „Struktur und Einheit der Metamorphosen Ovids“ von 1965 mit folgenden Worten: „Es ist gleichsam eine große kreisförmige Bewegung (von den Göttern zu den Menschen und wieder hinauf zu den Göttern), die das Werk als Ganzes durchzieht und die sich schließlich in Augustus erfüllt. (...) Ovid war der Erste, der die Metamorphosendichtung mit der Konzeption eines Weltgedichts verband.(...) Sein Ziel war gewissermaßen ein Überepos, das die gesamte
Mythologie und Geschichte zur Darstellung bringen sollte“ Jede Metamorphose zeichnet sich, wie der Name schon sagt, durch die Schilderung einer Verwandlung aus, die sich als Folge der Erzählung ergibt. Ein Beispiel hierfür ist sowohl der Götterzorn, der oft Eingang in die Erzählungen findet, als auch die Liebe, die in den Metamorphosen oft Anlass zu einer Verwandlung bietet. So auch in der Geschichte Pyramus und Thisbe, die dieser Arbeit zugrunde liegt. Zunächst gilt die Betrachtung der Geschichte selbst. Nach Darlegung des Inhalts und Anfertigen einer Gliederung, gilt es den Mythos um Pyramus und Thisbe zu analysieren. Den Abschluss bildet schließlich ein Beispiel aus der Rezeptionsgeschichte der Metamorphose. Der normannische Künstler Nicolas Poussin setzte sich mit der Metamorphose auseinander und nannte sein 1651 entstandenes Werk „ Landschaft mit Pyramus und Thisbe.
Inhaltsverzeichnis
- I Vorwort
- II Pyramus und Thisbe
- 2.1 Inhalt
- 2.2 Gliederung
- 2.3 Analyse
- 2.4 Rezeption: Poussins „Landschaft mit Pyramus und Thisbe“
- III Literaturverzeichnis
- 4.1 Quellen
- 4.2 Darstellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Geschichte von Pyramus und Thisbe, eine Metamorphose aus Ovids Werk „Metamorphosen“. Sie betrachtet die Geschichte im Kontext der Gesamtstruktur des Werkes und analysiert die narrative Gestaltung und den thematischen Gehalt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Darstellung von Liebe, Tod und Verwandlung gelegt.
- Die Funktion von Liebe und Leid in Ovids Erzählungen
- Die Darstellung von Tod und Trauer in der römischen Literatur
- Die Rolle von Verwandlung und Transformation in Ovids „Metamorphosen“
- Die Rezeption des Mythos von Pyramus und Thisbe in der Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort setzt die Geschichte von Pyramus und Thisbe in den Kontext der „Metamorphosen“ von Ovid und beleuchtet die Bedeutung des Werkes in der Weltliteratur. Es wird die Gesamtstruktur der „Metamorphosen“ und die Rolle der Verwandlung als zentrales Thema des Werkes diskutiert.
Das Kapitel „Pyramus und Thisbe“ beginnt mit einer detaillierten Zusammenfassung des Inhalts der Metamorphose. Anschließend werden die Hauptfiguren, ihre Beziehungen und die entscheidenden Handlungsschritte in einer übersichtlichen Gliederung dargestellt. Im nächsten Abschnitt wird die Geschichte analysiert, wobei die Rolle der Liebe, die Darstellung von Tod und Trauer sowie die Symbolik der Verwandlung im Zentrum der Betrachtung stehen. Abschließend wird die Rezeption der Metamorphose im Werk des Malers Nicolas Poussin beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Ovidschen „Metamorphosen“ wie Liebe, Tod, Verwandlung und Rezeption. Es werden die narrativen Techniken Ovids, die Darstellung von Emotionen, die symbolische Bedeutung der Handlungselemente und die Rezeption des Mythos in der Kunst behandelt.
- Quote paper
- Steffi Rothmund (Author), 2003, Pyramus und Thisbe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/39998