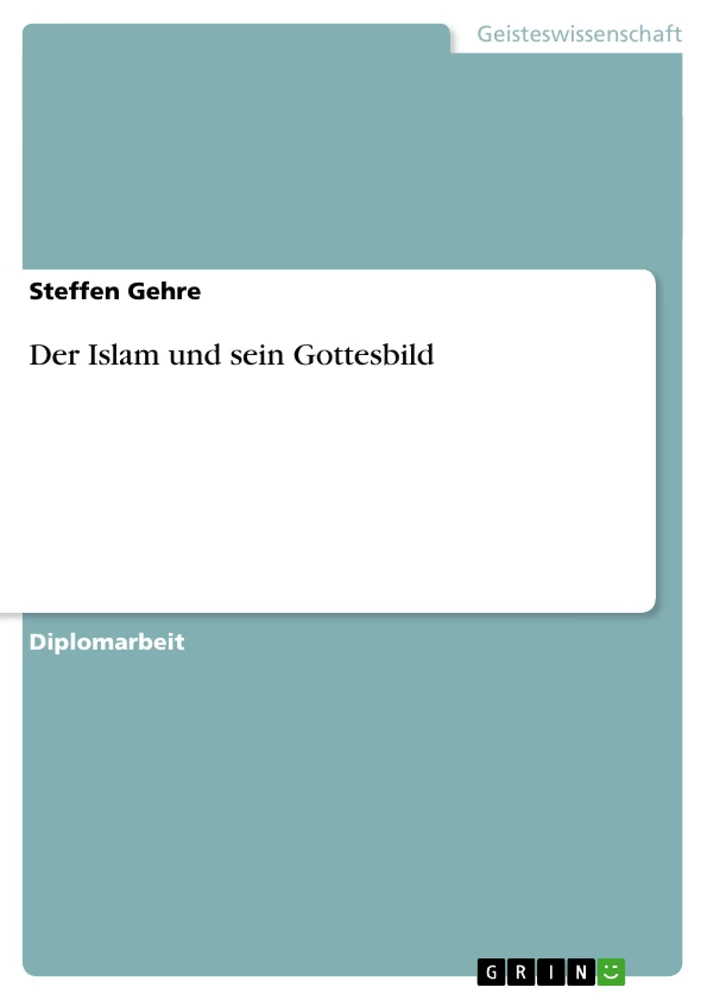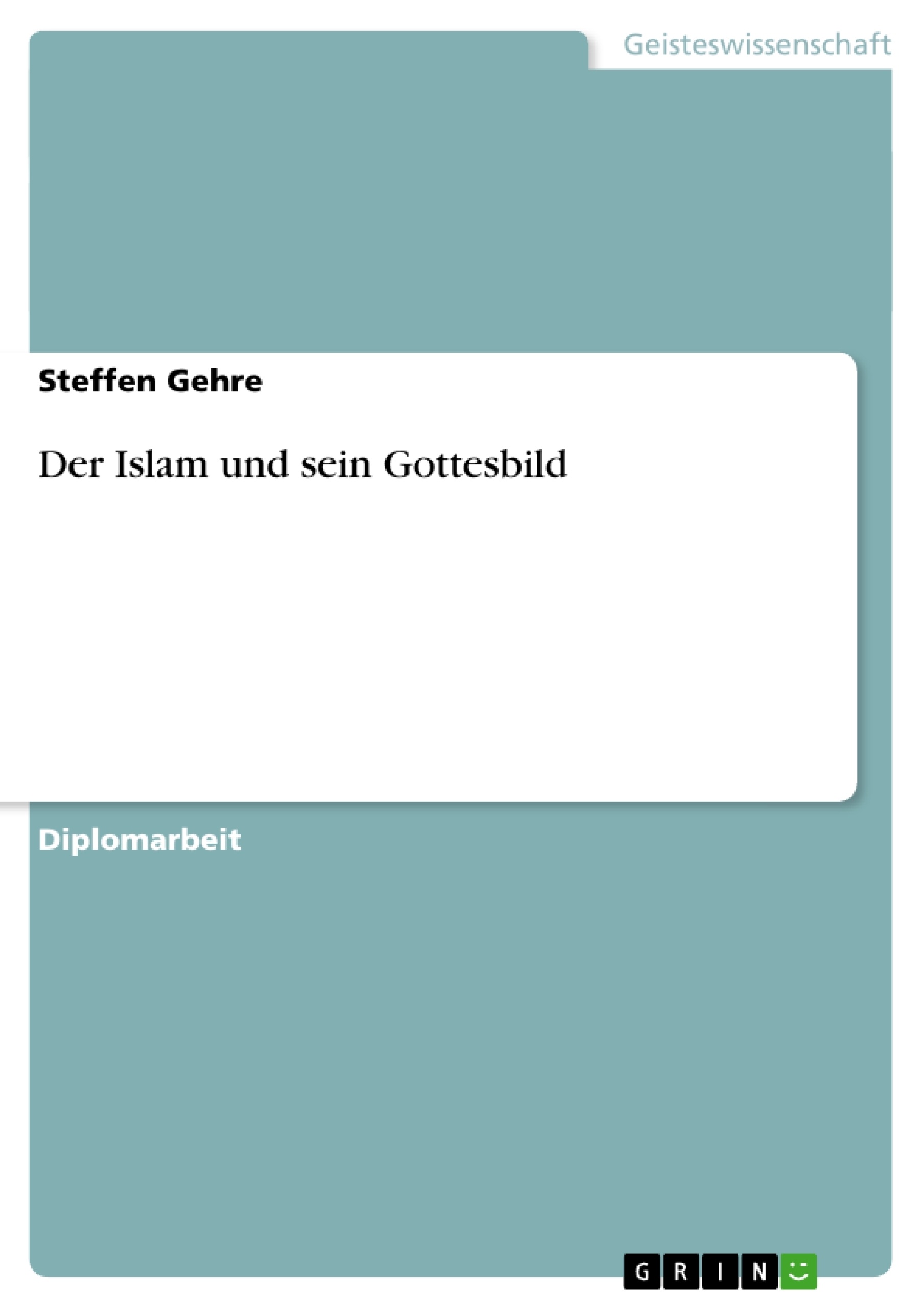In der heutigen Zeit spielt der Islam in unser Gesellschaft eine zunehmend größere Rolle. In den Medien wird beinahe täglich von neuen Schreckensmeldungen berichtet, die von muslimischen Selbstmordattentätern begangen wurden, und im gesamten nahen Osten herrscht andauernde Unruhe. Dadurch wird das Feindbild Islam, vor allem im christlich geprägten Abendland, geschürt. Das Stichwort ‚Islam’ löst bei vielen Menschen Assoziationen an fundamentalistische Gewalt aus. Dementsprechend begegnen sie Muslimen mit Zurückhaltung und teilweise auch mit Ablehnung. Der Islam ist und war die missverstandene Religion im christlich geprägten Abendland. Die Berührung mit Moslems in unser Gesellschaft ist ebenso Bestandteil unseres Lebens geworden, wie der Umgang mit Christen. In Deutschland lebten im Jahr 2000 noch 2,9 Millionen Moslems und weltweit über 1,4 Milliarden unserer muslimischen Brüder und Schwestern. Muslime in Deutschland sind zu unseren Nachbarn geworden, doch diese Nachbarschaft ist in vielen Fällen dadurch beeinträchtigt, dass oft nur wenig über den Islam bekannt ist. Durch Unwissenheit und Ignoranz wird von vielen Menschen in unserer Kultur der Islam abgelehnt und dessen Gläubige vorverurteilt. Diese Arbeit soll über den Islam informieren und somit zum interreligiösem Dialog zwischen Religionen und Kulturen beitragen um gemeinsam für ein besseres, friedliches Nebeneinander und Miteinander eintreten zu können. Denn gerade in Krisenzeiten läuft das ‚Nebeneinander’ Gefahr, in ein ‚Gegeneinander’ umzuschlagen. In dieser Arbeit möchte ich den Islam und sein Gottesbild beschreiben. Dabei werde ich vor allem auf die Einflüsse, die Entwicklung und das Verständnis des islamischen Gottesbildes eingehen. Dabei soll dem Leser die enge Verwandtschaft mit dem Judentum und Christentum deutlich gemacht werden. Schwerpunkt wird dabei das Gottesbild und seine Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zu den anderen Schriftreligionen sein. Auch die Propheten, die Engel, das islamische Verständnis von Heil, das Jüngste Gericht und der Koran selbst werden beschrieben. Dieser Beitrag erhebt nicht den Anspruch den Islam in seiner ganzen Komplexität darzustellen, sondern wird den Grundaussagen des Islams begegnen, damit dessen Grundsubstanz besser verstanden werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Voraussetzungen und Quellen
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Die historische Person Mohammed
- 1.3 Der Koran
- 1.4 Hadith/Sunna
- 1.5 Islam und Judentum
- 1.6 Islam und Christentum
- 1.7 Islam und Gnosis
- 2. Grundlagen muslimischer Theologie
- 2.1 Gott - Schöpfer, Erhalter und Richter der Welt
- 2.2 Engel
- 2.3 Schöpfungsmythen des Islam
- 2.4 Offenbarung Gottes
- 2.4.1 Abraham im Islam
- 2.4.2 Jesus im Islam
- 2.4.3 Der Prophet Mohammed
- 3. Elemente islamischer Theologie
- 3.1 Islamische Eschatologie
- 3.2 Islamische Soteriologie
- 4. Islam und Christentum
- 4.1 Islamischer Monotheismus und christliche Trinität
- 4.2 Christlich-islamischer Dialog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das islamische Gottesbild zu beschreiben und dessen Entwicklung und Verständnis zu beleuchten. Dabei soll die enge Verwandtschaft zum Judentum und Christentum hervorgehoben werden. Die Arbeit beabsichtigt, ein besseres Verständnis des Islams zu fördern und zum interreligiösen Dialog beizutragen.
- Das islamische Gottesbild und seine Entwicklung
- Vergleich des islamischen Gottesbildes mit dem Judentums und Christentums
- Die Rolle des Korans und der Propheten im Verständnis des Islams
- Islamische Eschatologie und Soteriologie
- Der christlich-islamische Dialog
Zusammenfassung der Kapitel
1. Voraussetzungen und Quellen: Diese Einleitung beschreibt die wachsende Bedeutung des Islams in der heutigen Gesellschaft und die oft damit verbundenen Missverständnisse und Vorurteile. Sie betont die Notwendigkeit eines interreligiösen Dialogs, um ein friedliches Miteinander zu fördern. Die Arbeit legt ihren Fokus auf das Verständnis des islamischen Gottesbildes und dessen Beziehungen zu anderen monotheistischen Religionen. Die Bedeutung der Quellen, wie dem Koran und der Sunna, wird ebenfalls angedeutet.
2. Grundlagen muslimischer Theologie: Dieses Kapitel befasst sich mit den fundamentalen Elementen der muslimischen Theologie. Es erläutert die Rolle Gottes als Schöpfer, Erhalter und Richter der Welt, die Bedeutung von Engeln und Schöpfungsmythen. Ein wichtiger Aspekt ist die Offenbarung Gottes, wobei die Rollen von Abraham, Jesus und Mohammed im islamischen Kontext detailliert dargestellt werden. Der Fokus liegt auf dem Aufbau eines soliden theologischen Fundaments für das Verständnis des islamischen Gottesbildes.
3. Elemente islamischer Theologie: Dieses Kapitel untersucht die eschatologischen und soteriologischen Aspekte des Islams. Es befasst sich mit den islamischen Vorstellungen vom Jüngsten Gericht und dem Heil, welche eine wichtige Rolle im Gesamtverständnis des Glaubens und der Beziehung zum Göttlichen spielen. Diese Konzepte werden im Kontext des islamischen Gottesbildes beleuchtet und deren Bedeutung für die muslimische Lebenswelt erklärt.
4. Islam und Christentum: Dieses Kapitel analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem islamischen Monotheismus und der christlichen Trinität. Es befasst sich mit dem Thema des christlich-islamischen Dialogs und untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen eines konstruktiven Austausches zwischen beiden Religionen. Die Kapitel beleuchtet die historischen und theologischen Aspekte dieses Dialogs und versucht, Brücken zwischen den beiden Glaubensrichtungen zu schlagen.
Schlüsselwörter
Islam, Gottesbild, Monotheismus, Koran, Sunna, Mohammed, Judentum, Christentum, interreligiöser Dialog, Eschatologie, Soteriologie, christlich-islamischer Dialog.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Islamisches Gottesbild
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das islamische Gottesbild. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des islamischen Gottesbildes, seiner Entwicklung und seines Verständnisses im Vergleich zum Judentum und Christentum. Der Text zielt auf ein besseres Verständnis des Islams und die Förderung des interreligiösen Dialogs ab.
Welche Quellen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt den Koran und die Sunna (Hadith) als zentrale Quellen des Islams. Darüber hinaus werden die Beziehungen des Islams zum Judentum und Christentum untersucht, um das islamische Gottesbild in einem breiteren religiösen Kontext zu verstehen.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Kapitel 1 (Voraussetzungen und Quellen): Einführung, historische Person Mohammed, der Koran, Hadith/Sunna, Beziehungen des Islams zu Judentum und Christentum sowie zur Gnosis.
Kapitel 2 (Grundlagen muslimischer Theologie): Gottesbild als Schöpfer, Erhalter und Richter, Engel, Schöpfungsmythen, Offenbarung Gottes (Abraham, Jesus, Mohammed).
Kapitel 3 (Elemente islamischer Theologie): Islamische Eschatologie (Jüngstes Gericht) und Soteriologie (Heilslehre).
Kapitel 4 (Islam und Christentum): Vergleich des islamischen Monotheismus mit der christlichen Trinität und der christlich-islamische Dialog.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, das islamische Gottesbild zu beschreiben und dessen Entwicklung und Verständnis zu beleuchten. Er möchte die enge Verwandtschaft zum Judentum und Christentum hervorheben und ein besseres Verständnis des Islams fördern, um zum interreligiösen Dialog beizutragen.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Islam, Gottesbild, Monotheismus, Koran, Sunna, Mohammed, Judentum, Christentum, interreligiöser Dialog, Eschatologie, Soteriologie, christlich-islamischer Dialog.
Wie wird das islamische Gottesbild im Vergleich zu Judentum und Christentum dargestellt?
Der Text betont die enge Verwandtschaft des islamischen Gottesbildes mit dem Judentum und Christentum, indem er Gemeinsamkeiten und Unterschiede, insbesondere im Hinblick auf den Monotheismus und die jeweiligen Offenbarungen, herausarbeitet. Der Vergleich dient dem besseren Verständnis des islamischen Gottesbildes in einem breiteren religiösen Kontext.
Welche Rolle spielen der Koran und die Sunna im Text?
Der Koran und die Sunna werden als zentrale Quellen für das Verständnis des islamischen Gottesbildes und der islamischen Theologie im Allgemeinen vorgestellt. Sie bilden die Grundlage für die Darstellung der theologischen Konzepte im Text.
Was ist die Bedeutung des interreligiösen Dialogs im Text?
Der interreligiöse Dialog wird als wichtiges Ziel und Anliegen des Textes hervorgehoben. Das Verständnis des islamischen Gottesbildes soll zum friedlichen Miteinander der Religionen beitragen und Missverständnisse und Vorurteile abbauen.
- Quote paper
- Steffen Gehre (Author), 2005, Der Islam und sein Gottesbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/39811