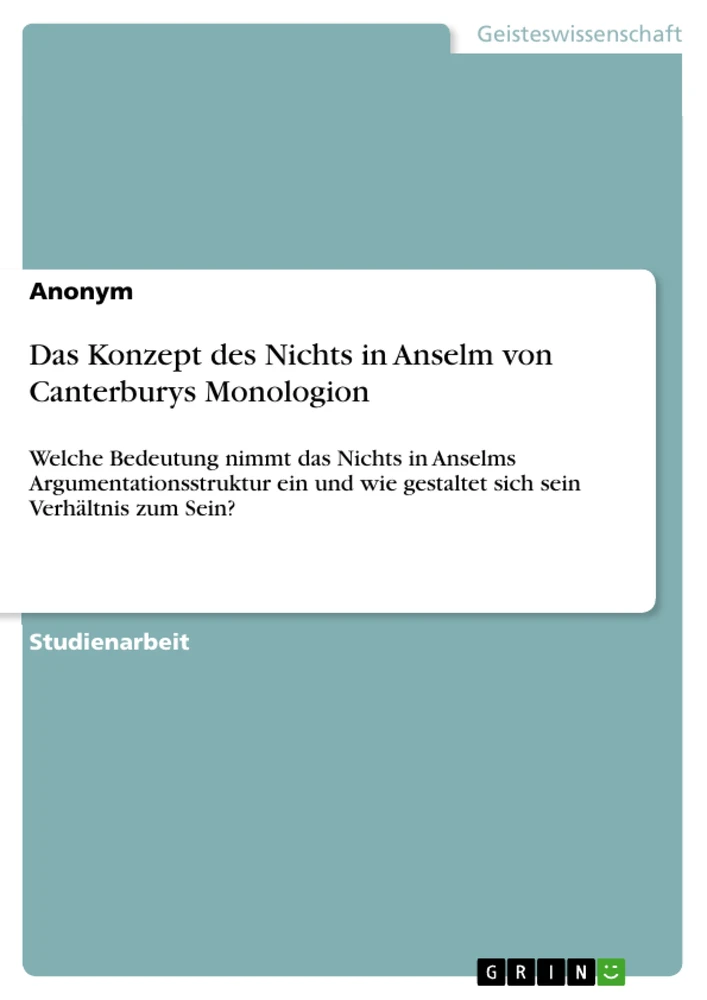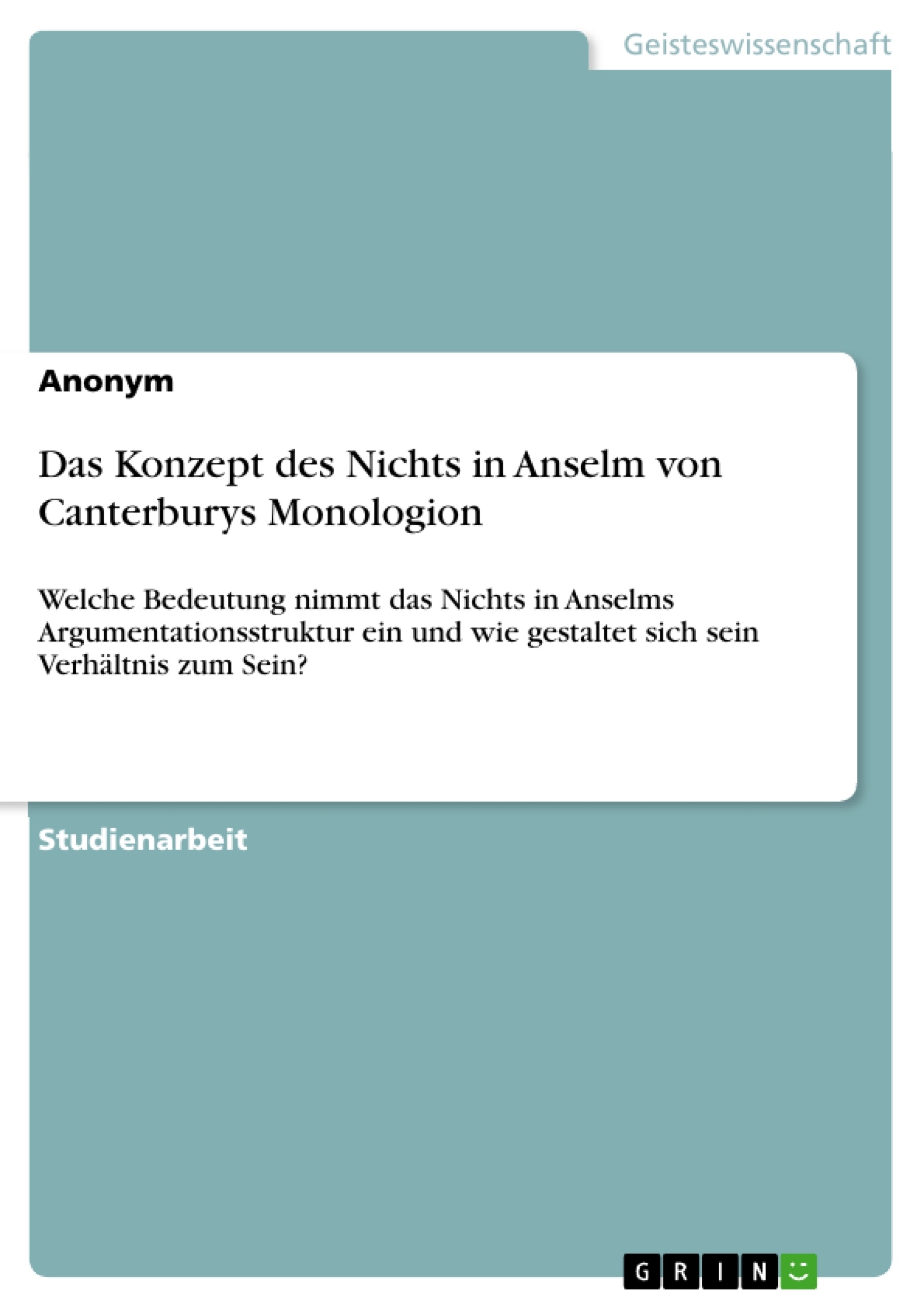In seiner um 1076 verfassten Schrift Monologion versucht Anselm von Canterbury anhand zahlreicher Argumente eine mögliche Herangehensweise aufzuzeigen, anhand derer man sich von dem überzeugen könne, „was wir [gemeint sind hierbei gläubige Christen] von Gott und seiner Schöpfung notwendig glauben.“ Dies soll ohne jegliche Voraussetzungen geschehen, also ohne den Bezug zu bereits existenten sakralen Texten herzustellen, somit vollkommen frei von Prämissen. Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, bedarf es der entsprechenden Methodik, die Anselm verwirklicht, indem er sich ausschließlich auf die Vernunft (sola ratione) als Quelle zum Erlangen von Erkenntnis bezieht. Hierbei stellen Glaube und Vernunft für Anselm keine Gegensätze dar, vielmehr erweisen sie sich als vollkommen miteinander vereinbar. Ihr Unterschied besteht jedoch darin, dass im Gegensatz zum Glauben, der ein Geschenk Gottes ist, jeder Mensch von Natur aus mit Vernunft bedacht wird. Wenn daher auch eine Diskussion mit dem Ungläubigen beziehungsweise Toren, wie er in Anselms Folgewerk, dem Proslogion, genannt wird, über den Inhalt des Glaubens auf der Ebene des Glaubens nicht möglich ist, so ist sie es doch auf der Ebene der Vernunft, die jedem Menschen von Natur aus mitgegeben ist. Auf Grundlage der Vernunft thematisiert Anselm in seinem Werk Monologion so den Beweis der Existenz eines höchsten Wesens, die Bestimmung dieser höchsten Wesenheit und letztlich die Bestimmung des Menschen. Die Thematik, die Anselm in seinem Werk ausführt, ist gleichsam unweigerlich mit dem Nachdenken über das Nichts verbunden. Stellt man sich nämlich die Frage, wieso überhaupt etwas existiert, warum nicht vollkommenes Nichts herrscht, wird bewusst, dass es sich dabei um die eine zentrale Frage handelt, die sich die Menschheit permanent stellt, und zwar die Frage nach dem Ursprung von allem und somit auch nach unserem Platz in der Welt. Ebendiese Frage versucht Anselm in seinem Monologion vernünftig zu erschließen, indem er die Existenz eines höchsten Wesens und dessen Verhältnis zum Sein aller existierenden Dinge untersucht.
Aufgrund dessen soll im Zentrum dieser Seminararbeit nun der, innerhalb Anselms umfangreicher Schrift des Monologions stets präsente Aspekt des Nichts stehen, wie das Konzept des Nichts immer wieder Einzug in Anselms Argumentationsstruktur erhält, welche möglichen Kritikpunkte es in seinen Beweisgängen mit sich bringt und wie Anselm diese letztlich versucht, aus dem Weg zu räumen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Nichts - Erschließung des Begriffes
- III. Das Nichts in Anselms Beweisführungen
- III.1. Grundlegende Erschließung der höchsten Wesenheit
- III.2. Ursprung der höchsten Wesenheit – „durch sich selbst\" Sein..
- III.3. Creatio ex nihilo.........
- III.4. Raum und Zeit als Begrenzung der höchsten Wesenheit
- IV. Zusammenfassung...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Bedeutung des Nichts in Anselms Monologion. Sie untersucht, wie Anselm das Nichts in seine Argumentationsstruktur integriert und welche Kritikpunkte sich daraus ergeben. Dabei wird zunächst die allgemeine Bedeutung des Begriffs "Nichts" erläutert. Im Anschluss folgt eine exegetische Analyse von Anselms Beweis für die Existenz eines höchsten Wesens und dessen Verhältnis zum Nichts. Die Arbeit konzentriert sich auf die Erörterung des Ursprungs der höchsten Wesenheit ("durch sich selbst" Sein), der Schöpfung aus dem Nichts (Creatio ex nihilo) sowie der Rolle von Raum und Zeit in Bezug auf die höchste Wesenheit.
- Die Rolle des Nichts in Anselms Argumentationsstruktur
- Kritikpunkte und Herausforderungen in Anselms Beweisgängen
- Der Ursprung der höchsten Wesenheit und ihr Verhältnis zum Nichts
- Die Schöpfung aus dem Nichts (Creatio ex nihilo) in Anselms Werk
- Raum und Zeit als Begrenzungen der höchsten Wesenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in Anselms Monologion und dessen Zielsetzung ein. Sie beschreibt Anselms Bestreben, die Existenz Gottes durch Vernunft zu beweisen, ohne auf bestehende sakrale Texte zurückzugreifen. Die Bedeutung des Nichts wird als zentrale Frage im Kontext der Existenz und des Ursprungs von allem herausgestellt.
Kapitel II beschäftigt sich mit der Erschließung des Begriffs "Nichts" in der Alltagssprache und philosophischen Diskussion. Das Nichts wird als ein universelles, abstraktes Konzept betrachtet, das die Negation des Seins, die Abwesenheit von irgendetwas, darstellt.
Kapitel III untersucht die Rolle des Nichts in Anselms Beweisführungen für die Existenz und Bestimmung der höchsten Wesenheit. Abschnitt III.1 beleuchtet die Grundlegung von Anselms Argumentation, die auf der Güte von Dingen basiert, um ein höchstes Gut zu erschließen. Abschnitt III.2 geht auf den Ursprung der höchsten Wesenheit ein, die "durch sich selbst" existiert. Abschnitt III.3 beleuchtet die Schöpfung aus dem Nichts (Creatio ex nihilo), während Abschnitt III.4 Raum und Zeit als Begrenzungen der höchsten Wesenheit in Anselms Argumentation thematisiert.
Schlüsselwörter
Das Nichts, Anselm von Canterbury, Monologion, höchste Wesenheit, Vernunft, Schöpfung, Creatio ex nihilo, Raum, Zeit, Existenz, Beweisführung, Argumentationsstruktur.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Das Konzept des Nichts in Anselm von Canterburys Monologion, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/388697