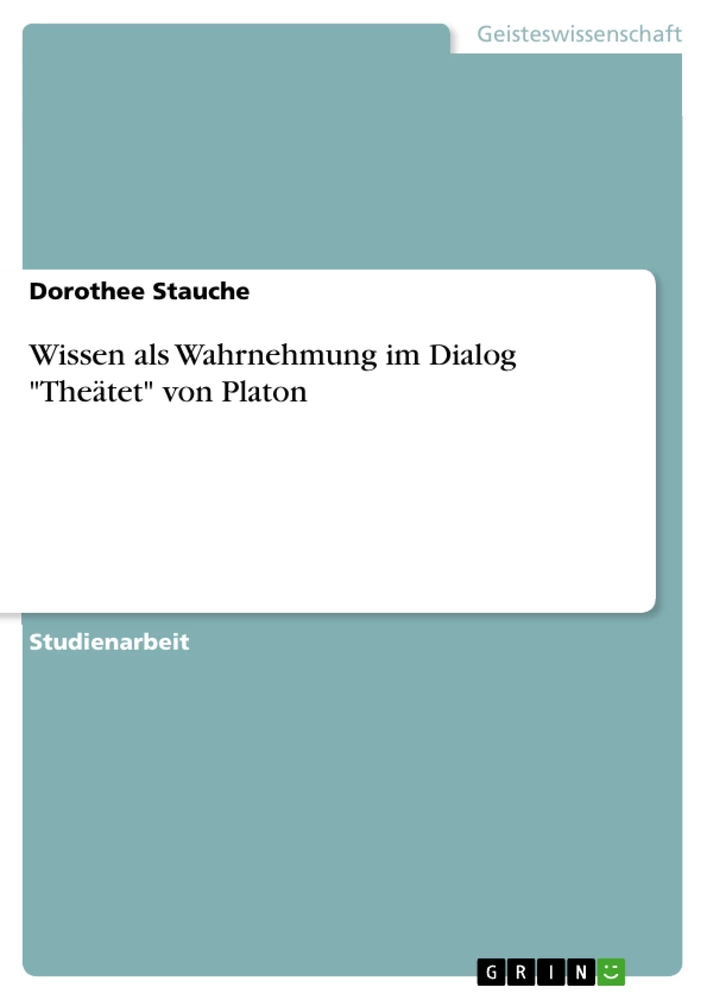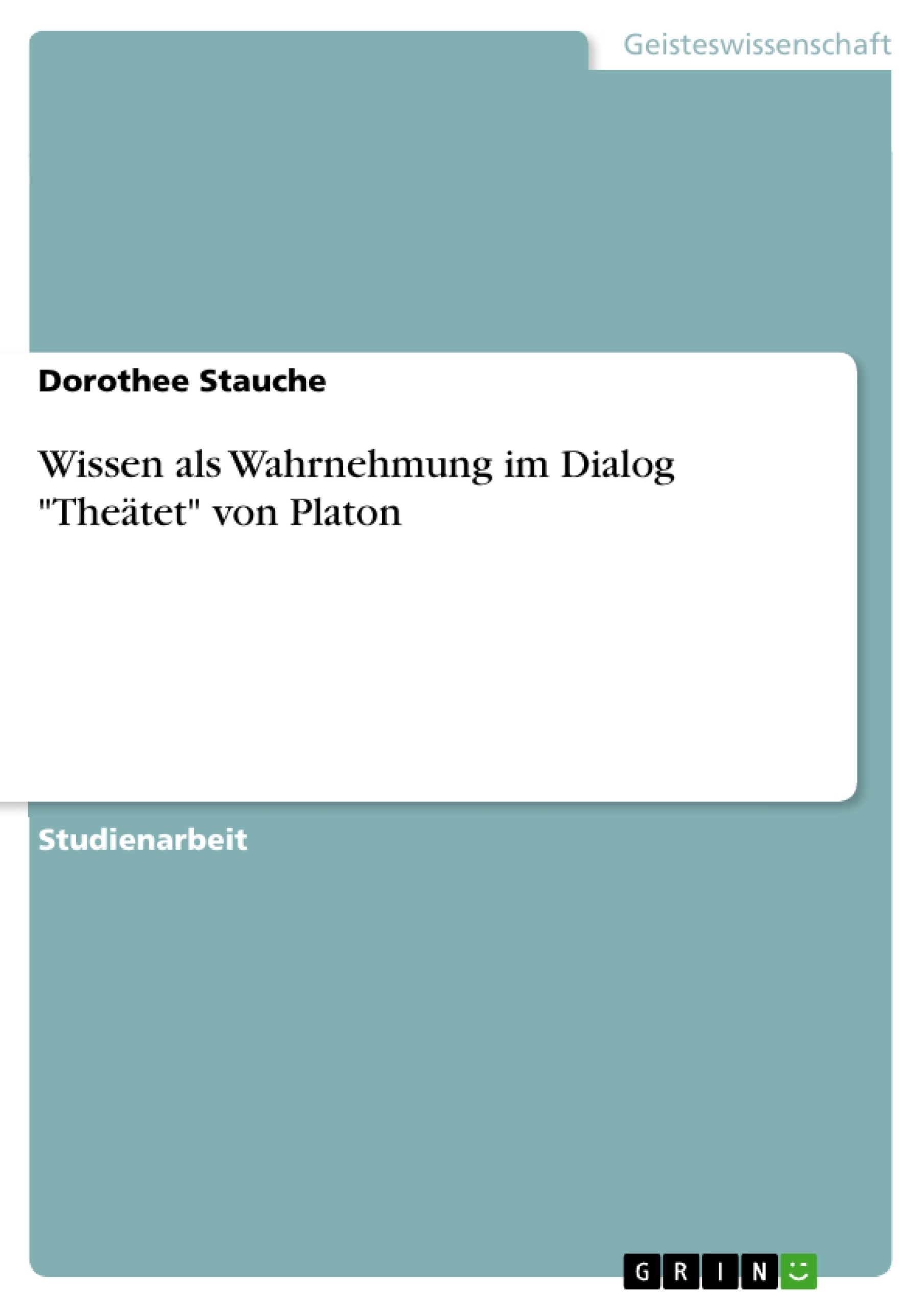Die Fragen, was Wissen ist, wie es klassifiziert werden kann und vor allem auch was Wissen nicht ist, sind viel diskutiert und sehr aktuell. Nicht für umsonst wird die moderne, westliche Gesellschaft auch mit dem Begriff „Wissensgesellschaft“ umschrieben. Dieser Terminus der Wissensgesellschaft – also der wissenden Gesellschaft – ist dabei inhaltlich ähnlich schwer zu fassen, wie der Logos „wissen“ selbst. Diese Problematik, die sich um das Wissen aufbaut, beschäftigt die Menschen schon seit jeher. Platons Dialog Theätet befasst sich eingehend mit jener Problematik und versucht eine adäquate Definition für Wissen zu erzielen. Dieser Dialog, der zum Spätwerk Platons zählt, lässt sich in sechs thematische Abschnitte teilen, wobei die ersten beiden Teile eine einleitende Funktion erfüllen.
Diese Arbeit widmet sich der ersten Definition „Wissen als Wahrnehmung“, welche in etwa die erste Hälfte des gesamten Dialogs ausmacht. Es wird dabei vorrangig versucht, den Gedanken zu dieser Definition nachzuspüren, sie zu verstehen und sie schlüssig wiederzugeben. Abschließend wird sich mit der Frage beschäftigt, welche rhetorische Aufgabe der lange gefasste erste Teil des Gesprächs erfüllt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Darlegung der ersten Definition von Wissen ist Wahrnehmung (151d-160e)
- Der „,Homo-Mensura“-Satz des Protagoras und die Flusstheorie des Heraklit (151e-155e)
- Der Wahrnehmungsakt als interaktiv gedachtes Modell (156a-160e)
- Die Widerlegung der ersten Definition (161a-186e)
- Die erste Kritik an der protagoreischen Lehre und der ersten Definition (161a-165e)
- Die Verteidigungsrede des Protagoras durch Sokrates (165e-168e)
- Das theoretische Argument der Selbstwiderlegung und Zweifel an diesem (169a-172b)
- Endgültige Widerlegung der Flusstheorie des Heraklit (177c-183b)
- Die abschließende Falsifikation der ersten Definition (183c-187a)
- Die Funktion der minuziösen Diskussion der ersten Definition
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den ersten Teil des Platonschen Dialogs „Theätet“, in dem die erste Definition von Wissen, „Wissen ist Wahrnehmung“, diskutiert wird. Das Ziel ist es, den Gedankengang dieser Definition zu erforschen, zu verstehen und schlüssig darzustellen. Außerdem wird untersucht, welche rhetorische Funktion dieser lange erste Abschnitt im Gesamtkontext des Dialogs erfüllt.
- Definition von Wissen als Wahrnehmung
- Verbindung der Definition mit dem Homo-Mensura-Satz des Protagoras
- Kritik an der ersten Definition
- Die Rolle der Wahrnehmung und des Wahrnehmungsaktes
- Rhetorische Funktion des ersten Teils des Dialogs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Einführung der ersten Definition von Wissen als Wahrnehmung und zeigt die Verbindung zum Homo-Mensura-Satz des Protagoras auf. Im Anschluss wird diskutiert, wie der Wahrnehmungsakt als ein interaktiv gedachtes Modell zu verstehen ist. Der zweite Teil widmet sich der Kritik an der ersten Definition und analysiert die Argumente, die gegen diese Definition sprechen. Dabei werden die theoretischen Aspekte der Selbstwiderlegung und die finale Falsifikation der Definition erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Wissen, Wahrnehmung, Protagoras, Homo-Mensura-Satz, Flusstheorie des Heraklit, Selbstwiderlegung, Falsifikation, Rhetorik, Dialog, Theätet.
- Quote paper
- Dorothee Stauche (Author), 2017, Wissen als Wahrnehmung im Dialog "Theätet" von Platon, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/388550